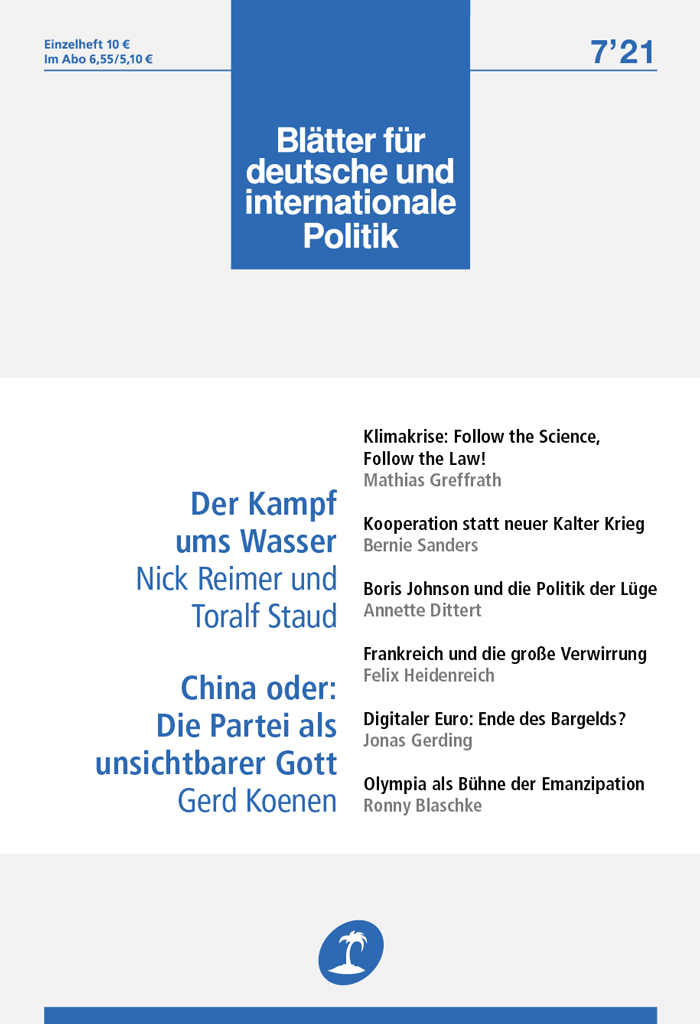Bild: Einweihung des Nachtzugs auf der Strecke Paris-Nizza. Die Verbindung war 2017 von der SNCF wegen mangelnder Rentabilität eingestellt worden. Ihre Wiederaufnahme wird das Angebot an Nachtzügen in Frankreich erweitern, 20.05.2021 (IMAGO / IP3press)
2021 ist das perfekte Jahr, um endlich eine europäische Verkehrswende einzuleiten und die Bahn wieder zum Rückgrat unserer Mobilität zu machen. Das Denken der Europäer*innen ändert sich gerade radikal, getrieben von einem neuen Klimabewusstsein und den einschneidenden Erfahrungen der Corona-Pandemie. Nie war die Bereitschaft zum Umsteigen auf nachhaltige Verkehrsmittel so groß. Eine Umfrage der Europäischen Investitionsbank ergab kürzlich, dass 74 Prozent der Befragten in Europa nach der Pandemie weniger fliegen wollen und 71 Prozent Kurzstreckenflüge durch die Bahn ersetzen möchten.[1]
Gleichzeitig wird die Dringlichkeit einer Verkehrswende immer deutlicher. Die Europäische Union will bis spätestens 2050 klimaneutral werden und das geht nicht allein mit Schönheitsreparaturen, sondern erfordert ein grundlegendes Umdenken: Die Reduzierung des Verkehrs und seine Verlagerung auf die Schiene bilden die Basis für eine klima- und ressourcenschonende Zukunft.
Und schließlich werden mit den großangelegten Investitionen der Post-Corona-Konjunkturprogramme gerade Fakten für die Zukunft geschaffen. Denn die Verkehrsinfrastruktur, die heute gebaut wird, beeinflusst unser Mobilitätsverhalten auf Jahrzehnte. Umso mehr können jetzt Investitionen in nachhaltige Verkehrsmittel dabei helfen, nicht nur die Wirtschaft wiederzubeleben, sondern sie gleichzeitig auch in nachhaltigere Bahnen zu lenken. Es gilt also, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen und im wahrsten Sinne des Wortes die richtigen politischen Weichen zu stellen. Bahnfahren muss so attraktiv werden, dass die Europäer*innen ihre neuen Mobilitätspläne auch verwirklichen können.
Mehr Bahn für Europa – mehr Europa für die Bahn
Auch im Autoland Deutschland kommt dieses Denken langsam an, wenn auch bisher eher zaghaft. Mit dem Deutschlandtakt und einem großen Investitionsprogramm für die Schieneninfrastruktur wollte Bundesverkehrsminister Andi Scheuer eine neue Ära einleiten; von der Dekade der Schiene war die Rede. Schaut man sich die Zahlen und Maßnahmen aber genauer an, steckt bisher nicht viel dahinter. So waren im Haushalt 2020 nur 1,52 Mrd. Euro für den Aus- und Neubau von Schieneninfrastruktur vorgesehen, 2021 sind es 1,6 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Für den Aus- und Neubau von Bundesstraßen sind 2021 doppelt so viele Mittel eingeplant – 3,1 Mrd. Euro. Mit 76 Euro pro Jahr und Bundesbürger*in fallen die Schieneninvestitionen in Deutschland viel niedriger aus als bei vielen europäischen Nachbarn – in den Niederlanden und Dänemark liegen sie fast doppelt so hoch. Der Wendepunkt zum Bahnland ist also in Deutschland noch nicht in Sicht.
Das gilt auch für Europa: Zwar sind der freie Personen- und Warenverkehr innerhalb des Kontinents zentrale Grundwerte der EU, die zumindest in Nicht-Pandemiezeiten fest im Denken und Leben der Menschen verankert sind. Aber im Bahnverkehr ist das noch nicht angekommen – oder vielmehr abhanden gekommen. Das Bahnnetz ist nicht nur innerhalb der meisten EU-Länder, sondern auch zwischen den Ländern zusammengeschrumpft. Besonders deutlich wird das bei den Nachtzügen, die einst ganz Europa durchkreuzten, aber seit der Jahrtausendwende größtenteils eingestampft wurden. Ein anderes Beispiel ist der Trans-Europ-Express, der von den 1950er Jahren an drei Jahrzehnte lang die meisten Länder Westeuropas mit bequemen Langstreckenzügen verband. Heute jedoch bildet der grenzüberschreitende Verkehr die Achillesferse des europäischen Bahnnetzes. Ganze 149 der einst bestehenden 365 Bahn-Grenzübergänge sind nicht mehr in Betrieb, wie eine Studie der Europäischen Kommission 2018 ergab. Und selbst wo Infrastruktur noch existiert, wird sie meist nur unzureichend genutzt. Selbst die Hauptstädte mancher Nachbarstaaten sind nicht per Direktverbindung erreichbar. So gibt es derzeit keinen Direktzug zwischen Lissabon und Madrid, Madrid und Paris oder Paris und Berlin.
Grenzverkehr mit Hindernissen
Gerade Deutschland ist aufgrund seiner geographischen Lage und relativen Größe ein wichtiger Knoten- und Transitpunkt für europäische Bahnverbindungen. Viele der noch vorhandenen europäischen Langstreckenverbindungen und sechs der neun Korridore im Rahmen des geplanten europäischen Verkehrsnetzes (Trans-European Transport Network) verlaufen durch die Bundesrepublik. Derzeit macht der internationale Verkehr zwar nur zwölf Prozent der Fahrgäste im Fernverkehr der Deutschen Bahn aus, aber das Potential ist deutlich größer: Von deutschen Flughäfen fliegen gut zwei Drittel der Passagiere ins europäische Ausland und viele der zurückgelegten Distanzen liegen unter tausend Kilometern.
Langsam scheint sich immerhin die Erkenntnis zu verbreiten, dass ein attraktives Europa mehr Bahn und eine attraktive Bahn mehr Europa braucht. So hat die EU 2021 zum Europäischen Jahr der Schiene erklärt, und Verkehrsminister Scheuer träumt vom Europatakt und von einer Wiederbelebung des Trans-Europ-Express. Das sind vielversprechende Signale, aber werden den Worten auch Taten folgen? Bisher sieht es nicht so aus: Das Europäische Jahr der Schiene ist mit einem kleinen Budget ausgestattet und eher als Marketing-Kampagne gedacht. Der Trans-Europ-Express 2.0 ist bisher nicht mehr als eine vage Idee. Das Verkehrsministerium verweist darauf, dass die Bahnunternehmen die Umsetzung unter sich regeln sollen. Doch Fakt ist: Solange an den Rahmenbedingungen für den internationalen Bahnverkehr nichts geändert wird, helfen all die schönen Ideen wenig.
Warum aber bestehen in Europa so wenig internationale Verbindungen? Das hat mehrere Gründe: Erstens ist die Infrastruktur an den Grenzen oft schlecht ausgebaut, weil zumeist Ausbaumaßnahmen für den Inlandsverkehr den Vorzug erhalten. So ist die Strecke zwischen München und Prag auf deutscher Seite immer noch nicht elektrifiziert, daher benötigt der Zug für nur 400 Kilometer fast sechs Stunden. Zweitens sind internationale Verbindungen für die Betreiber oft mit zusätzlichen Kosten verbunden, denn jedes Land hat seine eigenen Regeln und technischen Anforderungen. So müssen Züge für jedes Land mit entsprechenden Strom- und Signalsystemen ausgestattet und zertifiziert werden, was Mehrkosten von 40 Prozent gegenüber einem Standardzug bedeutet. Lokführer müssen zudem mehrsprachig ausgebildet sein und Trassen-Slots für jedes Land einzeln beantragt werden. Auch müssen Betreiber für die Abwicklung und den Vertrieb von internationalen Verbindungen mit anderen Bahnunternehmen kooperieren, mit entsprechendem Mehraufwand. Zu dieser Komplexität kommt, drittens, hinzu, dass die Bahn gegenüber dem Flug-und Autoverkehr stark benachteiligt wird – sowohl steuerlich als auch bei der Zuteilung von Infrastrukturgeldern. Die Bahn zahlt in Deutschland Trassenentgelte in voller Höhe für jeden Kilometer Infrastruktur, den sie nutzt, während auf der Straße Gebühren für gerade einmal sechs Prozent des Netzes erhoben werden – und dort auch nur für Lastwagen. Über Jahrzehnte floss der Großteil der Investitionen aus dem Bundeshaushalt in die Straße. Die Luftfahrt wiederum profitiert jährlich von Steuergeschenken in Höhe von zwölf Mrd. Euro, weil sie weder Mehrwertsteuer auf internationale Tickets noch Kerosinsteuer zahlt.
Deutschland ohne Nachtzüge
Diese steuerliche Bevorzugung findet sich auch in anderen EU-Ländern, jedoch sind die Trassenentgelte, also die Schienenmaut, in den meisten Ländern deutlich niedriger als in Deutschland. Außerdem garantieren viele EU-Länder auch finanziell unattraktivere Bahnverbindungen, indem sie mit Bahnunternehmen Verkehrsverträge abschließen. Dieses Prinzip wird in Deutschland im Regionalverkehr angewandt, nicht aber im Fernverkehr. Daher müssen sich hierzulande alle Bahnverbindungen selbst tragen, was bei internationalen Verbindungen angesichts der beschriebenen Hindernisse schwierig bis unmöglich ist.
Dass Deutschland beim internationalen Bahnverkehr noch nicht den Takt angibt, sondern gerade eher zum Schlusslicht wird, zeigt sich besonders am Beispiel der Nachtzüge. Als die Deutsche Bahn 2016 ihre letzten Nachtzüge aufgab, sprang die österreichische ÖBB ins Geschäft und kaufte viele der deutschen Schlaf- und Liegewagen auf. Heute betreibt die ÖBB 19 Nachtzuglinien quer durch Europa, bald sollen es 26 sein. Rückendeckung erhält sie dabei von der österreichischen Regierung, die 500 Mio. Euro in Schlafwagen investieren möchte. Zudem haben die schweizerische SBB und die ÖBB im vergangenen Jahr eine Kooperation angekündigt, um auch das Nachtzug-Angebot von der Schweiz aus auszubauen.
Auch die niederländische Regierung unterstützt die ÖBB mit einer Starthilfe, damit ein Nachtzug von Wien nach Amsterdam rollen kann. Schweden wiederum stellt 40 Mio. Euro für neue Nachtzüge nach Berlin und Brüssel zur Verfügung. Die französische Regierung gab Anfang 2021 bekannt, 100 Mio. Euro in die Renovierung von 50 Schlafwägen zu investieren und so neue Nachtzugverbindungen möglich zu machen.
In der Bundesrepublik hingegen zeigen bisher weder das Verkehrsministerium noch die Deutsche Bahn großes Interesse. Die DB gab zwar Ende 2020 bekannt, als Teil der Trans-Europ-Express-2.0-Initiative gemeinsam mit ÖBB, SBB und der französischen SNCF bis 2024 vier neue Nachtzuglinien lancieren zu wollen, ihre Rolle dabei ist aber sehr begrenzt: Eigene Schlafwagen möchte sie nicht anschaffen, wie sie Anfang 2021 erklärte. Daneben gibt es zwar Wettbewerber, die Interesse am Nachtzug-Geschäft zeigen, aber von den hohen Trassenentgelten in Deutschland und hohen Anfangsinvestitionen in Schlafwagen abgeschreckt werden. Dabei ist das Potential für Nachtzüge groß: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass zwei Drittel der Menschen in Deutschland gerne mit dem Nachtzug fahren würden. Das aber wird ohne staatliche Unterstützung oder eine Veränderung der Rahmenbedingungen kaum möglich sein.
Ob Nacht- oder Tagzug: Der europäische Bahnverkehr braucht mehr politischen Rückenwind, vor allem von deutscher Seite.
Rückenwind für den Europatakt
Sechs Maßnahmen könnten dem Bahnverkehr im Europäischen Jahr der Schiene den nötigen Anschub geben: Erstens gilt es, den Zielfahrplan Europatakt zu entwickeln. Der Deutschlandtakt und die Idee einer Wiederbelebung des Trans-Europ-Express sind wichtige Schritte hin zu einem stärkeren europäischen Bahnnetz. Ein echter Europatakt braucht allerdings weitere Langläufer-Strecken mit Tag- und Nachtzügen, aber auch kürzere Verbindungen im Stundentakt sowie eine gut vertaktete Anbindung an den Regionalverkehr. Deutschland sollte hier zur treibenden Kraft in Europa werden.
Zweitens muss die Bunderegierung die Verantwortung für internationale Verbindungen übernehmen: Züge grenzüberschreitend fahren zu lassen, ist mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden als der Betrieb rein nationaler Verbindungen. Fast alle EU-Mitgliedstaaten schließen daher Verkehrsverträge mit Bahnunternehmen ab, um Angebote auf der Schiene zu garantieren, auch wenn sie finanziell nicht lukrativ sind. Das ist hierzulande immer noch nicht möglich: Deutschland ist das einzige EU-Land ohne nationalen Aufgabenträger für den Fernverkehr.
Drittens ist es an der Zeit, die Kosten für die Verkehrswende fair zu verteilen: Die Bahn hat im Wettbewerb mit anderen Verkehrsträgern nur dann eine Chance, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Solange sich an der Grundstruktur nichts ändert, sind alle anderen Maßnahmen nicht mehr als Nothilfen. Um mehr Anreize für den Betrieb internationaler Verbindungen zu schaffen, müssen die Trassenpreise in Deutschland auf die Höhe der direkten Kosten begrenzt werden. Deutschland sollte sich zudem auch auf europäischer Ebene für eine Kerosinsteuer einsetzen und damit für mehr Kostengerechtigkeit.
Viertens ist es dringend geboten, Nadelöhre in der Infrastruktur zu beseitigen: Um Kapazitäten für mehr europäische Verbindungen zu schaffen, muss der Bund in den kommenden Jahren die Gelder für die Schieneninfrastruktur mindestens verdoppeln. Insbesondere müssen Elektrifizierungslücken an Grenzen geschlossen, die Umstellung auf das europäische Signalsystem beschleunigt und die Ausbaumaßnahmen für den Deutschlandtakt umgesetzt werden.
Fünftens sollte die Bundesregierung eine Investitionsinitiative „Züge für Europa“ starten: Um die Mehrkosten für interoperable Züge, die mit verschiedenen Signal- und Stromsystemen ausgestattet sind, zu kompensieren, sollte Deutschland einen staatlich geförderten Fahrzeugpool aufbauen oder den Kauf solcher Züge und Nachtzüge bezuschussen.
Und sechstens gilt es, Daten für den europaweiten Fahrkartenverkauf verfügbar machen: Um attraktiv zu sein, müssen europaweite Verbindungen einfach und reibungslos buchbar sein und durchgehend mit Fahrgastrechten geschützt sein. Das ist bisher nicht der Fall. Deshalb sollten Bahnunternehmen dazu verpflichtet werden, Echtzeit-Daten und Fahrkarten-Daten offen zu teilen.
Will Europa seine Klimaziele erreichen, braucht es mehr Bahn – und die Bahn braucht mehr Europa. Deutschland bringt alle Voraussetzungen mit, um eine Renaissance des europäischen Bahnsystems mit dem nötigen Schwung anzukurbeln. Das aber erfordert mehr als nur schöne Visionen.
[1] Der Beitrag basiert auf: Germanwatch, Für die Renaissance des europäischen Bahnverkehrs. Was Deutschland jetzt tun sollte, Bonn 2021. Dort finden sich auch alle Quellenangaben.