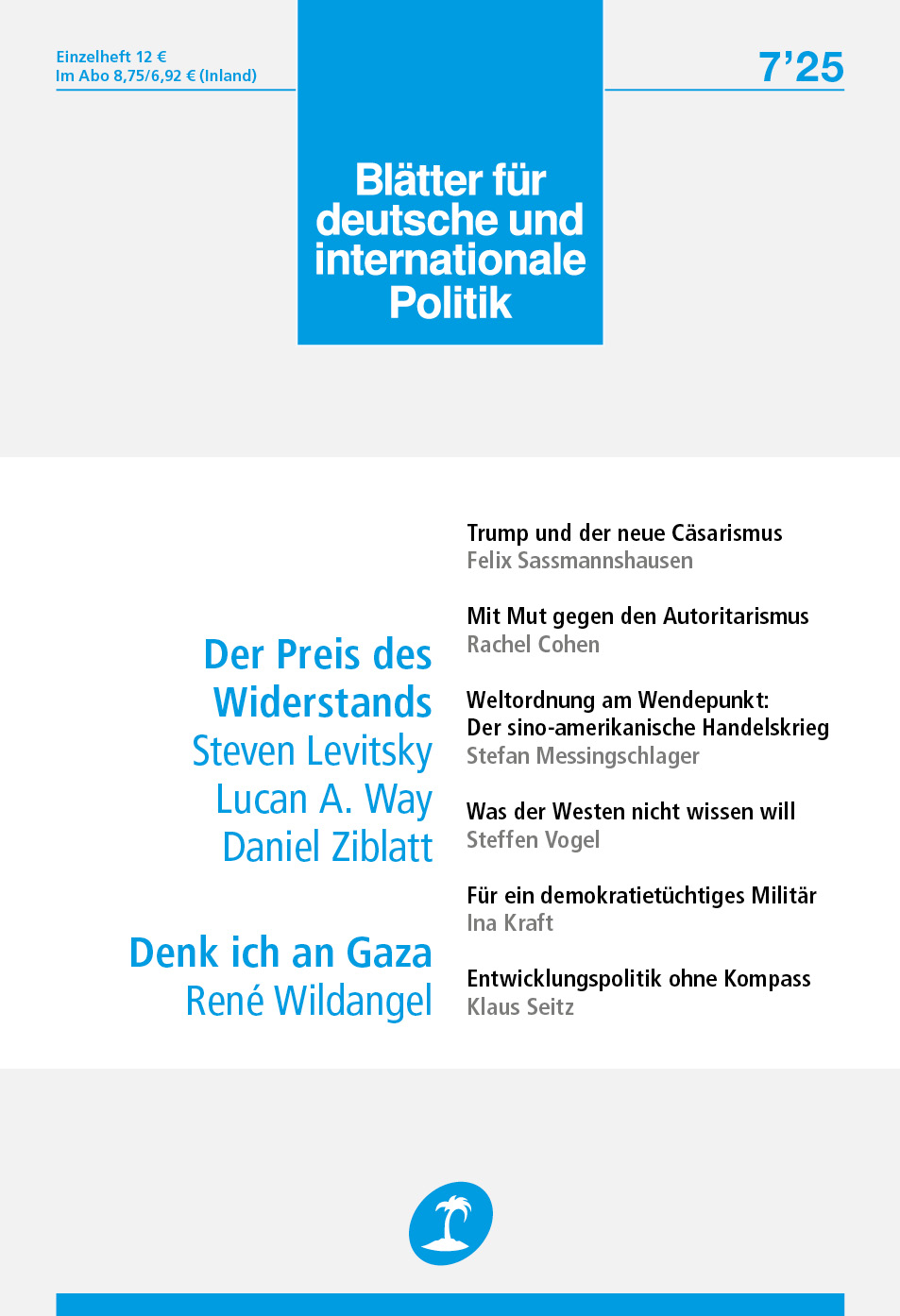Wie wir die Bundeswehr vor einer autoritären Übernahme schützen können

Bild: Soldaten und Soldatinnen in Uniform bei der Parade zum Veteranentag, 15.6.2025 (IMAGO / Breuel-Bild)
Nie seit dem Ende des Kalten Krieges war der sicherheitspolitische Druck auf Deutschland so hoch wie jetzt.[1] Die Bundesrepublik sieht sich mit einer doppelten Herausforderung konfrontiert. Sie muss sowohl auf eine aggressive russische Außenpolitik als auch auf eine strategische Abkehr der USA von Europa reagieren. Die sicherheitspolitische Lage, da sind sich große Teile des politischen Spektrums einig, verlange nicht nur eine verbesserte Ausrüstung der Bundeswehr, sondern auch deren grundlegende Wiederausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung, inklusive eines Kriegstüchtigkeitsmindsets. Dabei droht hierzulande jedoch ein wichtiger Gesichtspunkt aus dem Blick zu geraten: Gefahr für Demokratien in Europa droht nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seit Mitte der 2000er Jahre lässt sich weltweit ein Rückgang demokratischer Qualität beobachten: Autokratien werden autoritärer, während viele Demokratien schleichend erodieren – oft ohne formal undemokratisch zu werden.[2] Dabei zu glauben, der globale autokratische Umbau beschränke sich lediglich auf die klassischen Institutionen der Innenpolitik – etwa Justiz, Parlamente, Wahlsysteme oder Medien –, greift zu kurz. Auch das Militär, das eigentlich den äußeren Schutz des Staates gewährleisten soll, und in Demokratien – gerade in Deutschland – oftmals kaum eine innenpolitische Rolle spielt, kann in den Sog autoritärer Tendenzen geraten.
Deutlich wurde dies bereits während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in den Jahren 2017-2021, als dieser versuchte, das Militär in autokratischer Manier für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. So ließ er sich etwa im Juni 2020 von seinem damaligen Generalstabschef Mark Milley zu einem Fototermin auf dem Lafayette Square in Washington begleiten, nachdem Sicherheitskräfte nur kurz zuvor friedlich Demonstrierende gewaltsam vertrieben hatten. Milleys Anwesenheit, noch dazu in Flecktarn, wurde von vielen als eine Drohung verstanden, das Militär könne künftig auch zur Niederschlagung von Protesten eingesetzt werden. Für Milley selbst wurde der Vorfall anscheinend zu einem kathartischen Moment: Nur wenige Tage später bezeichnete der oberste US-Soldat seine Teilnahme öffentlich als Fehler. Und auch heute, nur wenige Monate nach Trumps erneutem Amtsantritt zeigt sich, dass es seine Regierung nicht nur auf Medien und Justiz abgesehen hat, sondern auf die gesamte Bürokratie einschließlich des Militärs. So entließ Trump im März den amtierenden Generalstabschef Charles Q. Brown. Ohne offizielle Begründung und noch vor Ablauf von Browns Amtszeit war das ein beispielloser Vorgang in der Geschichte der US-Streitkräfte. Neben Brown wurden weitere hochrangige Militärs entlassen, darunter die ersten Frauen an der Spitze von Navy und Coast Guard sowie die obersten Militärjuristen von Army, Navy und Air Force.
Diese Personalentscheidungen waren keineswegs zufällig. Denn während Trumps erster Amtszeit war es ausgerechnet das Militär, das in entscheidenden Momenten stabilisierend auf die US-Demokratie gewirkt hatte und diese vor einer autokratischen Übernahme durch das Trump-Lager schützte. Wie mehrere nach der Abwahl Trumps verfasste Aufarbeitungen zeigen, widersetzten sich führende Militärs zwischen 2017 und 2020 leise, aber entschlossen bestimmten Anweisungen ihres Oberbefehlshabers: Trumps Versuch, die Black-Lives-Matter-Proteste mit militärischer Gewalt niederzuschlagen, scheiterte ebenso wie sein Bestreben, vor den Präsidentschaftswahlen 2020 einen Krieg mit Iran anzuzetteln, oder seine Absicht, die Amtsübergabe an seinen Nachfolger Joe Biden unter Einsatz des Militärs zu verhindern.[3]
Insbesondere Generalstabschef Milley spielte in den letzten Monaten von Trumps erster Amtszeit eine zentrale Rolle dabei, das Militär aus der Politik herauszuhalten, und es verwundert kaum, dass der wiedergewählte Präsident nun weitreichende Maßnahmen gegen den mittlerweile pensionierten General eingeleitet hat: Sein persönlicher Sicherheitsdienst sowie seine Sicherheitsfreigabe sind ihm bereits entzogen und Milleys Porträts im Pentagon ist entfernt worden. Zudem wird geprüft, ob ihm ein militärischer Rang aberkannt werden kann.
Das Ideal vom apolitischen Militär
Seit dem Erscheinen von „The Soldier and the State“, Samuel Huntingtons fast 70 Jahre altem Klassiker über das Verhältnis von Militär und Politik, galt vielen das Ideal eines möglichst apolitischen, professionellen Militärs als Garant demokratischer Stabilität.[4] Die Rollenverteilung zwischen ziviler Führung und militärischer Ebene schien sowohl normativ als auch realpolitisch klar: Die Politik entscheidet, das Militär führt aus. Dieser Vorstellung lag die Sorge zugrunde, das Militär als jene Institution, die im Auftrag des Staates dessen Schutz gewährleisten soll, könne seine Waffen und Kämpferinnen und Kämpfer auch einsetzen, um den Staat zu gefährden oder gar zu übernehmen. Die politisch-militärische Trennung sollte verhindern, dass sich das Militär in politische Prozesse einmischt und so zur Bedrohung für die Demokratie wird. Das Militär wiederum bekam, quasi im Gegenzug, eine gewisse Autonomie zugesprochen, um seine internen Angelegenheiten selbst zu regeln, etwa die Kriterien für eine militärische Karriere. Über Jahrzehnte funktionierte dieses Principal-agent-Modell, bei dem das Militär (agent) die Vorgaben der zivilen Ebene (principal) möglichst treu umsetzt, in den USA, in vielen westlichen Demokratien und auch in zahlreichen osteuropäischen Transformationsstaaten erstaunlich gut. Doch wie, das fragten sich bereits 2021 US-Politologinnen und Politologen, soll eine apolitische militärische Führung mit einem „unprincipled principal“[5] umgehen, mit einem politischen Führer also, der die ethischen, moralischen und normativen Spielregeln politisch-militärischer Zusammenarbeit missachtet? Einem, der das Militär für seine persönlichen politischen Zwecke einzusetzen gedenkt?
General Milley entschied sich nach dem Vorfall am Lafayette Square bewusst gegen den bedingungslosen Gehorsam. Er stellte sich zwar nicht auf die Seite der US-Demokraten, wohl aber eindeutig auf die Seite der Demokratie. Man stelle sich vor: 2020 war es ein Soldat – und nicht etwa ein ziviler Politiker –, der dem US-Kongress vorsorglich versicherte, das Militär habe bei der anstehenden Präsidentschaftswahl „keine Rolle“ inne.[6] Milley machte explizit deutlich, was das Selbstverständnis eines apolitischen Militärs sei: Es führe die lawful orders – also rechtmäßige Befehle – der zivilen Ebene aus. Eine feine, aber bedeutsame Qualifizierung des Huntingtonschen Diktums vom apolitischen Militär.
USA: Die Politisierung des Militärs hat begonnen
Seit 2025 steht für die USA zu befürchten, dass es keinen zweiten Mark Milley geben wird, der sich ungesetzlichen Befehlen widersetzt. Trumps neuer Generalstabschef, Dan Caine, verfügt nicht über die üblicherweise vorausgesetzte militärische Führungserfahrung für diesen Posten. Er ist nicht durch die höchsten Ränge des Systems „aufgewachsen“, hatte die Streitkräfte bereits verlassen und konnte daher nur per präsidentieller Sonderregelung direkt an die Militärspitze befördert werden. Dass der Präsident damit die Aufstiegsordnung der Militärhierarchie ignorierte, bedeutet nur einen weiteren Bruch mit den bisherigen demokratischen politisch-militärischen Beziehungen. Ob ein US-Militär mit Loyalistinnen und Loyalisten an den Schalthebeln der Macht auch künftig unrechtmäßige Befehle aussitzen oder verweigern wird, ist eine offene Frage – eine, die nicht nur über die Zukunft von Frauen und Schwarzen in den Streitkräften entscheiden wird, sondern auch über das politische Überleben ganzer Länder. Denn ob Panama, Grönland, Mexiko oder sogar Kanada: Die Sicherheit dieser Staaten und Staatsgebiete hängt womöglich davon ab, ob das Militär einem Präsidenten widersteht, der bereit ist, völkerrechtswidrige Interventionen anzuordnen. Der Einsatz der Nationalgarde und die Verlegung von US-Marines nach Los Angeles zur Niederschlagung von Protesten gegen die Abschiebepraxis der US-Regierung im Juni 2025 zeigen, dass die politische Instrumentalisierung des Militärs nun begonnen hat.
Autoritäre Vorbilder machen Schule, auch in Europa. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán liefert bereits seit Jahren die Blaupause dafür, wie man demokratische Institutionen formal intakt lässt, sie aber zugleich politisch entkernt. Von der Aushöhlung der Gewaltenteilung bis zur Gleichschaltung der Medien: Trumps Team hat aufmerksam zugesehen – und verfeinert das autokratische Playbook nun um ein entscheidendes Kapitel, nämlich die Neuordnung der politisch-militärischen Beziehungen.
Für die europäischen Demokratien sollten diese Entwicklungen ein dringender Anlass sein, die Demokratiefestigkeit ihrer Streitkräfte und die Qualität ihrer politisch-militärischen Beziehungen zu prüfen. Das gilt auch für Deutschland – einer Demokratie, der die Wählerinnen und Wähler im Februar 2025 gewissermaßen eine vierjährige Gnadenfrist eingeräumt haben.
Um den wachsenden Bedrohungen für die Demokratie von außen wie von innen zu begegnen, wird es nicht genügen, nur die operativen Verteidigungsfähigkeiten der Bundeswehr zu stärken. Ebenso bedarf es ihrer festen Verankerung in den demokratischen Prinzipien der Bundesrepublik. Denn nur so lässt sich verhindern, dass ein zukünftiger Autokrat oder eine zukünftige Autokratin in Deutschland das Militär instrumentalisieren kann – wie Trump es in den USA bereits versucht hat und es nun erneut versucht.
Die politisch-militärischen Beziehungen in Deutschland beruhen auf drei Säulen: der demokratischen Sozialisation des militärischen Personals, der regelbasierten, bürokratischen Struktur der Bundeswehr sowie den verfassungsrechtlich abgesicherten Kontroll- und Aufsichtsmechanismen durch die Regierung und das Parlament. Diese drei Säulen sind bisher weitgehend stabil. Aber auch sie könnten ins Wanken geraten.
Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Angehörige der Bundeswehr, also Soldatinnen und Soldaten und ziviles Personal, verfügen über eine ausgeprägtere staatsbürgerliche Orientierung und nehmen stärker an politischen Prozessen teil als die Durchschnittsbevölkerung. Dieser Effekt lässt sich sogar bei ehemaligen Bundeswehrangehörigen, etwa früheren Wehrpflichtigen, nachweisen.[7] Das unterscheidet die deutschen Streitkräfteangehörigen von den Soldatinnen und Soldaten anderer europäischer Demokratien wie etwa der Tschechischen Republik.[8] Zwar lassen sich keine kausalen Aussagen treffen, doch vieles spricht dafür, dass die regelmäßige politische Bildung, an der auch zivile Bundeswehrbeschäftigte teilnehmen, zur Demokratiefestigkeit der Streitkräfte beiträgt. Ebenso dürfte die kontinuierliche Auseinandersetzung mit politischen, demokratischen und sicherheitspolitischen Fragestellungen im Rahmen des Dienstalltags eine wichtige Rolle spielen. Mit zunehmender Führungsverantwortung nehmen Offizierinnen und Offiziere an teils internationalen Kursen mit politikwissenschaftlichen oder sicherheitspolitischen Schwerpunkten teil.
Demokratische Bildung absichern
Die Bundeswehr vermittelt ihren Soldatinnen und Soldaten kontinuierlich das Prinzip der Inneren Führung – ein nur schwer zu definierendes, aber dennoch zentrales Leitbild, das das Handeln von Streitkräfteangehörigen an Werten, Normen und Gesetzen orientiert. Es ist jenes Selbstverständnis, das sich die Bundeswehr bei ihrer Gründung bewusst gegeben hat und das eine tiefgreifende Abgrenzung von den Traditionen der Wehrmacht und der Reichswehr darstellt – jenen deutschen Armeen, die von antidemokratischen Kräften durchdrungen und instrumentalisiert wurden.
Insofern unterscheidet sich das Selbstverständnis der Bundeswehr vom apolitischen Idealbild Huntingtons, das die politisch-militärischen Beziehungen in den USA prägt. Bundeswehrangehörige sollen nicht per se apolitisch, sondern politisch informiert und gebildet sein – und in der Lage, rechtlich und ethisch richtige Entscheidungen zu treffen. Was General Milley 2020 und 2021 aus eigener moralischer Überzeugung tat, soll Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit dem Prinzip der Inneren Führung also systematisch vermittelt werden. Die Führung des Zentrums Innere Führung in Koblenz, dem Kompetenzzentrum der Bundeswehr für die politische Bildung der Streitkräfte, durch einen Zweisternegeneral unterstreicht die Wichtigkeit, die der politischen und ethischen Bildung in der Bundeswehr zukommt.
Der Einfluss auf militärische Curricula ist ein zentraler Hebel zur politischen Prägung von Soldatinnen und Soldaten. Ein Beispiel für diese Wichtigkeit liefert Polen: Die damalige nationalkonservative PiS-Regierung löste am 30. September 2016 die traditionsreiche Nationale Verteidigungsakademie (Akademia Obrony Narodowej) auf und gründete bereits am 1. Oktober die Akademie für Kriegsstudien (Akademia Sztuki Wojennej) neu. Schon der neue Name verweist auf eine veränderte inhaltliche und strategische Ausrichtung. Die polnische Opposition kritisierte, die Neugründung habe in erster Linie dem Ziel gedient, unbequeme Professorinnen und Professoren zu entlassen. Die institutionelle Neuausrichtung ermöglichte es der Regierung, dem gesamten Personal zu kündigen und lediglich ausgewählte Personen nach eigenem Ermessen wieder anzustellen.
Auch in den USA lassen sich Bestrebungen erkennen, militärische Bildung politisch zu beeinflussen: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth ließ an allen Militärakademien Kurse zu Themen wie Race oder Geschlecht streichen. Reihenweise wurden kritische Bücher aus den Militärbibliotheken entfernt.[9]
Liberale Demokratien sollten dringend überprüfen, ob ihre militärischen Bildungseinrichtungen und Bildungsinhalte tatsächlich demokratiefest sind. Als Mitte der 2010er Jahre eine Gruppe junger Offizierinnen und Offiziere in mehreren Publikationen das Prinzip der Inneren Führung infrage stellten, eine mentale Reinigung des Offizierstandes forderten, die Bundeswehr als Gegenpol zur Gesellschaft konzeptualisierten und den Staatsbürger in Uniform nur noch in der Vergangenheitsform beschrieben, schlug ihnen ein zuweilen heftiger, zuweilen auch nur milder Widerstand innerhalb und außerhalb der Bundeswehr entgegen.[10] Die Vorwürfe rechtspopulistischer Tendenzen wiesen die Autorinnen und Autoren in der Folge von sich. Damals fanden diese demokratieskeptischen Positionen keinen nachweisbaren Widerhall in der Truppe. Nicht auszudenken, welches Potenzial eine Verbreitung derartiger Haltungen in einer militärischen Organisation entfalten könnte, die unter autokratischen Druck gerät.
Wenn eine Regierung es darauf anlegt, kann sie – wie das polnische Beispiel zeigt – im Handstreich neue Strukturen schaffen und damit auch Inhalte politisch neu ausrichten. Doch ebenso zeigt dieses Beispiel, wie wichtig eine stabile, institutionell geschützte Verankerung demokratischer Bildung in der militärischen Ausbildung ist. So lässt sich verhindern oder zumindest verlangsamen, dass zentrale Prinzipien wie die politische Neutralität, die Bindung an Recht und Verfassung sowie die zivile Kontrolle der Streitkräfte zur Verfügungsmasse parteipolitischer Interessen werden.
Zivilisierende Bürokratie
Militärische Organisationen gelten als schwerfällige Apparate, geprägt von Hierarchie, Disziplin und professionellen Standards. Veränderungen verlaufen langsam – was in Zeiten demokratischen Rückschritts paradoxerweise ein Vorteil sein kann: Organisatorische Trägheit erschwert die kurzfristige Politisierung des Militärs. In etablierten Demokratien erfolgen Beförderungen zwar nicht immer, aber doch überwiegend nach fachlicher Eignung – und nicht nach politischer Loyalität.
Wenn demokratische Regierungschefs oder Verteidigungsministerinnen militärische Spitzenposten besetzen, wählen sie in der Regel aus einem Kreis von höheren Offizierinnen und Offizieren, die einerseits auf Grundlage fachlicher Kriterien aufgestiegen sind und andererseits über viele Jahre demokratisch sozialisiert wurden. Gerade die weltweit einzigartige Struktur der Bundeswehr trägt wesentlich zu ihrer demokratischen Verankerung bei: Verfassungsrechtlich ist sie nach Art. 87b des Grundgesetzes nämlich zwingend in einen militärischen und einen zivilen Teil gegliedert. Während die Streitkräfte über einsatzbezogene Fragen entscheiden, liegt die Zuständigkeit für Personal, Beschaffung und Infrastruktur bei einem zivilen Beamtenapparat. Auch Rechtspflege und Militärseelsorge sind zivil und nicht militärisch organisiert. Diese institutionelle Trennung entlastet einerseits die Streitkräfte von Verwaltungsaufgaben, andererseits schafft sie rechtliche, verfahrenstechnische und nicht zuletzt organisationskulturelle Grenzen zwischen beiden Bereichen – Grenzen, die einem politischen Alleingang der Streitkräfte entgegenwirken. Die Bürokratie wirkt hier gewissermaßen zivilisierend: Für eine politische Instrumentalisierung der Bundeswehr wäre es nicht nur erforderlich, die Streitkräfte zu vereinnahmen, sondern auch die zivile Verwaltung – und damit ein zweites, oft kritisches System.
Demokratische Aufsicht
Seit Mitte der 2010er Jahre wurde die zivil-militärische Trennung der Bundeswehr jedoch aufgeweicht. Der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière führte einen „bundeswehrgemeinsamen Ansatz“ ein, der eine stärkere Durchmischung ziviler und militärischer Bereiche vorsah. In der Folge sind heute rund zehn Prozent der eigentlich zivilen Bundeswehrverwaltung mit Soldatinnen und Soldaten besetzt – teils auch in Spitzenämtern. Angesichts der aktuellen Herausforderungen wäre es sinnvoll, das Prinzip der zivil-militärischen Trennung innerhalb der Bundeswehr wieder zu stärken. Ein funktionierender Beamtenapparat, der mit der Remonstrationspflicht Beamtinnen und Beamte – anders als Soldatinnen und Soldaten – persönlich für die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen verantwortlich macht, verfügt über andere – und teilweise wirksamere – Möglichkeiten, sich unrechtmäßigen Weisungen zu widersetzen. Eine Bundeswehr, die aus zwei vernetzten, aber institutionell klar getrennten Funktionsbereichen besteht, lässt sich deutlich schwerer politisch vereinnahmen. Dass die Bürokratie zum inneren Gerüst demokratischer Ordnung gehört, wird durch Trumps systematischen Angriff auf die US-Verwaltung besonders sichtbar.[11] Die Ernennung eines Generalstabschefs, der nicht durch das militärische System in den Kandidatenpool gelangt ist, zeigt, dass ein derartiger Angriff auch vor dem Militär nicht halt macht. Die Stärkung des Bundeswehr-Trennungsgebots hätte auch ganz praktische Vorteile, wie unlängst die Vorsitzende des Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr, Imke von Bornstaedt-Küpper, ausführte: Weniger militärisches Personal würde in der Verwaltung gebunden und stünde stattdessen für operative Aufgaben zur Verfügung.[12] Das strukturelle Rekrutierungsproblem der Bundeswehr ließe sich dadurch zwar nicht lösen, wohl aber abmildern.
Die dritte Säule stabiler politisch-militärischer Beziehungen ist das, was Expertinnen und Experten unter ziviler Kontrolle und demokratischer Aufsicht über das Militär verstehen. Dabei geht es einerseits um die Kontrollmöglichkeiten der Regierung gegenüber den Streitkräften, andererseits aber auch um die Aufsichtsrechte des Parlaments in Bezug auf militärische Einsätze und Organisation.
In Deutschland ist die zivile Kontrolle des Militärs verfassungsrechtlich fest verankert. Das Grundgesetz sieht ausdrücklich die Existenz eines Bundesministers bzw. einer Bundesministerin der Verteidigung vor – ein Amt, das zwingend von einer zivilen Person bekleidet werden muss. Doch zivile Kontrolle allein schützt nicht automatisch vor einem Missbrauch des Militärs. Im Gegenteil: Gerade autoritäre Regime verfügen häufig über eine sehr effektive Kontrolle über ihre Streitkräfte – allerdings im Sinne der Machtkonsolidierung, nicht im Sinne demokratischer Legitimation. Gerade deshalb kommt es darauf an, wie widerstandsfähig die zivile Kontrolle selbst gegenüber politischem Missbrauch ausgestaltet ist. So legt das Grundgesetz fest, dass die Streitkräfte ausschließlich zur Verteidigung sowie in ausdrücklich benannten Ausnahmefällen eingesetzt werden dürfen. Es existiert damit faktisch eine Positivliste zulässiger Einsatzszenarien. Ein Einsatz der Bundeswehr etwa gegen Protestierende wäre klar verfassungswidrig.
Auch die Rolle der Legislative ist von zentraler Bedeutung für die demokratische Stabilität zivil-militärischer Beziehungen. Der Bundestag verfügt im internationalen Vergleich über besonders weitreichende Mitwirkungs- und Aufsichtsrechte in Verteidigungsfragen. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz sowie die Regelungen der Notstandsverfassung garantieren dem Parlament eine aktive Rolle sowohl beim äußeren als auch beim inneren Einsatz der Streitkräfte. Darüber hinaus sichern weitere institutionelle Mechanismen die demokratische Aufsicht: das Amt des oder der Wehrbeauftragten als parlamentarisches Kontrollorgan, das Haushaltsrecht, das dem Bundestag Einfluss auf Struktur und Ausstattung der Bundeswehr ermöglicht, der Verteidigungsausschuss als ständiger Fachausschuss sowie das umfassende Fragerecht der Abgeordneten. Zusammengenommen bilden diese Instrumente ein bisher funktionierendes Fundament demokratischer Aufsicht über die Streitkräfte. Ein derart austariertes Regelwerk wirkt präventiv gegen die politische Instrumentalisierung der Armee. Zwar hat Trump gezeigt, dass er bereit ist, sich über das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hinwegzusetzen – etwa indem er Gerichtsbeschlüsse zur Ausweisung von Migrantinnen und Migranten ignorierte. Doch eine explizite, umfassende und demokratisch legitimierte Wehrverfassung erschwert zumindest die lautlose Aneignung der Streitkräfte durch einen autokratischen Regierungschef oder eine autokratische Regierungschefin erheblich.
Folgt aus der Analyse, dass widerstandsfähige politisch-militärische Beziehungen ausreichen, um die Demokratie zu schützen? Nein. Funktionierende zivil-militärische Beziehungen sind zweifellos eine notwendige Bedingung für demokratische Stabilität – sie verhindern die Instrumentalisierung der Streitkräfte und sichern die Gewaltenteilung im sicherheitspolitischen Bereich. Doch sie sind nicht hinreichend, denn Demokratie braucht mehr als eine demokratisch gebildete Parlamentsarmee. Demokratie benötigt eine unabhängige Justiz, eine funktionierende Legislative, freie und pluralistische Medien – und vor allem eine aktive, widerstandsfähige Zivilgesellschaft. Erst im Zusammenspiel dieser Elemente entsteht ein demokratisches Schutzsystem, das auch unter Druck Bestand hat. Ein Blick auf die USA unter Trump zeigt zudem: Politisch-militärische Beziehungen können selbst dann beschädigt werden, wenn sie zunächst standhalten. Gelang im ersten Versuch die antidemokratische Vereinnahmung der US-Streitkräfte nicht, so sind wir derzeit Zeuginnen und Zeugen ihrer Politisierung. Stabile politisch-militärische Beziehungen können demokratische Erosionsprozesse verzögern. Aufhalten werden sie sie nicht.
Das Militär als Retter der Demokratie?
Demokratien sollten sich nicht auf das Militär als Retter in der Not verlassen, denn den Streitkräften fehlt es nicht nur an der Kompetenz für politische Eingriffe –, sondern vor allem fehlt ihnen die demokratische Legitimität dazu. Wer darauf baut, dass das Militär einen autokratischen Führer oder eine Führerin absetzt, verkennt die Rolle der Streitkräfte in einer Demokratie – und riskiert, den demokratischen Verfall weiter zu beschleunigen.
Demokratien können jedoch die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die Streitkräfte dauerhaft demokratischen Normen verpflichtet bleiben. Das bedeutet konkret: die demokratische Bildung in den Streitkräften stärken, indem diese strukturell und finanziell gesichert wird und sich inhaltlich auch mit dem Phänomen demokratischer Erosion beschäftigt. Zudem sollten die militärischen Strukturen (und in Deutschland die zivilen der Bundeswehr) vor unrechtmäßigen politischen Eingriffen geschützt werden. Ein wichtiges Instrument dafür ist eine umfassendere Korruptionsprävention. Darüber hinaus könnte eine aktive Wertschätzung des Beamtenapparats sinnvoll sein, die sich darin ausdrückt, verlorene Zuständigkeiten aus dem militärischen Bereich zurückzuführen und den Anteil an Beamtenstellen zu erhöhen.
Ein weiteres Mittel demokratischer Sicherung besteht darin, die zivile Kontrolle der Streitkräfte wirksam, aber resistent gegen politischen Missbrauch zu gestalten. Ist etwa die Formulierung des Art. 35 (3) Grundgesetz, wonach bei einer Gefährdung durch einen Unglücksfall die Bundesregierung auch die Streitkräfte zur Unterstützung von Polizeikräften einsetzen kann, so gewählt, dass sie nicht als Einfallstor für den Einsatz der Streitkräfte im Innern missbraucht werden kann? Sind parlamentarische Aufsichtsinstitutionen wie etwa das Amt des oder der Wehrbeauftragten genügend vor einer finanziellen Mittelverknappung geschützt? Auch wenn die politisch-militärischen Beziehungen in Deutschland derzeit stabil und demokratisch verankert erscheinen, zeigt der Blick auf die USA, wie schnell sich etablierte Strukturen verschieben können. Vor diesem Hintergrund sollten bestehende Regelungen auf ihre Demokratiefestigkeit hin überprüft werden – insbesondere dort, wo ein demokratischer Rückbau ansetzen könnte.
Da sich die Demokratie nicht nur von außen, sondern zukünftig womöglich auch von innen autokratischen Tendenzen ausgesetzt sieht, braucht es nicht nur ein „kriegstüchtiges“ Militär, das die Demokratie vor äußeren Angriffen sichert. Es braucht auch Streitkräfte, die vor autoritärem Missbrauch geschützt sind; es braucht demokratietüchtige Streitkräfte.
[1] Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung der Autorin wieder.
[2] Thomas Carothers und Benjamin Press, Understanding and Responding to Global Democratic Backsliding, carnegieendowment.org, 20.10.2022.
[3] Peter Baker und Susan Glasser, The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, New York 2022; Carol Leonnig und Philip Rucker, I Alone Can Fix It: Donald J. Trump’s Catastrophic Final Year, New York 2021; Bob Woodward und Robert Costa, Peril, New York 2021.
[4] Samuel P. Huntington, The Soldier and the State; the Theory and Politics of Civil-Military Relations, Cambridge 1957.
[5] Pauline Shanks Kaurin, An „Unprincipled Principal“. Implications for Civil-Military Relations, in: „Strategic Studies Quarterly“, 2/2021, S. 50-68.
[6] Christianna Silva, Gen. Mark Milley Says The Military Plays ‚No Role‘ in Elections, npr.org, 11.10.2020.
[7] Markus Steinbrecher, Die Schule der Nation für den Staatsbürger in Uniform?, in: Markus Steinbrecher, Evelyn Bytzek und Ulrich Rosar (Hg.), Identität – Identifikation – Ideologie. Analysen zu politischen Einstellungen und politischem Verhalten in Deutschland, Wiesbaden 2019, S. 1-55.
[8] Pavol Frič und Bohuslav Pernica, Civil-Military Relations in the Season of Military Populism: Czechia, in: „Armed Forces & Society“, 3/2024, S. 710-738.
[9] Graham Parsons, West Point Is Supposed to Educate, Not Indoctrinate, in: „The New York Times“, 8.5.2025.
[10] Klaus Naumann, Sehnsucht nach dem Kämpfer-Typ, in: „Frankfurter Rundschau“, 8.1.2019.
[11] Jonathan Rauch, Mafiaboss im Weißen Haus, in: „Blätter“, 5/2025, S. 91-98.
[12] Vgl. XVII. Bundesvertretertag des Verbandes der Beamten und Beschäftigten der Bundeswehr. Wahl der Bundesvorsitzenden Imke von Bornstaedt-Küpper, presseportal.de, 29.11.2024.