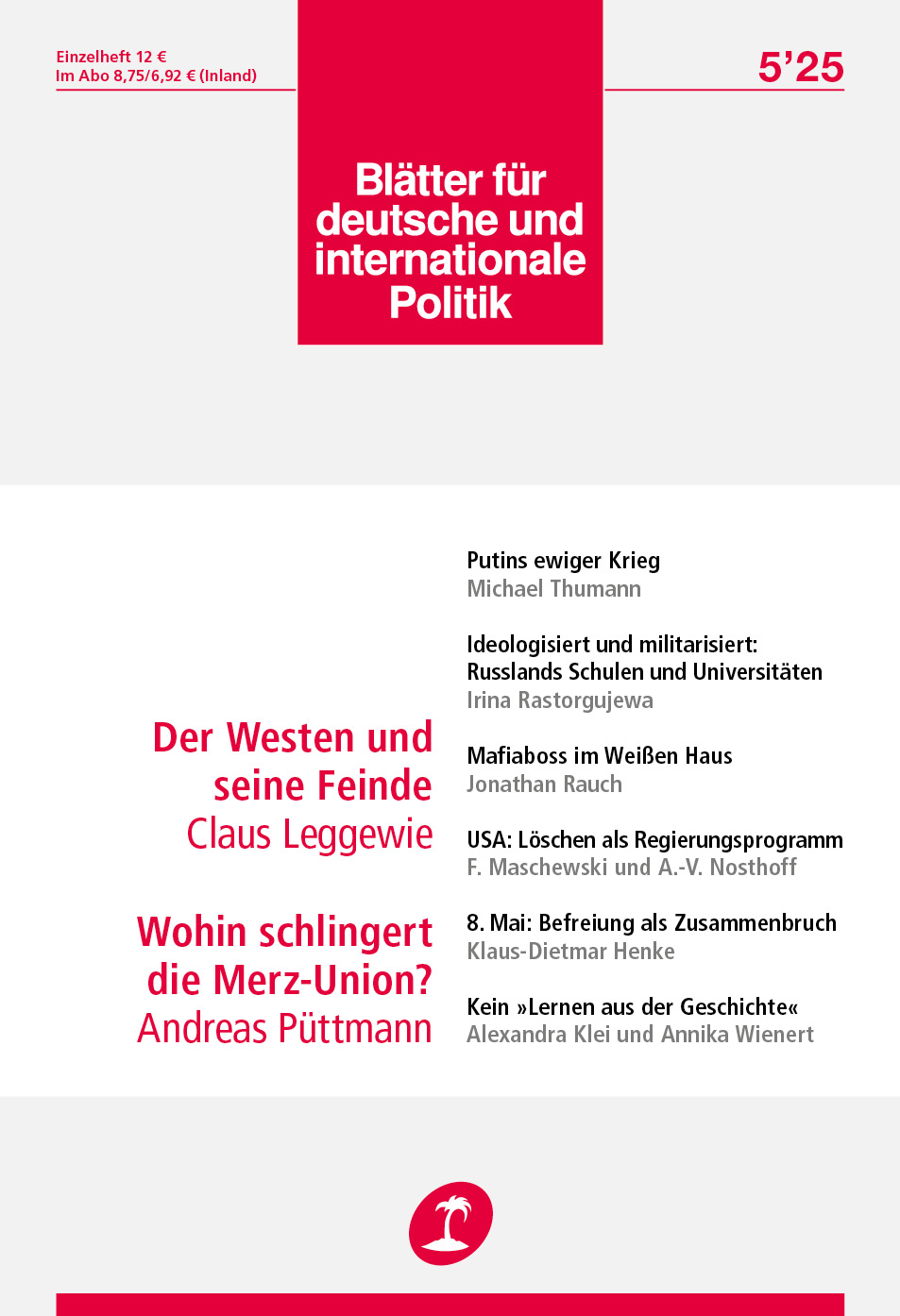Die patrimoniale Herrschaft des Donald Trump
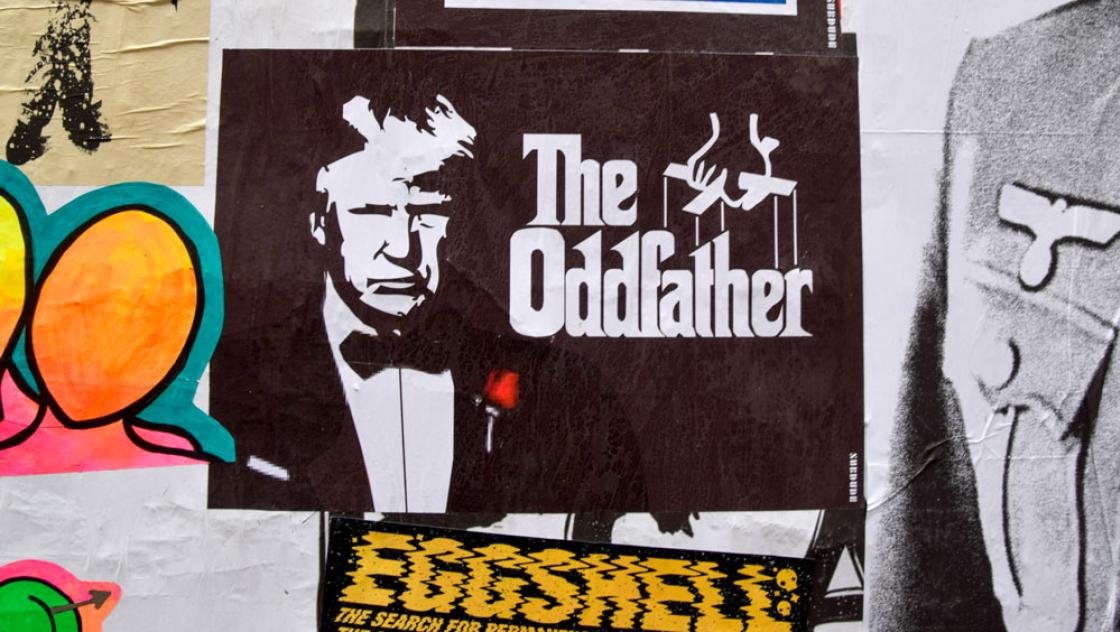
Bild: Donald Trump als »The Godfather«, London, 17.3.2025 (IMAGO / ZUMA Press Wire / Vuk Valcic)
Was genau macht Donald Trump gerade? Er hat die Effektivität seiner Regierung geschwächt, indem er an die Spitze wichtiger Behörden Personen gesetzt hat, die weder über die Fähigkeiten noch über den Charakter verfügen, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Massenentlassungen durch die Trump-Regierung haben den öffentlichen Dienst vieler seiner fähigsten Mitarbeiter beraubt. Er hat Gesetze missachtet, die er genauso gut hätte befolgen können. Er hat klare Aussagen in Gesetzen, Gerichtsurteilen und der Verfassung1 missachtet und damit Auseinandersetzungen mit Gerichten provoziert, die er wahrscheinlich verlieren wird. Nur wenige seiner Anordnungen haben einen Politikentwicklungsprozess durchlaufen, der dabei helfen würde, dass sie nicht scheitern oder nach hinten losgehen – was garantiert, dass genau das passieren wird.2 Außenpolitisch hat er Dänemark, Kanada und Panama gegen sich aufgebracht, den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umbenannt und einen Gaz-a-Lago-Plan vorgestellt. Obendrein hat er sich selbst zum Vorsitzenden des John F. Kennedy Centers für die darstellenden Künste ernannt, als ob er nicht genug zu tun hätte. Selbst diejenigen, die nach seiner Wiederwahl mit dem Schlimmsten gerechnet haben (ich zähle zu ihnen), hatten mehr Rationalität erwartet. Heute ist offensichtlich: Was seit dem 20. Januar geschehen ist, stellt nicht nur einen Regierungswechsel dar, sondern einen Regimewechsel, also eine Änderung unseres Regierungssystems. Aber einen Wechsel wohin genau?
Es gibt darauf eine Antwort und die lautet nicht: klassischer Autoritarismus – auch nicht Autokratie, Oligarchie oder Monarchie. Trump ist dabei, das zu etablieren, was Sozialwissenschaftler Patrimonialismus nennen. Es ist unerlässlich, diesen zu verstehen, wenn man ihn besiegen will. Insbesondere hat der Patrimonialismus eine fatale Schwäche, die die Demokraten und andere Gegner Trumps unablässig zu ihrer primären Angriffslinie machen sollten.
Im vergangenen Jahr haben zwei Professoren ein Buch veröffentlicht, das große Aufmerksamkeit verdient. In ihrem Buch „Der Anschlag auf den Staat: Wie der globale Angriff auf die moderne Regierung unsere Zukunft gefährdet“3, lassen Stephen E. Hanson, Professor für Regierungslehre am College of William & Mary, und Jeffrey S. Kopstein, Politikwissenschaftler an der University of California Irvine, einen nahezu vergessenen Begriff wieder aufleben. Er geht auf Max Weber zurück, den deutschen Soziologen, der vor allem wegen seines bedeutenden Buchs „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ bekannt ist.
Weber fragte sich, woher die Führer von Staaten ihre Legitimität beziehen, also den Anspruch, rechtmäßig zu regieren. Er dachte, es gäbe im Kern zwei Möglichkeiten. Die eine ist die rational-legale Bürokratie (oder der „bürokratische Prozeduralismus“), ein System, in dem Legitimität durch Institutionen verliehen wird, die bestimmten Regeln und Normen folgen. Das ist genau das System, das wir in den USA bis zum 20. Januar für selbstverständlich hielten. Präsidenten, Bundesbedienstete und Rekruten schwören einen Eid auf die Verfassung, nicht auf eine Person.
Die Auferstehung vom Müllhaufen der Geschichte
Die andere Quelle von Legitimität ist älter, weiter verbreitet und intuitiver – es ist „die selbstverständliche Herrschaftsform in der vormodernen Welt“, schreiben Hanson und Kopstein. „Der Staat war wenig mehr als der erweiterte ‚Haushalt‘ des Herrschers; er existierte nicht als eine separate Einheit.“ Weber nannte dieses System „patrimonial“, weil die Herrscher beanspruchten, der symbolische Vater des Volkes zu sein – die Verkörperung des Staates und sein Beschützer. Genau dies steckte implizit in Trumps erschreckender Aussage: „Wer sein Land rettet, verletzt kein Gesetz.“4
Zu seiner Zeit dachte Weber, dass der Patrimonialismus auf dem Weg zum Müllhaufen der Geschichte sei. Dieser personalisierte Herrschaftsstil sei zu laien- und launenhaft, um die komplexen Wirtschafts- und Militärsysteme zu leiten, die nach Bismarck zu Kennzeichen moderner Staatlichkeit wurden. Unglücklicherweise lag er damit falsch. Patrimonialismus ist weniger eine Regierungsform als ein Regierungsstil. Er ist nicht durch Institutionen oder Regeln definiert; eher ist es so, dass er alle Regierungsformen dadurch infizieren kann, dass er unpersönliche, formale Autoritätsbeziehungen durch personalisierte, informelle ersetzt. Er basiert auf individuellen Loyalitäten und Verbindungen sowie darauf, dass Freunde belohnt und Feinde bestraft werden. Er findet sich nicht nur in Staaten, sondern auch bei Stämmen, Straßengangs und kriminellen Organisationen. In seiner Regierungsgestalt zeichnet sich der Patrimonialismus dadurch aus, dass der Staat so geführt wird, als sei er das persönliche Eigentum des Führers oder ein familiengeführtes Unternehmen. Er findet sich in vielen Ländern, aber sein wichtigster Vertreter in der Gegenwart war Wladimir Putin – bis zum 20. Januar 2025. In der Anfangszeit seiner Herrschaft führte er den russischen Staat als seine persönliche Gang. Die staatliche Bürokratie und private Unternehmen funktionierten weiterhin, aber das tatsächliche Prinzip der Regierung war: Stell Dich mit Wladimir Wladimirowitsch gut …, sonst gibt’s was.
Im Bestreben, die Welt für das Gangstertum sicher zu machen, nutzte Putin Propaganda, Unterwanderung und andere Einflussmöglichkeiten, um das Modell im Ausland zu verbreiten. Im Laufe der Zeit etablierte sich das patrimoniale System in so unterschiedlichen Staaten wie Ungarn, der Türkei und Indien. Nach und nach haben diese Staaten begonnen, in so etwas wie einem Verband von kriminellen Familien zusammenzuarbeiten – „um Probleme zu lösen“, schreiben Hanson und Kopstein in ihrem Buch, „um die Beute aufzuteilen, manchmal streitend, aber einander helfend, wenn nötig. Bei diesem Projekt nahm Putin die Position des capo di tutti capi ein, des Bosses der Bosse.“ Bis jetzt. Mach Platz, Präsident Putin!
Die Bürokratie als Feind
Der Gegenpol von Patrimonialismus ist nicht Demokratie, sondern Bürokratie beziehungsweise, präziser formuliert, bürokratischer Prozeduralismus. Der klassische Autoritarismus – die Art System, die es in Nazideutschland und der Sowjetunion gab –, ist oft stark bürokratisiert. Wenn Autoritäre die Macht übernehmen, festigen sie ihre Herrschaft durch den Aufbau von Strukturen wie einer Geheimpolizei, Propagandabehörden, militärischen Sondereinheiten und Politbüros. Sie legitimieren ihre Herrschaft durch Rechtsvorschriften und Verfassungen. Orwell verstand den bürokratischen Aspekt des klassischen Autoritarismus. In „1984“ sind Ozeaniens Ministerien für Wahrheit (Propaganda), Frieden (Krieg) und Liebe (Staatssicherheit) die charakteristischsten (und beängstigendsten) Merkmale des Regimes.
Patrimonialismus misstraut dagegen den Bürokratien, schließlich stellt sich die Frage, gegenüber wem sie wirklich loyal sind. Sie könnten eigene Macht erlangen und ihre Regeln und Verfahren könnten sich als hinderlich erweisen. Personen mit Expertise, Erfahrung und ausgezeichneten Lebensläufen sind ebenfalls verdächtig, weil sie über unabhängiges Ansehen und unabhängige Autorität verfügen. Also füllt der Patrimonialismus die Regierung mit bedeutungslosen Niemanden und Mitläufern oder er umgeht, wenn möglich, bürokratische Prozesse völlig. Als Sicherheitsbeauftragte von USAID versuchten, geheime Daten vor Elon Musks nicht sicherheitsüberprüftem DOGE-Team zu schützen, wurden sie einfach beurlaubt. Die Aversion gegenüber formalen Verfahren macht das patrimoniale Regieren launenhaft und sogar skurril – beispielsweise, wenn der Führer ohne jede Vorwarnung die Umbenennung internationaler Gewässer oder die US-amerikanische Besetzung des Gazastreifens verkündet.
Ebenfalls im Gegensatz zum klassischen Autoritarismus kann Patrimonialismus mit Demokratie koexistieren, jedenfalls für eine Weile. Hanson und Kopstein schreiben dazu: „Ein Führer kann demokratisch gewählt sein und dennoch versuchen, seine oder ihre Herrschaft patrimonial zu legitimieren. Immer versuchen gewählte Führer, bürokratische Verwaltungsapparate (‚deep states‘, wie sie sie manchmal nennen), die über Jahrzehnte aufgebaut wurden, zugunsten einer Herrschaft durch ihre Familie und Freunde zu zerstören.“ Narenda Modi in Indien, Viktor Orbán in Ungarn und Trump selbst sind Beispiele gewählter patrimonialer Führer. Einmal an der Macht, lieben es Patrimonialisten, sich rhetorisch zu Demokraten aufzuschwingen, so wie beispielsweise Elon Musk die außergesetzlichen Aktivitäten seines Teams damit legitimiert, dass so die „nicht gewählte vierte Regierungsgewalt“ dazu gebracht wird, „auf das Volk einzugehen“.5
Patrimonialismus: Wie auf Trump zugeschnitten
Nichtsdestotrotz schwächt der Patrimonialismus den Staat und verkrüppelt ihn schließlich, weil er die prozeduralen Sehnen der Regierung zerschneidet. Im Laufe der Zeit, in der er sich zu etablieren sucht, streben viele Führer den Übergang zu einem vollständigen Autoritarismus an. „Wahlprozesse und Verfassungsnormen können nicht lange überleben, wenn die patrimoniale Legitimität beginnt, die politische Bühne zu dominieren“, schreiben Hanson und Kopstein. Selbst wenn Autoritarismus verhindert werden kann, ist der Schaden riesig, den der Patrimonialismus der staatlichen Handlungsfähigkeit zufügt. Die besten Leute der Regierung verlassen sie oder werden verjagt. Die Zielsetzungen von Behörden werden verzerrt und ihre Praktiken korrumpiert. Verfahren und Normen werden aufgegeben und vergessen. Öffentliche Bedienstete, Vertragspartner, Empfänger von Fördermitteln, Unternehmen und die Öffentlichkeit werden durch die Gewohnheit, sich Gefallen zu erkaufen, korrumpiert.
Zu sagen, dass Trump das Naturell oder die Aufmerksamkeitsspanne fehlt, um ein Diktator zu sein, beruhigt nur wenig. Er ist für den Patrimonialismus perfekt geeignet. Er kennt keinen Unterschied zwischen Öffentlichem und Privatem, Legalem und Illegalem, Formellem und Informellem, Nationalem und Persönlichem. „Er kann den Unterschied zwischen seinen eigenen persönlichen Interessen und dem nationalen Interesse nicht erfassen, falls er überhaupt versteht, was das nationale Interesse ist“, sagte John Bolton, der Trump während seiner ersten Amtszeit als Nationaler Sicherheitsberater diente, der Nachrichten- und Meinungswebsite „The Bulwark“.6 Ein prominenter republikanischer Politiker sagte kürzlich zu mir, dass es einfach sei, Trump zu verstehen: „Wenn du sein Freund bist, ist er dein Freund. Wenn du nicht sein Freund bist, ist er nicht dein Freund.“ Dieser Amtsträger hat sich entschieden, Trumps Freund zu sein. Ansonsten wäre es für ihn fast unmöglich, während der nächsten vier Jahre seine Aufgabe zu erfüllen, sagte er. Patrimonialismus erklärt, was ansonsten verwirrend sein könnte. Jede politische Maßnahme, die dem Präsidenten wichtig ist, behandelt er wie sein persönliches Eigentum. Trump ließ auf Bundesebene die strafrechtliche Verfolgung des New Yorker Bürgermeisters Eric Adams fallen, weil ein fügsamer Bürgermeister einer großen Stadt für ihn nützlich ist. Er behandelt das Justizministerium wie „seine persönliche Anwaltspraxis“.7 Er betrachtet die Anwendung von ordnungsgemäß verabschiedeten Gesetzen als optional – und behauptet darüber hinaus, er sei befugt, Gesetzesbrecher vor Strafen zu schützen.8 Er hat die Verfahren gegen die Schläger und Aufständischen des Sturms auf das Kapitol vom 6. Januar gestoppt, weil sie auf seiner Seite sind. Seine Behörden überprüfen Einzustellende bezüglich ihrer Loyalität zu ihm und nicht zur Verfassung.
Persönliche Loyalität statt Verfassungstreue
In Trumps Welt werden Bundesbehörden auf seine Anweisung hin geschlossen, ohne dass der Kongress überhaupt informiert würde. Seine Handlanger platzen ohne gesetzliche Grundlage in Behörden herein und übernehmen sie. Ein loyaler Trumpist, der zuvor gerade einmal zwei kleine Nonprofit-Organisationen9 geleitet hat, erhält die schwierigste Leitungsaufgabe in der Regierung. Staatsanwälte und Aufsichtsbeamte werden entlassen, weil sie ihre Arbeit gemacht haben. Tausende öffentliche Bedienstete werden neu eingruppiert10, sodass sie jederzeit und ohne Grund vom Präsidenten entlassen werden können. Der Personenschutz für ehemalige Amtsträger wird entzogen, weil sie nicht loyal sind. Die Präsidentschaft selbst wird als Gelegenheit betrachtet, Geschäfte11 zu machen.
Doch als Max Weber Patrimonialismus im Zeitalter des modernen Staates für obsolet hielt, träumte er keineswegs vor sich hin. Hanson und Kopstein schreiben dazu, dass „patrimoniale Regime weder militärisch noch ökonomisch gegen Staaten bestehen konnten, die von mit Experten bestückten Bürokratien geführt wurden“. Das gilt noch immer. Patrimonialismus leidet an zwei inhärenten und in vielen Fällen fatalen Schwächen. Die erste ist Unfähigkeit. „Die willkürlichen Launen des Herrschers und seiner Clique stören ständig die normale Funktionsfähigkeit der staatlichen Behörden“, stellen Hanson und Kopstein fest. Patrimoniale Regime sind „schlicht schrecklich darin, jedwedes komplexe Problem modernen Regierens zu regeln“, schreiben sie. „Bestenfalls sorgen sie für schlecht funktionierende Institutionen und schlimmstenfalls beuten sie aktiv die Wirtschaft aus.“ Schon jetzt scheint die Trump-Regierung entschlossen, so viele Bereiche der Regierung wie möglich zu schwächen. Über einige von den Medien berichtete Beispiele der Unfähigkeit, wie die Entlassung von Angestellten, die Nuklearwaffen sichern und die Vogelgrippe bekämpfen, könnte man lachen, wenn sie nicht so beunruhigend wären.
Patrimonialismus ist per se korrupt
Die Unfähigkeit wird für die Wähler schlussendlich offensichtlich werden, ohne dass die Opposition groß nachhelfen muss. Aber es bedarf unablässiger Kommunikation, damit die Öffentlichkeit die andere, möglicherweise noch größere Schwäche des Patrimonialismus – die Korruption – erkennt. Patrimonialismus ist per definitionem korrupt, weil sein Existenzgrund darin besteht, den Staat gewinnbringend auszubeuten – politisch, persönlich und finanziell. Er liegt ständig im Krieg mit den Regeln und Institutionen, die ihn daran hindern, den Staat zu manipulieren, auszurauben und auszuhöhlen. Wir wissen, was wir von Trumps zweiter Amtszeit erwarten können. Wie Larry Diamond von der Hoover Institution an der Stanford Universität kürzlich in einem Podcast sagte: „Ich denke, wir werden in den nächsten vier Jahren eine absolut erschütternde Orgie der Korruption und der Vetternwirtschaft erleben, etwas, was wir seit dem ‚Gilded Age‘ am Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr gesehen haben.“ (Francis Fukuyama, ebenfalls an der Stanford Universität, antwortete: „Es wird viel schlimmer als im ‚Gilded Age‘“).12
Sie lagen nicht falsch. „In den ersten drei Wochen seiner Amtszeit“, berichtete die Associated Press, „hat Präsident Donald Trump mit schamloser Eile die Schutzmechanismen für die öffentliche Integrität der Bundesregierung abgebaut, die er während seiner ersten Amtszeit häufig herausgefordert hat, zu deren vollständiger Beseitigung er jetzt aber entschlossen scheint“.13 Die Geschwindigkeit war enorm. Im Laufe nur weniger Tage im Februar hat die Trump-Regierung beispielsweise die Durchsetzung von Gesetzen gegen ausländischen Einfluss beendet, was gemäß dem ehemaligen Anwalt des Weißen Hauses, Bob Bauer, die „juristischen Risiken von Unternehmen wie der Trump Organization vermindert, die auf Regierungsbeamte einwirken, um günstige Bedingungen für Geschäftsinteressen zu erreichen, die sie mit ausländischen Regierungen und Partnern und Kontrahenten teilen“.
Beendet wurde auch die Durchsetzung des Foreign Corrupt Practices Act, was laut Bauer „die juristischen Risiken und Probleme bezüglich der Beziehungen der Trump Organization mit Amtsträgern im In- und Ausland“ weiter mindert.14 Ohne Angabe von Gründen wurde der Leiter des Regierungsbüros für ethische Fragen entlassen, einer angeblich unabhängigen Behörde, die die Antikorruptionsregeln und finanziellen Offenlegungspflichten der Exekutive überwacht. Ebenfalls ohne Angabe von Gründen wurde der interne Kontrolleur der Agentur für Entwicklungszusammenarbeit USAID gefeuert, nachdem er berichtet hatte, dass die interne Kontrolle durch die Ausgabenstopps und den Personalabbau „nahezu außer Betrieb“ sei.15 Zu diesem Zeitpunkt hatte Trump bereits die Regeln für Interessenkonflikte völlig ausgehöhlt und damit laut Bauer „reichlich Raum für ausländische Regierungen, wie der saudi-arabischen und jener der Vereinigten Arabischen Emirate, geschaffen, um im Rahmen existierender Vereinbarungen direkt mit der Trump Organization oder mit einem ihrer Tochterunternehmen zusammenzuarbeiten, was für deren Geschäftsinteressen höchst gewinnbringend ist“. Man könnte weitere Punkte nennen – und Trump wird weitermachen.
Die Chance der Demokraten: Der Kampf gegen Korruption
Korruption ist die Achillesferse des Patrimonialismus, weil die Öffentlichkeit Korruption versteht und ablehnt. Sie ist nicht abstrakt wie „Demokratie“ oder „die Verfassung“ oder „Rechtsstaatlichkeit“. Sie vermittelt, dass die Regierung für sie und nicht für dich arbeitet. Die allerschrecklichste Bedrohung, der Putin je ausgesetzt war, war Alexej Nawalnys „endloser Kreuzzug“16 gegen Korruption. Dieser hätte das Regime stürzen können, wenn Putin nicht Nawalnys Tod im Gefängnis arrangiert hätte. In Polen hat die liberale Opposition 2023 die patrimoniale Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) mit einer Antikorruptionsbotschaft17 entmachtet.
Wer sich in den Vereinigten Staaten davon überzeugen will, wie mächtig eine Antikorruptionsbotschaft ist, muss nur auf die republikanischen Angriffe auf Jim Wright und Hillary Clinton schauen. Im Fall von Clinton haben die Republikaner und Trump einen minimalen Verstoß gegen Verfahrensregeln (die Nutzung eines privaten Servers für Emails mit Geheimhaltungsstatus) zu einem Weltklasseskandal aufgebauscht. Trump und seine Verbündeten haben sie ständig als korrupteste Kandidatin aller Zeiten beschimpft. Bloße Wiederholung hat viele Wähler davon überzeugt, dass etwas dran sein musste.
Noch mehr auf den Punkt bringt es Newt Gingrichs erfolgreiche Kampagne, den demokratischen Sprecher des Repräsentantenhauses Jim Wright zu Fall zu bringen – eine Kampagne, die Wrights Karriere beendete und den Weg für die republikanische Mehrheit im US-Repräsentantenhaus im Jahr 1994 freimachte. In den späten 1980er Jahren war Wright ein Gigant des Kongresses und Gingrich ein exzentrischer Hinterbänkler. Aber Gingrich hatte einen Plan. „Ich werde einfach ständig [Wrights] Moral anprangern“, sagte er 1987. „Irgendwann wird das laufen und die Medien werden es aufgreifen, oder es erledigt sich.“ Gingrich nutzte die Ethikbeschwerdeverfahren des Kongresses und unaufhörliche öffentliche Kommunikation (nicht notwendigerweise faktenbasiert), um Wright, und implizit die Demokraten, als korrupt zu brandmarken. „In nahezu jeder Rede und jedem Interview attackierte er Wright“, schrieb John M. Barry in „Politico“. „Er forderte sein Publikum auf, Leserbriefe an ihre lokalen Zeitungen zu schreiben, bei Talkshows anzurufen und von ihren lokalen Kongressabgeordneten bei öffentlichen Veranstaltungen Antworten zu verlangen. Auf seinen Reisen sprach er lokale politische und investigative Reporter an und drängte sie, sich mit Wright zu beschäftigen. Und Gingrich wiederholte regelmäßig: ‚Jim Wright ist der korrupteste Sprecher des Repräsentantenhauses im 20. Jahrhundert.“18 Heute bietet Gingrichs Kampagne den Demokraten ein Drehbuch. Wenn sie Trumps Beliebtheit untergraben wollen, empfiehlt es sich nach diesem Modell, dass sie eine unnachgiebige, strategische und thematische Kampagne betreiben sollten, um Trump als Amerikas korruptesten Präsidenten zu brandmarken. Fast jede Entwicklung könnte Angriffen Nahrung geben, die Korruption mit Alltagsthemen in Verbindung bringen, nicht mit Allgemeinheiten wie der Rechtsstaatlichkeit. Höhere Preise? Vetternwirtschaft! Kürzungen bei beliebten Programmen? Belohnungen für Trumps Bonzenfreunde! Steuersenkungen? Ein gieriger Angriff auf die gesetzliche Rentenversicherung!19 Das beste Argument gegen diesen Ansatz (inzwischen vielleicht das einzige) ist, dass der Korruptionsvorwurf Trump nichts anhaben kann. Schließlich hat die Öffentlichkeit seit Jahren von seiner Korruption Kenntnis und hat sie entweder eingepreist oder sie kümmert sie nicht. Obendrein denkt die Öffentlichkeit ohnehin, alle Politiker seien korrupt. Aber tatsächlich hat die Opposition bislang keine strategische, koordinierte Botschaft gegen Trumps Korruption vorangetrieben. Stattdessen hat sie immer nur auf die tägliche Berichterstattung reagiert. Indem sie immer nur auf die täglichen Feueralarmübungen reagiert und sich im Kreis dreht, hat die Opposition es versäumt, überhaupt irgendeine Botschaft voranzutreiben. Zudem entspricht es nicht völlig den Tatsachen, dass die Öffentlichkeit bereits weiß, dass Trump korrupt ist und es ihr egal ist. Eher ist es so, dass er wegen seiner scheinbaren Unverblümtheit davon profitiert, dass er authentischer als andere Politiker wahrgenommen wird. Und weil er die Eliten zum Wahnsinn treibt, erfreut er sich des Rufs, auf der Seite der einfachen Menschen zu stehen. Ob es gelingt, diese Wahrnehmungen zu brechen, kann darüber entscheiden, ob seine Beliebtheitswerte über 50 Prozent oder unter 40 Prozent liegen. Politisch gesprochen, ist das ein Unterschied ums Ganze.
Brauchen die Demokraten eine eigene positive Botschaft? Sicherlich sollten sie daran arbeiten. Aber jetzt gerade, da sie nicht an der Macht sind und Trump der capo di tutti capi ist, deutet die Geschichte patrimonialer Herrschaft darauf hin, dass der effektivste Ansatz für sie ist, immer und immer wieder auf die Botschaft zu setzen, dass er korrupt ist. Eines ist sicher: Er wird ihnen reichlich Anlässe dafür geben.
Deutsche Erstveröffentlichung eines Artikels, der unter dem Titel „One Word Describes Trump“ am 24. Februar in „The Atlantic“ erschienen ist. Übersetzung: Thomas Greven.
1 Rachel Reed, Can birthright citizenship be changed?, harvard.edu, 24.1.2025.
2 Elaine Kamarck, How DOGE cutbacks could create a major backlash, brookings.edu, 14.2.2025.
3 Stephen E. Hanson und Jeffrey S. Kopstein, The Assault on the State: How the Global Attack on Modern Government Endangers Our Future, Hoboken, New Jersey, 2024.
4 Maggie Haberman, Charlie Savage und Jonathan Swan, Trump Suggests No Laws Are Broken if He’s „Saving His Country“, nytimes.com, 15.2.2025.
5 Musk discusses DOGE while in Oval Office, cnn.com, 11.2.2025.
6 Interview mit John Bolton, bulwark.com, 7.11.2024.
7 Bob Bauer, Trump is poised to turn the DOJ into his personal law firm, theatlantic.com, 9.1.2025.
8 Alan Z. Rozenshtein, Trump‘s TikTok Executive Order, lawfaremedia.org, 21.1.2025.
9 Allison McManus, Dan Herman und Laura Kilbury, Pete Hegseth Is Unfit To Lead the Pentagon, americanprogress.org, 10.1.2025.
10 Joe Spielberger, The Dangers of Trump’s Schedule Policy/Career Executive Order, pogo.org, 31.1.2025.
11 Eric Lipton, Trump Begins Selling New Crypto Token, nytimes.com, 18.1.2025.
12 Democracy in 2025, Part II: The United States, youtube.com, 24.1.2025.
13 Eric Tucker, Michelle L. Price und Zeke Miller, With firings and lax enforcement, Trump moving to dismantle government’s public integrity guardrails, apnews.com, 11.2.2025.
14 Bob Bauer, Why is the Trump Administration Weakening „Foreign Influence“ Enforcement?, executivefunctions.substack.com, 12.2.2025.
15 Ellen Knickmeyer, White House fires USAID inspector general after warning about funding oversight, officials say, apnews.com, 12.2.2025.
16 Bill Chappell, Navalny‘s legacy: His ceaseless crusade against Putin and corruption, 16.2.2024.
17 Wojciech Kość, Visas-for-bribes scandal rocks Poland’s anti-immigrant government before election, politico.eu, 15.9.2023. x
18 John M. Barry, The House of Jim Wright, politico.com, 7.5.2015.
19 William G. Gale und Samuel I. Thorpe, Cut taxes or save Social Security?, brookings.edu, 31.1.2025.