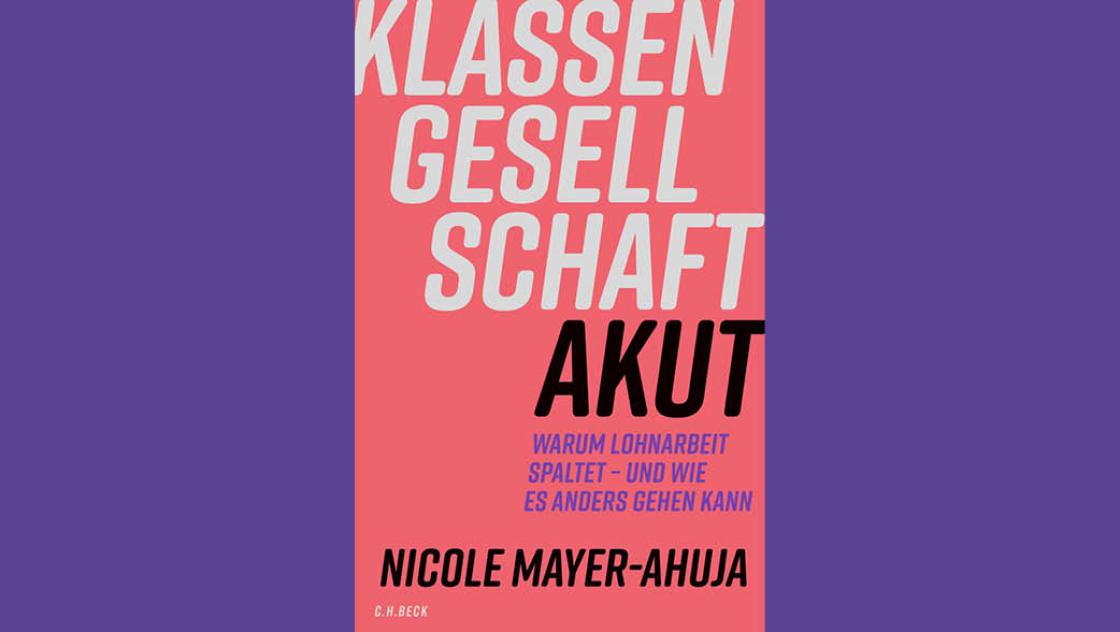
Bild: Nicole Mayer-Ahuja, Klassengesellschaft akut. Cover: Verlag CH Beck
Dass die Gesellschaften des entwickelten Kapitalismus doch keine klassenlosen Gebilde sind, hat sich herumgesprochen. Über Jahrzehnte dominierte das Diktum der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ des konservativen Sozialwissenschaftlers Helmut Schelsky den Blick auf die deutsche Gesellschaft. Heute ist davon kaum noch die Rede. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die eklatante Ungleichverteilung von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen. Doch die soziologische Durchdringung dieser Entwicklungen bleibt kontrovers. Wie lassen sich die dahinter verborgenen Dynamiken erfassen? Handelt es sich bei den gespaltenen Gesellschaften um traditionelle Klassengesellschaften oder dominieren neue Klassenspaltungen? Oder führt die klassenanalytische Herangehensweise auf eine falsche Fährte? Müssen die Entwicklungen mit einem anderen Analysebesteck bearbeitet werden?
Zu diesem Themenkomplex hat die Göttinger Soziologin Nicole Mayer-Ahuja bei C.H. Beck einen instruktiven Debattenbeitrag vorgelegt. Dabei hat sich die Autorin um eine gut lesbare und kompakte Darstellung dieses komplexen Themas bemüht – mit Erfolg. Auf gut 230 Textseiten (ergänzt um weitere 40 Seiten mit Anmerkungen und Literaturverzeichnis) präsentiert sie eine soziologisch gehaltvolle und zugleich griffige Abhandlung. Dass dabei auch relevante Facetten des Themas unthematisiert bleiben müssen, ist unvermeidlich und wird nicht verschwiegen. Die aktuellen Dynamiken von Klassenformierung seien offensichtlich zu komplex für eine einzige Abhandlung, schreibt Mayer-Ahuja. „Daher versteht sich das Buch nicht als letztes Wort zum Thema der Klassenformierung, sondern als Einladung, sich aus möglichst vielen verschiedenen Perspektiven weiter mit diesen Prozessen auseinanderzusetzen.“
Der Titel „Klassengesellschaft akut. Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann“ gibt gleich das Kerninteresse der Analyse zu erkennen. Mayer-Ahuja begnügt sich nicht mit der Nachzeichnung der sozialen Spaltungslinien in der Entwicklung des deutschen Kapitalismus. Dies reiche nicht aus, so die Autorin. „Denn Lohnarbeit nimmt zwar ganz verschiedene Formen an, schafft aber zugleich viele Gemeinsamkeiten unter den davon Betroffenen: vom Zwang, kontinuierlich die eigene Arbeitskraft zu vermarkten, über die Mehrung fremden Reichtums bis hin zu jener Fremdbestimmung, die aus Arbeit unter dem Weisungsrecht von Vorgesetzten erwächst.“ Konsequent und systematisch fahndet sie daher in den Spaltungsdynamiken nach „Potentiale(n) der Solidarität“, die „Möglichkeitsräume“ hervorbringen, „an denen eine verbindende Politik der Arbeit ansetzen kann“.
Es ist diese Dialektik aus Einheit und Spaltung – ein Begriffspaar, das der Politikwissenschaftler Frank Deppe zu Beginn der 1980er Jahre in die Debatte einbrachte –, die den roten Faden der Analyse ausmacht und sie zugleich von anderen unterscheidet. Zu Beginn leitet die Autorin klassentheoretisch die These her, dass die Dynamiken der Klassenformierung aus den Veränderungen in der kapitalistischen Arbeit, genauer: Lohnarbeit, zu begreifen seien. Dabei widmet Mayer-Ahuja sich den objektiven Veränderungen im Arbeitsprozess und den Folgen für die sozialen Beziehungen in der Klasse der Arbeitenden, aber auch zwischen Kapital und Arbeit. Auch die Modi ihrer „Verarbeitung in den Köpfen“ der Betroffenen diskutiert sie.
Der schwierige betriebliche Universalismus
Insbesondere mit Blick auf die Prekarisierung von Lohnarbeit geht Mayer-Ahuja der wachsenden Bedeutung von Fragen des Geschlechts und der ethnischen Herkunft nach. Hier zeigt sich, wie sie die methodische Frage nach den Ansätzen für eine solidarische Interessenpolitik konkretisiert: Unter welchen Bedingungen können abhängig Beschäftigte das Verbindende über das Trennende stellen? Mayer-Ahuja beginnt mit einem kurzen Verweis auf die lange Tradition des Rassismus. Seit den Anfängen des Kapitalismus schlummere in der arbeitenden Klasse eine Bruchlinie zwischen einheimischen und migrantischen Beschäftigten. Trotz anderslautender Behauptungen sei Rassismus auch in der gegenwärtigen Arbeitswelt nicht verschwunden, sondern „in moderne Formen kapitalistischer Herrschaft eingebunden“. Doch folgt der Nachzeichnung potentieller Spaltungsdynamiken der Hinweis auf Solidarisierungspotentiale auf dem Fuß. Auch Unternehmensleitungen hätten ein Interesse daran, dass Betriebsabläufe nicht durch ethnische Konflikte oder rassistische Pöbeleien gestört würden. Dabei seien von oben bekundete Bekenntnisse zu gleichen Rechten für alle Beschäftigten unabhängig ihrer ethnischen Herkunft mitunter mehr als Managementrhetorik. Und aufseiten der Beschäftigten dominiere nicht selten die Bereitschaft zu einer konfliktvermeidenden „pragmatischen Kooperation“, die sich zu „echter Kollegialität“ weiterentwickeln könne.
Ein solcher „betrieblicher Universalismus“, hier greift Mayer-Ahuja einen Begriff des Soziologen Werner Schmidt auf, der gleiche Rechte der Beschäftigten ohne Ansehen der ethnischen Herkunft (oder des Geschlechts, wäre zu ergänzen) garantiert, sei jedoch keineswegs voraussetzungslos. Er habe zur Bedingung, „dass Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen und die Vertretung durch einen Betriebsrat tatsächlich ‚für alle‘ gelten“. Das in der Arbeitssoziologie diskutierte sozialintegrative Potential arbeitsweltlicher Alltagserfahrungen kann so virulenten rassistischen Spaltungstendenzen als eine solidaritätsstiftende Kraft entgegengesetzt werden – vorausgesetzt, die Potentiale der Solidarität werden seitens der Beschäftigten und Interessenvertretungen politisch aktiviert.
Nach der Analyse weiterer Spaltungslinien – etwa zwischen Arbeiter und Angestellten sowie zwischen geschützt und prekär Arbeitenden in den modernen Dienstleistungsbranchen (Reinigungs- und Sicherheitsdienste oder Pflege und Einzelhandel) – münden die Ausführungen in die Frage, wie der Kampf um die Köpfe in die Mobilisierung utopischer Energien übergehen kann, die über den Status quo der existierenden Klassengesellschaft hinausweisen. Hier bringt die Autorin arbeitsweltliche Kooperationserfahrungen, aber auch das professionelle Ethos der Industrie- und Dienstleistungsarbeit sowie das Erbe der Arbeiter:innenbewegung ins Spiel.
Die verborgene Klassenrealität
Es kann nicht verwundern, dass bei einem solch ambitionierten Unterfangen relevante Aspekte unerwähnt bleiben: Überraschenderweise spielen die Auswirkungen der ökologischen Transformation auf Produktion und Klassenformierung so gut wie keine Rolle in dem Buch, weder für die Verausgabung noch für die Reproduktion der Arbeitskraft. Die Dekarbonisierung des Kapitalismus als wesentliche Determinante der heutigen Klassengesellschaft bleibt unthematisiert. Auch wie sich die Transnationalisierung der ökonomischen Strukturen auf die Bedingungen der Klassenformierung auswirkt, diskutiert die Autorin lediglich als Migrationsthema und damit aus einer Von-außen-nach-innen-Perspektive. Von-innen-nach-außen-Entwicklungen bleiben hingegen unbeleuchtet. Doch wie kann eine transnationale Klassenformierung gelingen, die infolge globalisierter Wertschöpfungsketten auch Beschäftigte außerhalb des deutschen Kapitalismus adressiert?
Doch Hinweise auf Fehlendes sollten nicht den Blick auf das Vorhandene trüben. Mayer-Ahuja hat eine wertvolle Intervention in die Debatte um die teils offensichtliche, teils verborgene Klassenrealität in der deutschen Gesellschaft vorgelegt. Insbesondere durch den Fokus auf die Dialektik von Spaltung und Solidarität in den arbeitsweltlichen Umbrüchen erhält das Buch ein ansehnliches politisches Anregungspotential und wird so für politiknahe Leser:innen besonders wertvoll. Und tatsächlich sind die sozialen Verwerfungen in modernen Gesellschaften zu komplex für eine einzige Analyse. Daher gilt es, die eingangs zitierte Einladung zur Debatte über die Realität der Klassengesellschaft – und ihrer Überwindung – anzunehmen. Nicole Mayer-Ahuja hat dazu einen anregenden Beitrag vorgelegt.
Nicole Mayer-Ahuja, Klassengesellschaft akut. Warum Lohnarbeit spaltet – und wie es anders gehen kann. C. H. Beck, München 2025, 277 S., 26 Euro.









