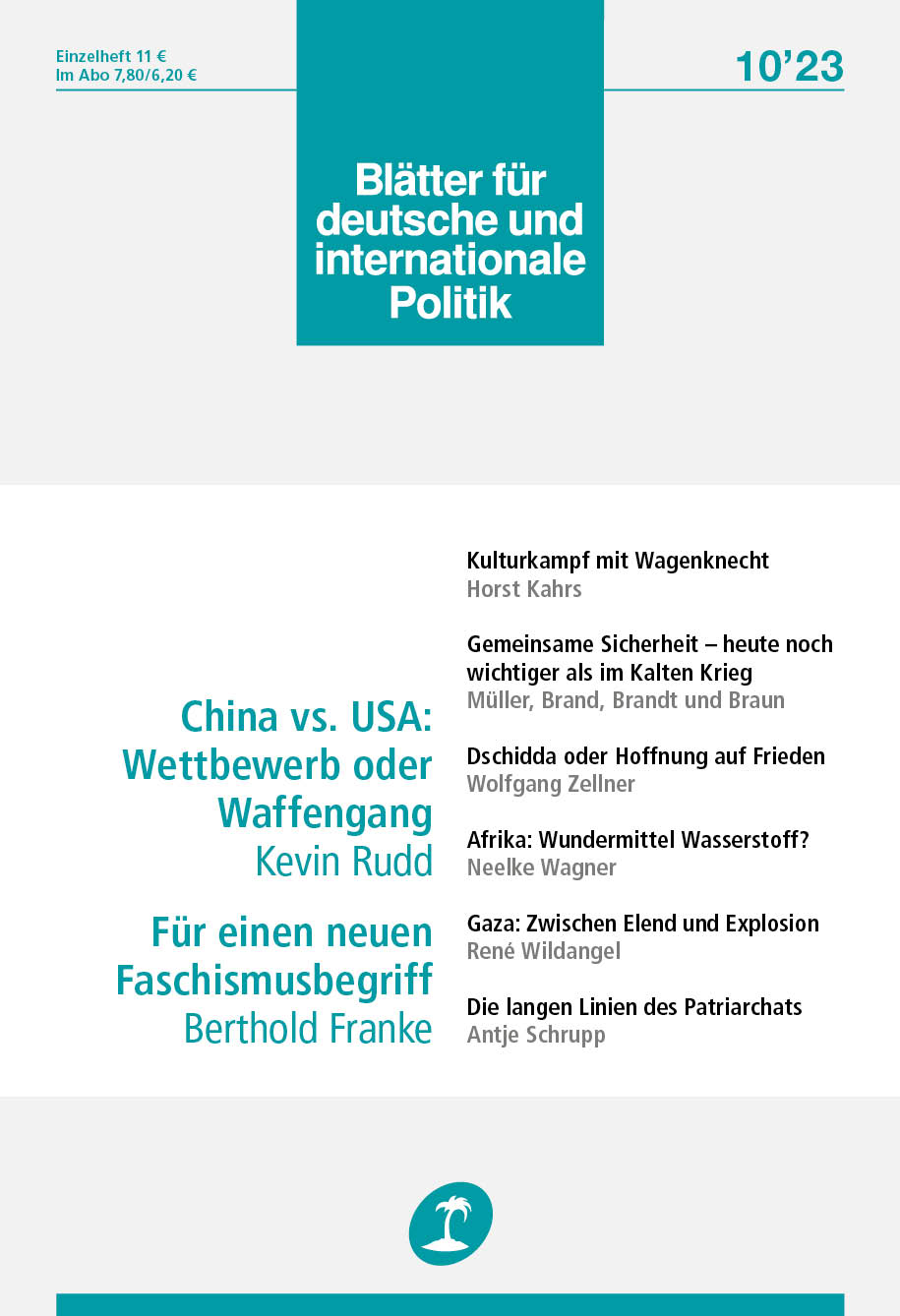Warum wir bei Putin, Orbán und Co. nicht nur von Rechtspopulismus sprechen sollten

Bild: Wladimir Putin und Narendra Modi in New Delhi, 6.12.2021 ( IMAGO / Sanjeev Verma / Hindustan Times)
Der fortwährende Skandal des russischen „antifaschistischen“ Verteidigungskriegs zur „Denazifizierung“ der Ukraine scheint die westlichen Beobachter in eine Art Schockstarre versetzt zu haben. Während die politische Koalition gegen die russische Aggression bislang überraschend stabil und handlungsfähig ist, hat eine terminologische Gegenwehr seither kaum stattgefunden. Dabei war schon lange vor dem 24. Februar 2022 absehbar, dass die globale Landkarte politischer Ideen und Bewegungen neu vermessen werden muss, und zwar nicht nur wegen der zynischen Behauptung „antifaschistischer“ Ziele einer imperialistischen russischen Politik, die Moskau vor allem mit Blick auf die eigene Bevölkerung geschichtspolitisch instrumentalisiert. Weit über die aktuellen Ereignisse in Osteuropa hinaus erweist der Blick auf eine lange Reihe internationaler politischer Bewegungen, Parteien und Regimes – von Ungarn und Belarus über Brasilien und die Türkei bis zu den Philippinen oder Indien, aber auch in gestandenen Demokratien wie den USA, Frankreich, Italien, Österreich bis hin zu den skandinavischen Ländern – ein deutliches Defizit im begrifflichen Instrumentarium. „Rechts“, „rechtspopulistisch“, „rechtsextrem“, „national-autoritär“ – all diese Titel und deren Abwandlungen vor allem in der Wortfamilie um „Populismus“ werden wieder und wieder bemüht, um sehr heterogene, im Kern aber strukturverwandte politische Phänomene zu kennzeichnen.