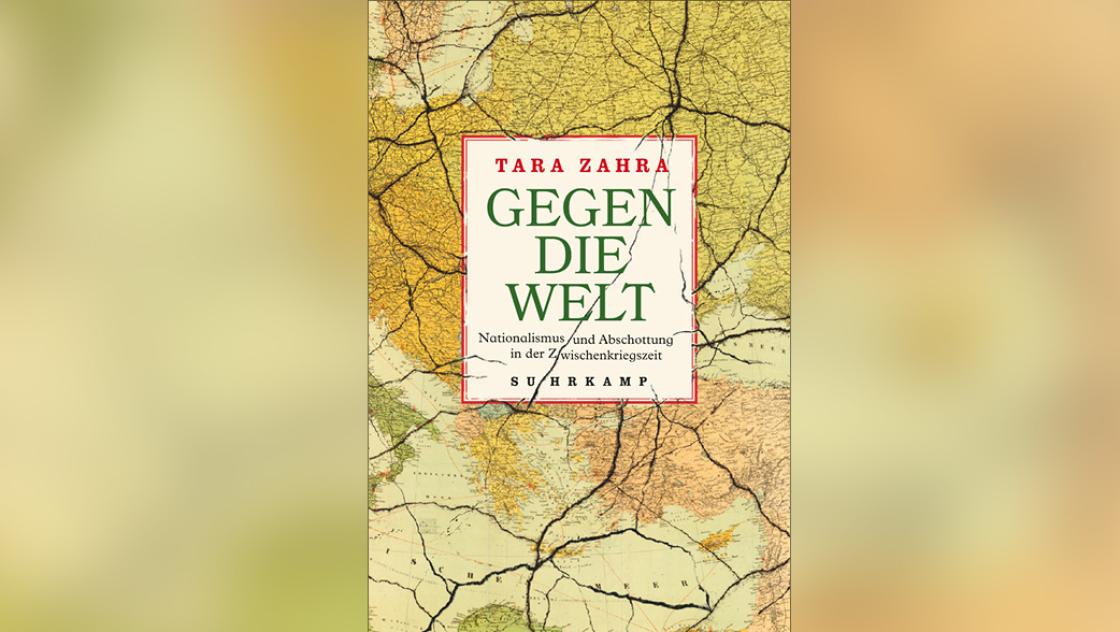
Bild: Tara Zahra: Gegen die Welt.Nationalismus und Abschottung in der Zwischenkriegszeit, Cover: Suhrkamp
„Im goldenen Zeitalter vor dem Krieg konnte der ‚Bewohner Londons […], seinen Morgentee im Bette trinkend, durch den Fernsprecher die verschiedensten Erzeugnisse der ganzen Erde in jeder beliebigen Menge bestellen und mit gutem Grund erwarten, daß man sie alsbald an seiner Tür ablieferte‘“. Mit diesen Worten des britischen Ökonomen John Maynard Keynes beschreibt Tara Zahra die scheinbar heile Welt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Noch deutlicher ist das Urteil Stefan Zweigs: „Vor 1914 hatte die Erde allen Menschen gehört“, zitiert die Historikerin aus seinem autobiographischen Werk „Die Welt von Gestern“. „Jeder ging, wohin er wollte, und blieb, solange er wollte.“
Doch ganz so heil oder frei war die Welt nicht, macht Zahra deutlich – oder nur für jene kleine Gruppe von Kosmopoliten, für die Grenzen keine Rolle spielten. „Vor dem Ersten Weltkrieg konnten Zweig und Keynes vor allem deshalb frei von bürokratischen Hindernissen durch die Welt reisen, weil sie wohlhabende, gebildete, weiße Europäer waren.“
Dieses Zeitalter der Globalisierung war mit dem Ersten Weltkrieg vorbei. Damit beginnt Zahras gleichermaßen spannendes wie wichtiges Buch „Gegen die Welt“. Es besticht durch seinen lebendigen Stil, man fühlt sich manchmal um hundert Jahre in der Geschichte zurückversetzt.









