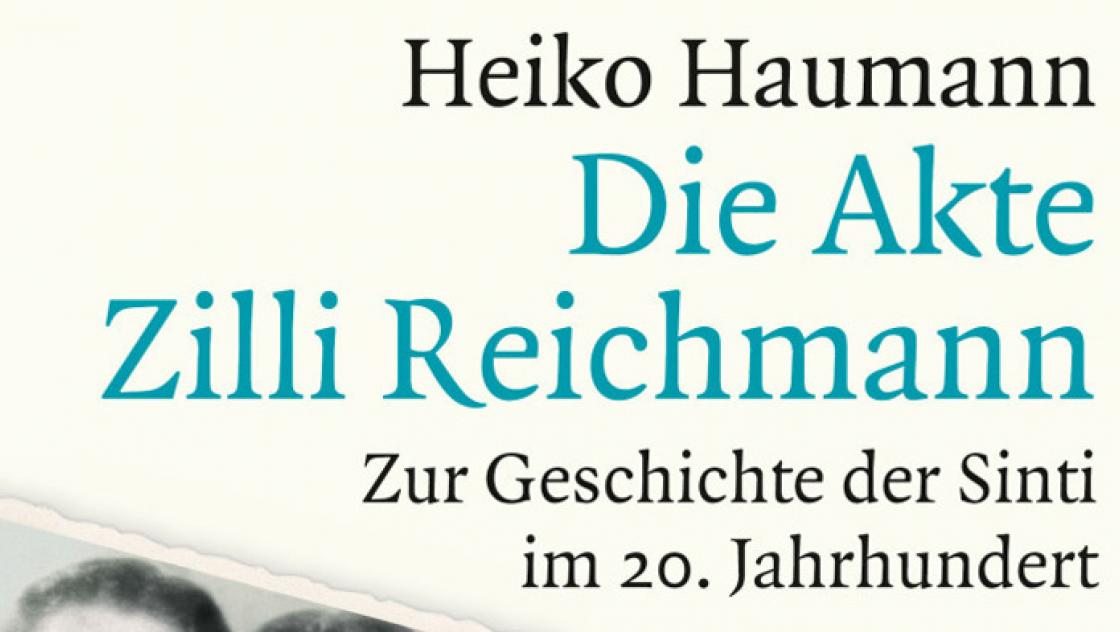
Bild: S. Fischer Verlag
Auf dem Weg ins Gebirge kamen wir häufig an jener Waldecke zwischen zwei Ortschaften vorbei, wo meine Mutter den Vater bat, langsamer zu fahren. Für einen kurzen Augenblick bot sich ein Einblick in das Lager der Zigeuner mit ihren Wohnwagen und, wie immer bemerkt wurde, mit dem Daimler davor. Das war in den 1960er Jahren. Das damals mitschwingende Gefühl eines andersartigen, geheimnisvollen, aber irgendwie faszinierenden Lebens blieb in Erinnerung.
Doch ein Bewusstsein darüber, was hinter dem Wort „Zigeuner“ steckt, ein Wissen um Geschichte und Schicksal, wie es Heiko Haumann heute in seiner „Lebenschronik einer deutschen Zigeunerin“ auf dem Boden eigener und inzwischen tradierter Forschungen ausbreiten kann, gab es damals nicht – oder besser: nicht mehr. Zu dicht war der Vorhang aus Lüge und Vorurteil, aus verdrängter Schuld und Ignoranz gewebt. Wer wusste schon die Begriffe „Sinti“ und „Roma“ zu benutzen? Wer konnte die Jenischen davon unterscheiden? Wer wusste von den Wittgensteiner Zigeunern mit ihrer vergleichsweise tiefen Integration in die Gesellschaft? Haumann setzt das Wort „Zigeuner“ in Anführungszeichen, wo es die rassistische Diskriminierung bezeichnet, benutzt es direkt, wo es die Selbstbezeichnung bewusster Sinti nachvollzieht.









