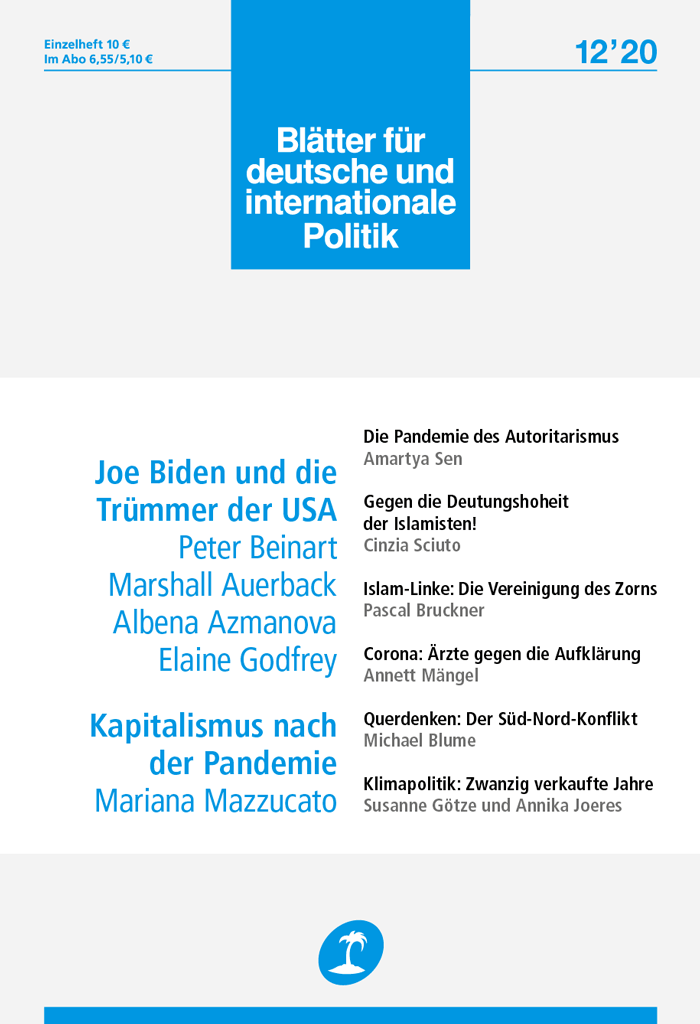Bild: imago images / Müller-Stauffenberg
Im vergangenen, durch Corona geprägten Jahr haben wir überall, aber auch und nicht zuletzt in Deutschland eine enorme Zunahme gegen die Regierung gerichteter Proteste erlebt. Spätestens seit dem Aufkommen von Pegida werden diese bei uns mit einem Ost-West-Ressentiment erklärt. Das jedoch geht an der Realität vorbei: Tatsächlich haben wir es weit stärker mit einem Süd-Nord-Konflikt zu tun. Knapp gesagt, trifft bei den Anti-Corona-Protesten süddeutscher Platonismus auf norddeutschen Zentralismus.
Der deutsche Süden von Baden bis Sachsen hat eine komplexe Dynamik, aber eine Gemeinsamkeit: Die Skepsis gegenüber der Obrigkeit und der Wissenschaft hat in ganz Süddeutschland Tradition. Der Unmut im Süden, vor allem in Baden-Württemberg, hat dabei meines Erachtens zwei religions-philosophische Gründe und einen historischen.
Da wäre zum einen die evangelische Strömung des Pietismus. Dieser sagt, man muss die Wahrheit stets selbst überprüfen. Wir Süddeutschen sind im Durchschnitt vielleicht etwas frömmer als der Norden, aber deswegen gerade nicht braver. Die Anhänger des Pietismus haben früh angefangen, Dinge zu hinterfragen: Was lehrt die Kirche? Was lehrt der Pfarrer? Was davon stimmt? So entstand ein recht widerständiger, bürgerschaftlich engagierter Süden mit viel Licht und leider auch manchem Schatten.
Die Religion führte dazu, dass die Menschen ihr Leben selbst in die Hand nahmen, sich gemeinsam auf den Weg machten. Im 19. Jahrhundert wanderten viele Württemberger Pietisten sogar aus, weil sie in Jerusalem, den USA oder im Kaukasus das erwartete Ende der Welt erleben wollten.
Anstatt sich belehren zu lassen, schauen Pietisten selber in der Bibel nach. Zum Beispiel in der „Stund“, zu der sich die Gläubigen nach dem Gottesdienst treffen, um sich auszutauschen. Heute jedoch schauen die meisten – um die Wahrheit zu finden – nicht mehr in die Bibel, sondern ins Internet. Und sie hinterfragen nicht den Pfarrer, sondern den Virologen.
Der zweite Grund für die starken Anti-Corona-Proteste liegt für mich in den starken Strömungen des Platonismus in Süddeutschland. Der griechische Philosoph Platon formulierte in seinem Höhlengleichnis einen Urverschwörungsmythos. Danach sind die Menschen in ihrer Erkenntnisfähigkeit Gefangene. Unsere Gespräche und unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse seien nur Täuschungen und Schattenspiele der Wahrheit. In diese Wahrheit aber könne uns nur ein starker Befreier führen. Das Höhlengleichnis geht ja davon aus, dass es höhere Ideen gibt, die die meisten Menschen nicht sehen. Um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen, braucht es charismatische Führer, die die etablierten Institutionen und Wissenschaften in Frage stellen. Ein Beispiel ist Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, der nicht ohne Zufall ausgerechnet in Stuttgart die erste Waldorfschule ins Leben gerufen hat.
Die Anthroposophie, die trotz antisemitischer und rassistischer Traditionen in die ganze Welt ausstrahlt, geht ebenfalls von einem überzeitlichen Wissen aus. In dieses solle man sich von den Wissenschaften nicht unbedingt reinreden lassen. Bei einigen der Querdenken-Demonstrationen sind Redner aufgetreten, die sich explizit als Anthroposophen zu erkennen gaben.[1] Die eigentliche Problematik ist dabei das sogenannte Blunting, das Abblocken. Das heißt, wenn mir beängstigende Dinge geschehen, eine Wirtschaftskrise, Krieg oder eine Pandemie, dann haben wir entweder die Möglichkeit, gemeinsam durch diese Angst zu gehen oder zu sagen: „Daran sind Verschwörer schuld. Wenn ich gegen die vorgehe, ist schon alles gut.“ Auf diese Weise werden die eigentlich positiven Aspekte der Selbstverwaltung und des Selberdenkens negativ gewendet: „Die Obrigkeit hat sich mit Fremden gegen uns verschworen!“
Immer gegen Berlin – schon seit der Reichsgründung 1871
Zu diesen beiden religionsphilosophischen Gründen kommt drittens ein historischer Grund – nämlich eine traditionelle Skepsis gegenüber Berlin. So war schon bei der Gründung des Deutschen Kaiserreichs im Januar 1871[2] der König von Württemberg eigentlich dagegen, dass sein Königreich unter einem preußischen Kaiser Teil des Deutschen Reichs wird. Dieses Gefühl der Fremdbestimmung – dass man in Berlin ja eh macht, was man will –, ist im Südwesten sehr stark. Kulturell und medial ist man hier bis heute stärker an Österreich und die Schweiz gebunden. Es gibt die Vorwürfe an die Medien aus Berlin und Hamburg, dass sie als angebliches Kartell nur auf die Menschen herunterschauen. Dagegen verklärt man die direkte Demokratie in der Schweiz oder einen Kanzler wie Sebastian Kurz. Unglücklich ist, dass derzeit Baden-Württemberg in der Bundesregierung mit keinem Ministerium vertreten ist. Da kann man leicht den Leuten sagen: „Berlin nimmt euch gar nicht wahr!“ Und dieses Gefühl ist keineswegs spezifisch baden-württembergisch, sondern es existiert sowohl im westlichen als auch im östlichen Süden Deutschlands. Auch Sachsen hat in seiner Geschichte immer eher nach Süden tendiert und sich gegen Preußen abgegrenzt.
Noch grundsätzlicher gefasst: Wir erleben derzeit weltweit eine gefährliche Glokalisierung. Die Menschen reagieren auf die Globalisierung, indem sie sich auf ihre eigenen Bezugspunkte zurückziehen – geographisch, aber auch indem sie nur noch ihre eigenen Medien nutzen. Diese Bewegung sehen wir gerade in allen großen Demokratien. Schon Adorno sprach davon, dass der Faschismus sich da organisiert, wo die Menschen das Gefühl haben, sie leben in der Provinz.
In Deutschland haben wir in dieser Hinsicht durchaus noch Glück, denn es ist bei uns bisher keine Mehrheitsbewegung. Ich sehe daher keine wirkliche Gefahr für den Bestand der Republik, aber ich erkenne darin eine akute Problemanzeige. Denn auch wenn die neu-alten Rechtsradikalen es diesmal nicht schaffen werden, unsere Demokratie zu vernichten: Populisten waren immer stark darin, die Gefühle von Menschen auszubeuten.
Vom Hexenhammer bis QAnon – Antisemitismus als Spitze der Bewegung
Dem Antisemitismus kommt dabei heute wie gestern eine entscheidende Rolle zu: Er bildet beim Verschwörungsglauben immer die Spitze, weil alles darauf hinausläuft, dass Juden die Weltverschwörer sein sollen. Bei den sogenannten Querdenkern war das von Anfang an deutlich zu beobachten. Der Stuttgarter Querdenker Michael Ballweg hatte zu seiner ersten großen Demonstration den Antisemiten Ken Jebsen eingeladen. Sein Pressesprecher ist in der Reichsbürgerszene aktiv. Dazu kommt das Bekenntnis zur QAnon-Bewegung, die die Erzählung verbreitet, eine Elite, zu der natürlich auch Juden gehören sollen, halte sich durch die Körperzellen von Kindern jung.
Die ersten antisemitischen Covid-19-Verschwörungsmythen erreichten uns schon im Januar 2020, inklusive bizarrer Vorwürfe, die bis in die Zeit der Hexenverfolgung zurückreichen. Mit dem Aufkommen des Buchdrucks verbreiteten sich nicht nur im süddeutschen Raum Werke wie der „Hexenhammer“, in denen behauptet wurde, Frauen und Juden würden Hexensabbat feiern und aus Kindern Hexensalbe produzieren, damit sie fliegen können. Heute geht es um das Stoffwechsel-Produkt Adrenochrom, aus dem angeblich eine Power-Droge hergestellt werden kann. Die QAnon-Bewegung verdächtigt Juden und Demokratinnen wie Hillary Clinton und Angela Merkel, Kinder in geheimen Verliesen zu halten, um aus ihnen Adrenochrom zu gewinnen. Die Pandemie diene ihnen zur Vertuschung ihrer Verbrechen. Dass Michael Ballweg auf einer großen Demo in Berlin den QAnon-Slogan „Where we go one, we go all“ proklamierte, hat mich regelrecht entsetzt.
Nach den uns vorliegenden Daten ist die QAnon-Gruppe in Deutschland inzwischen die zweitgrößte nach den USA. Doch immerhin, die Bewegung zerfällt bereits wieder. So erkennen immer mehr, dass der bisherige US-Präsident Trump wohl doch nicht der ersehnte Erlöser ist. Aber auch da müssen wir aufpassen, weil Menschen, die ihre apokalyptischen Erwartungen enttäuscht sehen, nur die Wahl haben, sich entweder peinliche Irrtümer einzugestehen oder sich noch weiter zu radikalisieren.
Neue Medien, neue Verschwörungsmythen – und der alte autoritäre Charakter
Insgesamt ist QAnon nur die etwas modernisierte Fassung von antisemitischen Mythen aus dem Mittelalter. Diese Mythen gab es immer, gerade der Antisemitismus war niemals wirklich weg. Allerdings erhalten derartige Verschwörungsmythen durch die Digitalisierung eine völlig neue Dynamik. Auch das ist historisch betrachtet nichts Neues: Immer wenn neue Medien in die Welt kommen, erleben wir solche Umbrüche. Mit der Verbreitung des Buchdrucks erfolgte die Ausbreitung des Hexenglaubens; Radio und Film wurden prompt von Nazis und vom Ku-Klux-Klan genutzt.
Wir Menschen sind dazu geboren, an etwas zu glauben. Dafür haben wir Religionen und Weltanschauungen, die mit Mythen und Symbolen über die Wissenschaft hinausweisen. Aber wir sind leider nicht automatisch dazu geboren, an das Gute zu glauben. Es kann ebenso attraktiv sein zu glauben, dass wir in einer von bösen Mächten regierten Welt leben und daran beteiligt sind, eine riesige Weltverschwörung zu zerschlagen. Antisemitische Sekten wie QAnon oder die Schweizer OCG erfüllen dann quasi die Funktionen, die wir traditionell bei Kirchen, Religionen und nichtreligiösen Weltanschauungen verortet haben, nämlich Gemeinschaftsbildung und Sinnstiftung.
Der andere entscheidende Faktor für die Verbreitung von Verschwörungsideologien ist die enorme Häufung von Krisen, die wir derzeit erleben. Angesichts der Tatsache, dass gegenwärtig Pandemie und Wirtschaftskrise zusammenkommen, können wir eigentlich noch froh sein, dass über 90 Prozent der Menschen sehr vernünftig sind und nur eine kleine, aber laute Minderheit gegen die Regierungsmaßnahmen zu Felde zieht.
Das aber ist kein Grund zur Entwarnung: Autoritäre Persönlichkeiten, die glauben, dass die Welt ein böser Ort ist, in dem man sich nur mit Gewalt schützen kann, sind anfällig für Verschwörungsglauben. Der Schlüssel zu diesem Protest liegt in der sogenannten autoritären Persönlichkeit. Wenn Menschen schon als Kind gelernt haben, anderen zu vertrauen, auch den Wissenschaften, vielleicht auch Gott, dann sind sie tendenziell resistenter gegenüber Verschwörungsideologien. Wenn Menschen aber von klein auf gelernt haben, anderen zu misstrauen, vielleicht Gewalt erfahren haben, ihnen mit dem Teufel gedroht wurde, dann sind sie später ansprechbarer für ein vermeintlich schützendes Patriarchat und für Verschwörungsmythen.
Hinzu kommt: Wir leben leider immer noch in einer Gesellschaft, in der Männern seltener zugestanden wird, über Gefühle zu sprechen. Speziell für ältere Männer, das erlebe ich in Gesprächen und öffentlichen Diskussionen immer wieder, sind Covid-19 und die Maßnahmen dagegen ein besonders schwieriges Thema. Gerade Männer, die sehr erfolgreich im Beruf waren, vielleicht auch eine gehobene Bildung haben, finden es jetzt unglaublich schwierig, ja fast unerträglich, dass andere, auch Frauen, ihnen in dieser Krise Vorschriften machen, wie sie zu leben und Dinge zu verstehen haben.
Wir treffen jetzt auf Leute, die immer daran gewöhnt waren, alles selbst in ihrem Umfeld zu kontrollieren, und die nicht damit zurechtkommen, dass eine Pandemie ausgebrochen ist, die sich eben nicht so einfach kontrollieren lässt. Diese Menschen reagieren allergisch auf Politikerinnen, Journalistinnen und Ärztinnen. Ihre hilflose Wut kann dann zum Verschwörungsglauben werden: Es muss jemand daran schuld sein – und wenn ich den und die identifiziert und ausgeschaltet habe, dann ist alles wieder gut.
Der Kampf gegen ein Glaubenssystem und die antisemitische Querfront
Um Verschwörungsmythen wirksam zu bekämpfen, muss man sich daher klarmachen, dass es sich um ein Glaubenssystem handelt. Es hat eher die Charaktereigenschaften einer Sekte: Verschwörungsgläubige ziehen sich in eine parallele Realität zurück, sie glauben anders als in Religionen an die Weltherrschaft böser Mächte. Man darf jedoch nicht glauben, dass das deswegen alles „Covidioten“ seien. In einen Verschwörungsglauben können auch hochintelligente Menschen abdriften. Auch dafür haben wir in Baden-Württemberg mit dem Philosophen Martin Heidegger ein leider berühmtes Beispiel. Ein weltweit verehrter Philosoph, hoch gebildet, der jüdische Lehrer und mit Hannah Arendt eine jüdische Geliebte hatte. Trotzdem war er glühender Antisemit und hat es selbst nach dem verheerenden Krieg nicht mehr geschafft, aus diesem Verschwörungsglauben herauszufinden.
Heute bildet der Antisemitismus den Kitt für eine Bewegung, die nicht durch eine positive Vision verbunden ist, sondern nur durch ein gemeinsames Feindbild. Auch hier gibt es einen frühen Vorläufer, den Anarchisten Michail Bakunin im 19. Jahrhundert. Er gehörte zu den Ersten, die Marxisten und die Bankiersfamilie Rothschild gemeinsam für eine jüdische Weltverschwörung verantwortlich gemacht haben.
Dieser Glaube an die eine große Verschwörung aller Demokratien, an der heute noch die Milliardäre Gates und Soros beteiligt seien, ist bei Rechtsextremen, aber auch im linken und libertären Milieu attraktiv. Auf diese Weise stehen diese Menschen plötzlich beieinander und bilden eine Querfront, die nur durch das geteilte Feindbild zusammengehalten wird.
Hinzu kommt: Man darf bei alledem nicht vergessen, dass die Initiatoren und Verbreiter der Verschwörungsideologien damit auch eine Menge Geld verdienen. Die Menschen werden um Spenden und vorgebliche Schenkungen angehauen; sie sollen Abos abschließen; sie sollen Produkte kaufen. Selbst wenn diese Bewegung also nicht so erfolgreich ist wie frühere fanatische Bewegungen, so ist sie zumindest doch ein erstaunliches Geschäftsmodell. Und die Anbieter sind alles andere als dumm, sondern sie setzen darauf, dass ihre Anhängerschaft leicht zu täuschen ist.
Und weil die Menschen über soziale Medien dauerhaft in einen Erregungszustand versetzt werden, gelingt es, diese krude Mischung, diese Querfront, digital zu mobilisieren. Über die Messenger-Dienste Telegram und Twitter werden die „Gläubigen“ täglich mit neuen Nachrichten versorgt. Dabei werden auch immer neue Endzeittermine ausgerufen. Schon am vergangenen 1. September hätte ja wieder einmal die Demokratie untergehen sollen. Die Menschen werden auf diese Weise in einen solchen Erregungszustand versetzt, dass sie gar nicht merken, was daran nicht stimmt, und es am Ende völlig normal finden, auch unter einer Reichsbürgerflagge mitzulaufen.
Nicht nur »Covidioten« – täuschen wir uns nicht!
Man darf daher nicht den Fehler begehen, alle an den Protesten Teilnehmenden als geisteskrank abzustempeln. Ja, bestehende psychische Probleme können durch Verschwörungsmythen noch verstärkt werden. Dagegen kann man am Anfang durchaus noch etwas tun. Wer aber über längere Zeit in solch einen Verschwörungsglauben verstrickt ist, kommt nur noch ganz schwer heraus. Wenn aber jemand derart tief drinsteckt, dass man nicht mehr mit ihm reden kann, dann muss man auch den Mut haben, klar zu sagen: Ich höre mir das nicht länger an. Es war bereits ein großer Fehler, dass man Pegida nachgelaufen ist. Gegen erwachsene Menschen, die sich in Hass verrannt haben, darf, ja muss man sich entschieden abgrenzen.
Insbesondere der Staat sollte auf alle Fälle wehrhaft sein. In Stuttgart wurde gerade jemand, der in der ganzen Stadt „Merkel ist Jüdin“-Schmierereien verteilt hatte, sehr schnell ermittelt und festgenommen. Ich würde mir wünschen, dass man auch gegen Leute wie den Vegankoch und Verschwörungsideologen Attila Hildmann, der andere beleidigt und massiv bedroht, entschiedener vorgeht. Wenn Hildmann jedoch dafür, dass er seinen Hass auspustet, noch mit einem Waldspaziergang bei einem großen Nachrichtenmagazin belohnt wird, dann kommt natürlich bei den Leuten die Botschaft an, dass sie immer so weitermachen und damit sogar Ruhm und Geld abschöpfen können.
Dagegen brauchen wir eine Vielzahl von Ansätzen. Das beginnt bei Bildung und Prävention, das geht aber auch in den Bereich von Verboten und Strafverfolgung. Gerade autoritäre Persönlichkeiten brauchen klare Grenzen. Dagegen empfinden sie Freundlichkeit und Zuwendung als bloße Bestätigung. Die sogenannte Kuschelpädagogik bringt an dieser Stelle daher rein gar nichts. Einfach deshalb, weil diese Menschen – bei aller Feindschaft gegenüber dem als autoritär empfundenen „Berlin“ – doch im Kern selbst zutiefst autoritär denken.
Doch immerhin: Dass mich längst auch vernünftig Glaubende aus dem Pietismus und der Anthroposophie zu sich einladen, dass wir uns gemeinsam aufklärend gegen Hass und Verschwörungsmythen stellen – das gibt mir Hoffnung, dass das Miteinander stärker ist und die Republik nicht untergehen wird. Diesmal nicht!
[1] Das wird aber auch innerhalb der Anthroposophen-Szene durchaus kontrovers diskutiert. Mir melden Lehrer und Eltern aus Waldorfschulen, dass sie nicht mit Verschwörungspredigern in einen Topf geworfen werden wollen und selbstverständlich Sicherheitsstandards an den Schulen befürworten.
[2] Zum 1. Januar 1871 traten die süddeutschen Staaten Baden, Hessen-Darmstadt (mit seinen Gebieten südlich der Mainlinie), Württemberg und Bayern infolge der Novemberverträge von 1870 dem von Preußen dominierten Norddeutschen Bund bei, der für kurze Zeit zum „Deutschen Bund“ wurde. Ebenfalls am 1. Januar 1871 trat die neue Bundesverfassung in Kraft. Dadurch wurde der föderale deutsche Staat erheblich ausgedehnt, zum neu geschaffenen Deutschen Reich. Als Reichsgründungstag gefeiert wurde mit dem 18. Januar dann jedoch der Tag, an dem der preußische König Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert worden war. – D. Red.