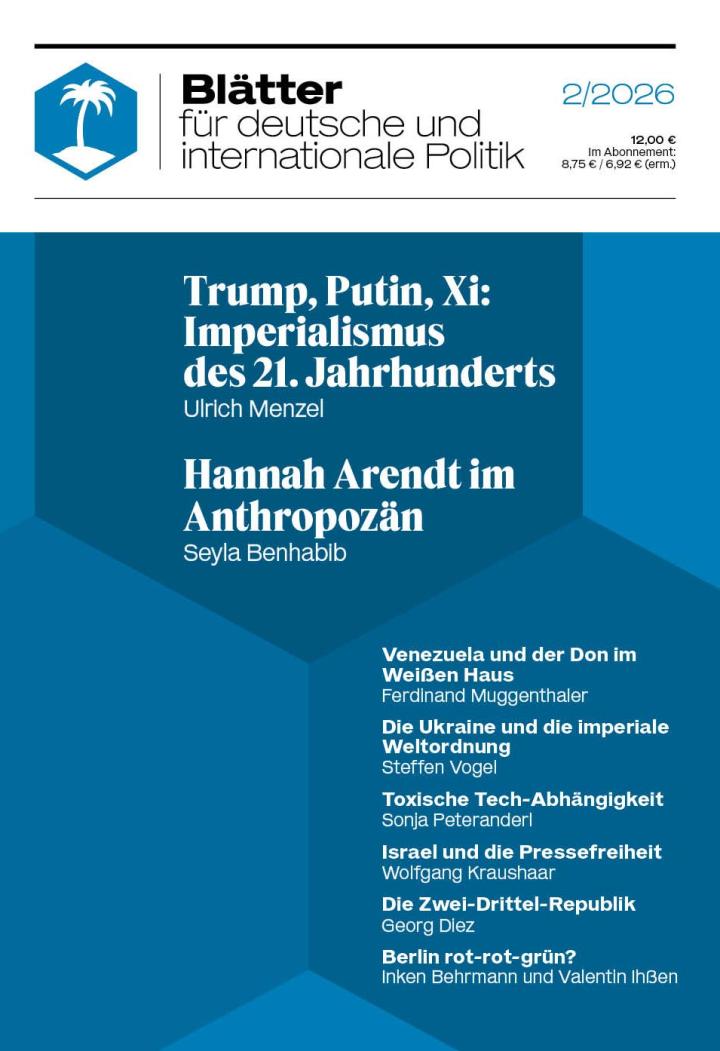Wie wir das rassistische System abschaffen

Bild: imago images / ZUMA Wire
Die brutale Tötung George Floyds, eines 46jährigen schwarzen Mannes, begangen von vier Polizisten der Stadt Minneapolis, hat einen landesweiten Aufstand entfacht. Diese Proteste lösen Erschütterung, Euphorie, Sorgen, Angst und Solidaritätserklärungen aus. Allein ihr Umfang ist erstaunlich. Überall in den Vereinigten Staaten, in großen wie in kleinen Städten, strömten junge Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkunft auf die Straßen, Menschen, die die Nase voll haben. Es handelt sich um den größten Aufstand seit den Riots in Los Angeles im Jahr 1992. Die Wut und Erbitterung über rassistische und hemmungslose Polizeigewalt, Machtmissbrauch und sogar Mord brechen sich schließlich Bahn, und zwar landesweit.
Um die Rebellion zu unterdrücken, wurden mehr als 17 000 Nationalgardisten eingesetzt – mehr amerikanische Soldaten, als gegenwärtig im Irak und in Afghanistan stationiert sind. Mehr als 10 000 Menschen wurden verhaftet, mindestens zwölf Menschen getötet (die meisten von ihnen sind männliche Afroamerikaner). Ausgangssperren wurden in mehr als 30 Städten erlassen, darunter New York, Chicago, Philadelphia, Omaha und Sioux City. Von Accra bis Dublin wurden Solidaritätsdemonstrationen organisiert, in Berlin, Paris, London und noch vielen anderen Orten. Und am erstaunlichsten ist wohl, dass die Proteste auch noch Wochen nach dem Tod George Floyds anhielten. Zehntausende versammelten sich auf der Nationalpromenade in Washington oder zogen durch die Straßen von Brooklyn und Philadelphia.
Der unaufhaltsame Zorn und die Wucht des Aufstands zwangen die Bundesstaaten dazu, ihre wenig wirksamen Bemühungen, das Coronavirus unter Kontrolle zu bekommen, einzustellen, obwohl weiterhin Tausende Menschen in den Vereinigten Staaten erkranken. Die Führungsriegen auf nationaler und bundesstaatlicher Ebene haben sich deutlich versierter darin gezeigt, die Nationalgarde in Bewegung zu setzen und polizeiliche Maßnahmen gegen die Protestierenden miteinander abzustimmen, als bei irgendeinem ihrer Versuche, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Donald Trump drohte, dem US-Militär zu befehlen, amerikanische Städte zu besetzen, was ebenso von Feigheit wie von Autoritarismus zeugt. Der Ausdruck „Krise“ ist viel zu schwach für den politischen Mahlstrom, der entfesselt wurde.
Es gab geplante Demonstrationen, und es kam zu gewaltsamen und explosionsartigen Ausbrüchen, die nur als Revolte oder Aufstand bezeichnet werden können. Der Aufruhr ist nicht nur die Stimme der Ungehörten, wie Martin Luther King einst sagte. Er ist der chaotische Auftritt der Unterdrückten auf der politischen Bühne. Er wird zu einem politischen Schauspiel, in dem Freude, Abscheu, Trauer, Wut und Erregung aufeinander prallen und sich in einem wilden kathartischen Tanz vermischen. Er ist ein Festspiel der Unterdrückten. Einmal in ihrem Leben werden die Mitwirkenden sichtbar, hörbar, bemerkt. Menschen werden von den Rändern zu einer machtvollen Kraft zusammengezogen, die nicht länger ignoriert, geschlagen oder achtlos beiseite geschoben werden kann. Der Aufruhr bietet einen Vorgeschmack auf echte Freiheit, wenn die Polizei wenigsten einmal vor der Menschenmenge Angst haben muss. Er kann zerstörerisch, unbändig, gewaltsam und unberechenbar sein. Aber in diesem widersprüchlichen Wirrwarr entstehen Forderungen und Sehnsüchte auf eine Gesellschaft, die sich von unserer gegenwärtigen unterscheidet. Die Rebellen drücken nicht nur ihre eigene Frustration aus, sondern sie führen uns das ganze gesellschaftliche Dilemma vor Augen. Über die Aufstände Ende der 1960er Jahre sagte Martin Luther King: „Ich bin nicht traurig darüber, dass die schwarzen Amerikaner rebellieren. Es war nicht nur unvermeidlich, sondern es ist überaus wünschenswert. Ohne diese wunderbare Unruhe unter den Negroes wären die alten Ausflüchte und Verzögerungen endlos weitergegangen. Die Schwarzen haben die Vergangenheit der dumpfen Passivität ein für alle Mal begraben. Mit Ausnahme der Reconstruction-Ära [nach Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1865, d.Ü.] haben sie in ihrer langen Geschichte auf amerikanischem Boden noch nie mit solcher Kreativität und mit so viel Mut für ihre Freiheit gekämpft. Dies sind unsere hoffnungsvollen Jahre des Aufbruchs; auch wenn sie schmerzhaft sind, lassen sie sich nicht vermeiden.“ King fuhr fort: „Die schwarze Revolution ist viel mehr als ein Kampf für die Rechte der Negroes. Sie zwingt Amerika, sich all seinen miteinander verbundenen Fehlern zu stellen – Rassismus, Armut, Militarismus und Materialismus. Sie deckt die Übel auf, die tief in der Gesamtstruktur unserer Gesellschaft verwurzelt sind. Was sie enthüllt, sind keine oberflächlichen Fehler, sondern strukturelle, und sie legt nahe, dass der radikale Umbau der Gesellschaft das eigentliche Problem ist, dem wir uns stellen müssen.“
Inzwischen sollte klar sein, was die jungen Schwarzen fordern: das Ende von Rassismus, Diskriminierung und Gewalt durch die Polizei, und das Recht, frei von wirtschaftlichem Zwang durch Armut und Ungleichheit zu sein. Die Frage ist: Wie können wir dieses Land verändern? Das ist keine neue Frage; für Afroamerikaner ist es eine Frage, die so alt ist wie die Nation selbst. Die Ursache dafür, dass Rebellen mit geballten Fäusten und ausdrucksstarken Augen auf die Straßen drängen, liegt zu einem Gutteil an der Weigerung oder der Unfähigkeit dieser Gesellschaft, sich dieser Frage in befriedigender Weise anzunehmen. Stattdessen werden jene, die diese Frage stellen, mit wohlklingenden Reden bevormundet – Reden voller gewundener Entschuldigungen, oft durchsetzt mit Rezitationen über die Bedeutung Amerikas, und letztlich Verteidigungen des Status quo. Der herrschenden Politik mangelt es offensichtlich an Intellekt und Vorstellungskraft, ihre Leitideen sind durchdrungen von Banalität. Alte, gescheiterte Vorschläge werden wieder aufgewärmt, aber dabei als neu proklamiert, was wiederum Zynismus und Bestürzung auslöst.
Nehmen wir die jüngsten Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama. Auf Twitter riet er: „Echter Wandel erfordert Protest, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, und Politik, um praktische Lösungen zu finden und in Gesetze umzusetzen.“ Er fuhr fort: „Es gibt spezifische, evidenzbasierte Reformen, die Vertrauen schaffen, Leben retten und auch zu einem Rückgang der Kriminalität führen würden.“ Dazu zählt Obama auch die Empfehlungen, die seine 2015 gebildete Task Force namens „Polizeiarbeit des 21. Jahrhunderts“ entwickelte. Aber dieser einfache, klar formulierte Plan kann die grundlegendste Frage nicht beantworten: Warum scheitern die Polizeireformen wiederholt? Seit den Unruhen in Chicago im Jahr 1919 demonstrieren Afroamerikaner immer wieder gegen Polizeigewalt. Zum ersten Riot als unmittelbare Reaktion auf Misshandlungen durch die Polizei kam es im Jahr 1935 in Harlem. 1951 versuchte eine Gruppe afroamerikanischer Aktivisten die Vereinten Nationen dazu zu bewegen, den Mord der US-Regierung an Schwarzen anzuprangern. In ihrer Petition mit dem Titel „Wir klagen wegen Völkermord an“ heißt es: „Einst war die übliche Methode des Lynchens der Strick. Heute ist es die Kugel des Polizisten. Für viele Amerikaner ist die Regierung die Polizei, mit Sicherheit ist sie ihr sichtbarster Vertreter. Wir behaupten, dass Indizien darauf hinweisen, dass das Töten von Negroes zu einer Strategie der Polizei geworden ist, und dass diese konkrete Strategie der Polizei nur ein Ausdruck der Strategie der Regierung ist.“
Die Riots von 1992 bis heute
Weil eine Antwort darauf bis heute ausgeblieben ist, weil „praktische Lösungen“ gegen die Schläge, Belästigungen und Morde noch immer fehlen, treibt es die Menschen auf die Straße, um die etablierte Herrschaft der Polizei in den schwarzen Stadtvierteln herauszufordern. Viele Kommentatoren haben die gegenwärtige Revolte mit den urbanen Aufständen der 1960er Jahre verglichen. Tatsächlich hat sie mehr gemein mit dem Aufstand in Los Angeles 1992 und den Protesten, die er im übrigen Land auslöste. Er entstand aus der frustrierenden Mischung aus wachsender Armut, Gewalt durch den Drogenkrieg und zunehmender Arbeitslosigkeit. Bis 1992 hatte die offizielle Arbeitslosigkeit der Schwarzen einen Höchststand von 14 Prozent erreicht, mehr als doppelt so hoch wie die unter weißen Amerikanern. Im Viertel South Central in Los Angeles, wo der Aufstand seinen Anfang nahm, waren über die Hälfte der Menschen über sechzehn Jahren arbeitslos oder nicht erwerbstätig. Es war eine Mischung aus Polizeibrutalität und der Straflosigkeit für eine Gewalttat gegen ein schwarzes Kind, die die Zündschnur schließlich in Brand setze.
Wir erinnern uns heute daran, dass der schwarze Autofahrer Rodney King am 3. März 1991 von vier Polizeibeamten aus Los Angeles am Rande der Autobahn zusammengeschlagen wurde. Zu der Geschichte gehört aber auch, dass zwei Wochen später eine fünfzehnjährige Schwarze namens Latasha Harlins von Soon Ja Du, der Besitzerin eines Gemischtwarenladens, in den Kopf geschossen wurde. Zuvor hatten sie sich darüber gestritten, ob Harlins für eine Flasche Orangensaft zahlen würde oder nicht. Die Geschworenen befanden Du des Totschlags für schuldig und empfahlen die Höchststrafe. Aber der Richter war anderer Meinung und verurteilte Du zu fünf Jahren Bewährung, gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von fünfhundert Dollar. Die Rebellion in Los Angeles begann am 29. April 1992, als die Polizeibeamten, die King geschlagen hatten, unerwartet freigesprochen wurden. Die Revolte wurde aber auch dadurch angefacht, dass eine Woche zuvor ein Berufungsgericht die geringere Strafe für Du bestätigt hatte.
Unmittelbar nach dem Urteil versammelte sich eine multiethnische Menschenmenge vor dem Hauptquartier der Polizei von Los Angeles. Die Demonstranten riefen: „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden!“ und „Schuldig!“. Als Menschen in South Central auf die Straßen strömten, versuchte die Polizei zunächst, sie festzunehmen, bevor die Einsatzkräfte erkannten, dass sie überfordert waren und den Ort verließen. Die „L.A. Times“ berichtete, dass später an der Ecke 71st/Normandie Street „zweihundert Menschen die Kreuzung säumten, viele mit erhobenen Fäusten. Asphalt- und Betonbrocken wurden auf Autos geworfen. Einige schrien: ‚Es ist eine schwarze Sache!‘ Andere riefen: ‚Das ist für Rodney King!‘“ Am Abend brannten mehr als 300 Feuer in der ganzen Stadt, in Polizeipräsidien und im Rathaus, im Stadtzentrum und in den weißen Vierteln Fairfax und Westwood. In Atlanta riefen Hunderte von schwarzen Jugendlichen „Rodney King“, als sie Schaufenster im Geschäftsviertel der Stadt einschlugen. In Nordkalifornien verließen siebenhundert Schüler der Berkeley High School aus Protest ihre Klassen. Innerhalb von nur fünf Tagen entwickelten sich die Ausschreitungen in Los Angeles zum größten und zerstörerischsten Aufstand in der Geschichte der USA – mit 63 Toten, einer Milliarde Dollar Sachschaden, fast 2400 Verletzten und 17 000 Verhaftungen. Präsident George Bush sen. berief sich auf den Insurrection Act, um Einheiten der US-Marines und der Armee zur Niederschlagung der Rebellion zu mobilisieren. Ein Schwarzer namens Terry Adams sprach mit der „L.A. Times“ und brachte die Stimmung auf den Punkt. „Unser Volk leidet“, sagte er. „Warum sollten wir uns von Gewalt abgrenzen? Das Justizsystem tut das nicht.“ Der Aufruhr von Los Angeles ähnelte den Aufständen in den 1960er Jahren, insofern er durch Misshandlungen durch die Polizei ausgelöst wurde, Gewalt weit verbreitet und die Aufständischen wütend waren. Aber in den 1960er Jahren prosperierte die Wirtschaft und das Leitbild eines sozialen Ausgleichs war noch ungebrochen. Daher versuchte Präsident Lyndon B. Johnson auch, die Bürgerrechtsbewegung und die Radikalisierung unter dem Schlagwort „Black Power“ mit enormen Sozialausgaben und einer Ausweitung von Regierungsprogrammen einzudämmen. Dazu gehörte beispielsweise der Housing and Urban Development Act von 1968. Das Gesetz war der erste Versuch der Regierung, einkommensschwachen Afroamerikanern die Möglichkeit zu verschaffen, Wohneigentum zu erwerben.
Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre dagegen befand sich die Wirtschaft in einer Rezession und der Sozialvertrag war in Stücke gerissen worden. Die Aufstände der 1960er Jahre und die enormen Sozialausgaben, mit denen sie unter Kontrolle gebracht werden sollten, wurden nun von der Rechten angeführt, um den Sozialstaat anzugreifen. Die Konservativen argumentierten, dass der Markt und nichtstaatliche Interventionen öffentliche Dienstleistungen effizienter und innovativer bereitstellen könnten. Diese Rhetorik ging oft einher mit rassistischen Beschreibungen von Afroamerikanern, die sich angeblich unverhältnismäßig stark auf die Wohlfahrtsprogramme verließen. Ronald Reagan beherrschte die Kunst des farbenblinden Rassismus in der Ära nach der Bürgerrechtsbewegung perfekt, wenn er von „Welfare Queens“[1] sprach. Solche Zerrbilder ebneten nicht nur den Weg, um den Sozialstaat zu untergraben, sie verstärkten auch rassistische Wahnvorstellungen über den Zustand des schwarzen Amerika, mit denen die Verarmung und Marginalisierung gerechtfertigt wurden.
»Law and Order«: Wie der Sozialvertrag in Stücke gerissen wurde
Der Aufstand von Los Angeles entblößte nicht nur den Polizeistaat, dem die Afroamerikaner unterworfen waren. Er offenbarte auch, wie es um den Zustand der US-Wirtschaft nach den vermeintlichen ökonomischen Patentrezepten der Reagan-Revolution tatsächlich bestellt war. Die Aufstände der 1960er Jahre wurden als „Rassenunruhen“ verunglimpft, weil sie fast ausschließlich auf die ausgegrenzten schwarzen Bevölkerungsgruppen beschränkt blieben. Der Aufstand in Los Angeles breitete sich rasch in der ganzen Stadt aus: 51 Prozent der Verhafteten waren Latinos, nur 36 Prozent Schwarze. Eine kleinere Anzahl von Weißen wurde ebenfalls verhaftet.
Die Politiker hatten den Rassismus als Brechstange benutzt, um den Sozialstaat einzureißen, aber die Folgen waren auf breiter Front spürbar. Obwohl unter den Afroamerikanern unverhältnismäßig viele Sozialhilfeempfänger waren, stellten die Weißen deren Mehrheit, und auch sie litten unter den Kürzungen. Willie Brown, der damalige Vorsitzende des California State Assembly, schrieb Tage nach dem Aufstand im „San Francisco Examiner“: „Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte waren viele der Demonstrationen und ein Großteil der Gewalt und Kriminalität, insbesondere der Plünderungen, ethnienübergreifend – Schwarze, Weiße, Hispanoamerikaner und Asiaten waren alle beteiligt.“ Üblicherweise lebten diese Bevölkerungsgruppen abgesondert voneinander. Dennoch gelang es all diese Gruppen, in der wütenden Revolte gegen die Polizei von Los Angeles die Missstände anzuprangern, unter denen sie litten und die sich durchaus überschnitten.
Nach dem Aufstand in Los Angeles gab es keine neuen Initiativen, um die Lebensverhältnisse der Menschen zu verbessern, die rebelliert hatten. Im Gegenteil, der Sprecher der Regierung George Bushs, Marlin Fitzwater, machte die Sozialhilfeprogramme früherer Regierungen für den Aufstand verantwortlich: „Wir glauben, dass viele der eigentlichen Ursachen für die innerstädtischen Schwierigkeiten in den 60er und 70er Jahren begonnen wurden und dass [die Sozialprogramme] gescheitert sind.“ In den 1990er Jahren näherten sich die politische Rechte und die Demokratische Partei einander an. Die Demokraten vertraten zunehmend eine ähnliche Agenda: Sie propagierten massive Kürzungen bei den Sozialprogrammen und beharrten darauf, die Not unter den Afroamerikanern auf Familienstrukturen zurückzuführen, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprachen. Im Mai 1992 unterbrach Bill Clinton seine eigentlich geplanten Wahlkampftätigkeiten, um nach South Central Los Angeles zu reisen, wo er seine Analyse dessen präsentierte, was eigentlich schief gelaufen war. Die Menschen plünderten, sagte er, „weil sie überhaupt nicht mehr Teil des Systems sind. Sie teilen nicht unsere Werte, und ihre Kinder wachsen in einer Kultur auf, die unserer fremd ist, ohne Familie, ohne Nachbarschaft, ohne Kirche, ohne Unterstützung“.
Die Demokraten reagierten auf den Aufstand von Los Angeles 1992, indem sie das Justizsystem des Landes immer stärker auf Strafe und Vergeltung ausrichteten. Joe Biden, der derzeitige Spitzenkandidat der Demokraten für die Präsidentschaft, präsentierte damals ein neues „Kriminalitätsgesetz“. Dieses Gesetz versprach hunderttausend weitere Polizisten auf der Straße, es sah für bestimmte Verbrechen obligatorische Gefängnisstrafen vor, erhöhte die finanziellen Mittel für Polizei und Gefängnisse und weitete die Todesstrafe aus. Die neue Betonung von Recht und Ordnung durch die Demokraten ging mit einem unerbittlichen Angriff auf das Recht auf Sozialhilfe einher. Bis zum Jahr 1996 hatte Clinton dann sein Versprechen eingelöst, „die Sozialhilfe, wie wir sie kennen, zu beenden“. Biden unterstützte diese Gesetze mit dem Argument, dass „die Kultur der Wohlfahrt durch die Kultur der Arbeit ersetzt werden muss. Die Kultur der Abhängigkeit muss durch die Kultur der Selbstversorgung und Eigenverantwortung ersetzt werden. Und die Kultur der dauerhaften Abhängigkeit darf nicht länger ein Lebensstil sein.“
Die Strafgesetze von 1994 trieben die Masseninhaftierungen voran und förderten die Akzeptanz von aggressiven polizeilichen und strafrechtlichen Methoden gegenüber der afroamerikanischen Bevölkerung. Diese Gesetze haben jene Welt mitaufgebaut, gegen die junge Schwarze heute rebellieren. Aber auch die unaufhörlichen Angriffe auf die Sozialhilfe und Lebensmittelgutscheine haben die jüngste Revolte ausgelöst. Diese Kürzungen sind einer der Hauptgründe dafür, dass die Corona-Pandemie die USA so hart getroffen hat, insbesondere das schwarze Amerika. Sie bilden die Ursache dafür, dass wir in diesem Land über kein tragfähiges soziales Sicherheitsnetz verfügen, wozu auch Lebensmittelgutscheine und Barzahlungen in Krisenzeiten gehören. Die Schwäche des Sozialstaates in den USA hat tiefe historische Wurzeln, aber endgültig zerstört wurde er, als die Demokraten an der Regierung waren.
Das gegenwärtige politische Klima lässt sich nicht auf Lehren aus der Vergangenheit reduzieren. Aber dennoch dominiert das Erbe der 1990er Jahre weiterhin das politische Denken der Volksvertreter. Wenn die Republikaner mitten in einer Pandemie, mit einer Arbeitslosigkeit von mehr als dreizehn Prozent, darauf bestehen, den Bezug von Lebensmittelgutscheinen von der Arbeitsbereitschaft der Empfänger abhängig zu machen, dann beschwören sie erneut den straflüsternen Geist jener Politik herauf, die Clinton, Biden und andere führende Demokraten in den 1990er Jahren vertraten.
Joe Biden – oder: Wie das Erbe der 1990er Jahre unser Denken bestimmt
Joe Biden versucht verzweifelt, uns glauben zu machen, er sei ein Vorbote des gesellschaftlichen Wandels, aber seine lange Geschichte als Amtsträger sagt etwas anderes. Er hat behauptet, dass Barack Obama ihn als Vizekandidaten für die Präsidentschaft aussuchte, sei eine Art Absolution für seine Verwicklung in die hetzerische Politik der Demokraten in den 1990er Jahren. Aber Biden war einer der Architekten des Systems, das die neue Generation geerbt hat und gegen das sie sich nun auflehnt – von den Exzessen des Justizsystems über das Fehlen eines Sozialstaates bis hin zu der Ungleichheit, die aus einer ungezügelten, habgierigen Marktwirtschaft entsteht.
Noch wichtiger als Bidens Vergangenheit ist, dass die Ideen, die in den 1980er und 1990er Jahren verfeinert wurden, weiterhin im Mittelpunkt seiner politischen Agenda stehen. Zu seinen Wahlkampfberatern gehört Larry Summers, der als Finanzminister von Clinton ein begeisterter Befürworter der Deregulierung war. Als Obamas wichtigster Wirtschaftsberater während der Rezession befürwortete Summers den Rettungsplan für die Wall Street, während Millionen von Amerikanern ihre Hypotheken nicht bezahlen konnten. Zu Bidens Beratern gehört auch Rahm Emanuel, dessen Amtszeit als Bürgermeister von Chicago in Schande endete, als bekannt wurde, dass seine Administration den Mord an dem 17jährigen Laquan McDonald vertuscht hatte, auf den ein weißer Polizist sechzehn Mal geschossen hatte. Aber Emanuels schadete Chicago keineswegs nur, indem er sich schützend vor eine besonders rassistische und übergriffige Polizei stellte. Im Jahr 2013 schloss er fünfzig öffentliche Schulen auf einmal, es war die umfassendste Maßnahme dieser Art in der US-amerikanischen Geschichte. Nach zwei Amtszeiten ließ er die Stadt in demselben desaströsen Zustand zurück, in dem er sie vorgefunden hatte – unter anderem mit einer Arbeitslosenquote unter den schwarzen männlichen Schulabgängern von 45 Prozent.
Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass wir die Diskussion über die Missstände, unter denen unser Land leidet, nicht auf den Rassismus und die Brutalität der Polizei beschränken. Wir müssen auch über die ungleichen wirtschaftlichen Lebensverhältnisse sprechen. Diese Verhältnisse überschneiden sich mit der rassistischen und der Geschlechterdiskriminierung. Sie benachteiligen Afroamerikaner und machen sie gleichzeitig anfällig für Polizeigewalt. Wenn wir dies nicht berücksichtigen, laufen wir Gefahr, Rassismus auf empörende und vorsätzliche Handlungen böser Einzelpersonen zu verkürzen, während wir andererseits die kumulativen Wirkungen der staatlichen Politik und der Diskriminierung in der Privatwirtschaft herunterspielen. Unabhängig von individuellen Absichten und Einstellungen lähmen diese Strukturen die Lebenskraft der afroamerikanischen Bevölkerung. Wenn sich die Aufmerksamkeit auf die barbarische Tat verengt, die George Floyd das Leben raubte, können sich der ehemalige Präsident George Bush jun. und seinesgleichen in die Debatte einmischen und behaupten, sie verabscheuten den Rassismus. Bush schrieb in einem offenen Brief über den Mord an Floyd, dass „es ein schockierendes Versagen bleibt, dass viele Afroamerikaner, besonders junge afroamerikanische Männer, in ihrem eigenen Land schikaniert und bedroht werden.“ Dies wäre schlichtweg lächerlich, wäre Bush nicht jener Sensenmann, der sich unter einem Leichentuch versteckt, das er „mitfühlenden Konservativismus“ nennt. Als Gouverneur von Texas beaufsichtigte Bush ein hemmungsloses und rassistisches System der Todesstrafe. Er selbst genehmigte die Hinrichtung von 152 Menschen, von denen unverhältnismäßig viele Afroamerikaner waren. Als Präsident verantwortete er die bemerkenswert inkompetente Reaktion der Regierung auf den Hurrikan Katrina, die zum Tod von fast 2000 Menschen beitrug und zehntausende afroamerikanische Einwohner aus New Orleans vertrieb. Nun äußert sich Bush scheinheilig zum amerikanischen Rassismus und übergeht seinen eigenen Beitrag zu dessen Aufrechterhaltung und Fortbestehen. Dass er dazu in der Lage ist, zeugt von der Oberflächlichkeit der Debatte. Viele haben sich mittlerweile damit angefreundet, Phrasen wie „systemischer Rassismus“ von sich zu geben, aber ihre Lösungsvorschläge bleiben dennoch innerhalb jenes Systems stecken, das sie kritisieren. So bleiben die Ursachen von Unterdrückung und Ungleichheit – die Wurzeln des „rassistischen Kapitalismus“, wie viele Aktivistinnen und Aktivisten es nennen – unangetastet.
Joe Biden kam kürzlich für einen seiner seltenen öffentlichen Auftritte nach Philadelphia, um zu erklären, mit welcher Art von politischer Führung wir aus der gegenwärtigen Situation herauskommen. Seine Rede klang so, dass er sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt in den vergangenen zwanzig Jahren hätte halten können. Er unterbreitete den Vorschlag, polizeiliche Würgegriffe zu verbieten – obwohl viele Polizeibehörden sie bereits untersagt haben, zumindest auf dem Papier. Die New Yorker Polizei ist eine dieser Behörden, aber das hat weder den Polizisten Daniel Pantaleo davon abgehalten, Eric Garner zu ersticken, noch führte es dazu, dass Pantaleo dafür ins Gefängnis kam. Biden forderte Rechenschaftspflichten, Aufsicht und community policing. Solche Vorschläge zur Eindämmung rassistischer Polizeiarbeit sind so alt wie die ersten Reformversprechen der Kerner-Kommission aus dem Jahr 1967. Auch damals gingen die Städte des Landes in einer Serie wütender Aufstände in Flammen auf, und Politiker auf der Bundesebene nannten ähnliche Maßnahmen, um die Polizeiarbeit zu verändern. Mehr als 50 Jahre später ist die Polizei immer noch immun gegen Reformversuche und verweigert oft sogar, sich der Politik unterzuordnen. Es ist kaum zu fassen, dass Joe Biden nicht eine einzige durchgreifende oder neue Idee anzubieten hat, um die Polizei unter Kontrolle zu bekommen.
In einem Essay nennt Barack Obama die Stimmabgabe bei Wahlen als Methode, um „echten Wandel“ zu erreichen. Allerdings schreibt er auch: „Wenn wir einen echten Wandel herbeiführen wollen, dann besteht die Wahl nicht zwischen Protest und Politik. Wir brauchen beides. Wir müssen mobilisieren, um das Bewusstsein zu schärfen, und wir müssen organisieren und wählen gehen, um sicherzustellen, dass die Kandidaten gewinnen, die sich für Reformen einsetzen.“[2] Obama hat sich angewöhnt, in politische Debatten einzugreifen, als sei er ein neugieriger und distanzierter Beobachter und nicht der ehemaliger Träger des mächtigsten Amtes der Welt. Die Bewegung Black Lives Matter gewann in den letzten Jahren von Obamas Präsidentschaft an Stärke. Während all ihrer Entwicklungsphasen zeigte sich Obama unfähig, gegen jene Misshandlungen durch die Polizei einzuschreiten, die Black Lives Matter antrieben. Natürlich besteht immer die Gefahr, an den Feinheiten des Föderalismus und den Schranken zu scheitern, die einer Zentralregierung gesetzt sind, denn Polizeigewalt ist ein ausgesprochen lokales Problem. Immerhin berief Obama eine nationale Task Force, die Ratschläge und Richtlinien entwickeln sollte, um die Rechenschaftspflichten der Polizei zu verschärfen. Daher können wir ihre Erfolge aus heutiger Sicht beurteilen.
Die Ohnmacht der Politik gegenüber der Polizei
Obamas Task Force „Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert“ veröffentlichte 63 Empfehlungen, darunter die Abschaffung von racial profiling und die verstärkte Orientierung auf community policing. Sie forderte eine „bessere Ausbildung“ und eine Reform des gesamten Justizsystems. Aber dabei handelte es sich um bloße Anregungen; es gab keinen Mechanismus, um die 18 000 Strafverfolgungsbehörden des Landes dazu zu bewegen, sich daran zu halten. Der Zwischenbericht der Task Force wurde am 2. März 2015 veröffentlicht. In diesem Monat tötete die Polizei in den USA insgesamt 113 Menschen, 30 mehr als im Vormonat. Am 4. April wurde in North Charleston in South Carolina Walter Scott, ein unbewaffneter schwarzer Mann, der vor einem weißen Polizisten namens Michael Slager davonlief, fünfmal von hinten erschossen. Acht Tage später wurde Freddie Gray von der Polizei in Baltimore aufgegriffen, in einen Transporter ohne Gurte gesetzt und rücksichtslos durch die Stadt gefahren. Als er aus dem Lieferwagen kam, war seine Wirbelsäule am Hals zu 80 Prozent durchtrennt. Er starb sieben Tage später. Baltimore explodierte vor Wut. Und Baltimore ist nicht wie Ferguson, Missouri, das von einem weißen politischen Establishment dominiert wird und in dem eine weiße Polizei auf Streife geht. Baltimore wird von Schwarzen verwaltet und regiert, angefangen von der Bürgermeisterin Stephanie Rawlings-Blake bis hin zu der multiethnischen Polizeibehörde.
Obwohl die mutwillige Gewalt durch die Strafverfolgungsbehörden in den vergangenen fünf Jahren stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt ist, hat dies kaum Auswirkungen auf die Mittelzuweisungen in den kommunalen Haushalten. Die Polizei absorbiert nach wie vor absurd hohe Anteile der kommunalen Budgets – selbst Behörden, die einen Anlass zur Scham bieten und für Gerichtsverfahren wegen Misshandlungen sorgen. In Los Angeles, einer Stadt mit einem zerrütteten Wohnungsmarkt, massiver Obdachlosigkeit und ungebremsten Mietsteigerungen, zieht die Polizei erstaunliche 53 Prozent des Gesamthaushalts der Stadt auf sich. Chicago gibt 39 Prozent seines Haushalts für eine notorisch korrupte und brutale Polizei aus. Der laufende Haushalt von Philadelphia musste wegen des Einbruchs bei den Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie neu berechnet werden. Die einzige Behörde, die keine Budgetkürzungen hinnehmen muss, ist die Polizei. Öffentliche Schulen, Maßnahmen für bezahlbaren Wohnraum, Programme zur Gewaltprävention und das Aufsichtsgremium der Polizei sollen 370 Mio. US-Dollar einsparen. Aber es ist vorgesehen, dass das Philadelphia Police Department, das bereits jetzt über 16 Prozent der städtischen Mittel verfügt, weitere 23 Mio. Dollar erhält. Die Regierungen von Obama und Trump sind zu keinem Zeitpunkt gegen die rassistischen Polizeipraktiken vorgegangen. Dieses Versäumnis wurde dadurch verschlimmert, dass die afroamerikanische Bevölkerung wirtschaftlich auf der Stelle tritt, was an der stagnierenden Wohneigentumsquote und dem wachsenden Gefälle bei den Vermögen zwischen den ethnischen Bevölkerungsgruppen deutlich wird. Sind diese staatlichen und politischen Versäumnisse allein Obamas Schuld? Natürlich nicht, aber wenn jemand große Versprechungen auf Wandel macht und dann einen brutalen Status quo verwaltet, werden die Menschen ihre eigenen, düsteren Schlussfolgerungen aus diesem Experiment ziehen. Viele arme Afroamerikaner aus der Arbeiterklasse sind immer noch enorm stolz auf den ersten schwarzen Präsidenten und seine Gattin Michelle Obama. Aber ihre Schlussfolgerung lautet, dass seine Präsidentschaft Amerika niemals ändern konnte. Wir können das Versagen der Obama-Regierung sogar als einen der kleinen Zündfunken interpretieren, die die Nation in Brand gesetzt haben.
Wie wir die Vereinigten Staaten neu gestalten
Wir können nicht „echten Wandel“ in den Vereinigten Staaten einfordern und weiter auf die gleichen Methoden, Argumente und gescheiterten politischen Strategien setzen, die uns in diese Lage gebracht haben. Wir dürfen nicht zulassen, dass der gegenwärtige Schwung durch eine verkürzte Diskussion über eine Reform der Polizei verloren geht.
Obama schreibt in seinem Essay: „Ich sah heute ein Interview mit einer älteren schwarzen Frau, die in Tränen war, weil der einzige Lebensmittelladen in ihrer Nachbarschaft verwüstet wurde. Wenn es eine Lehre aus der Geschichte gibt, dann die, dass es Jahre dauern kann, bis dieser Laden zurückkehrt. Wir dürfen Gewalt nicht entschuldigen, sie nicht rationalisieren oder an ihr teilnehmen.“ Wenn wir solche Probleme in ihren Grundzügen oder auch systematisch durchdenken, dann fragen wir vielleicht: Warum gibt es nur ein einziges Lebensmittelgeschäft in der Nachbarschaft dieser Frau? Diese Frage würde uns zu der Geschichte der Segregation in diesem Wohnviertel bringen, zu der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt und zu der örtlichen Schule, die nicht über ausreichende Ressourcen verfügt. Dies wiederum würde uns eine Ahnung von der Entfremdung vermitteln, die so tief wurzelt und so stark empfunden wird, dass sie Menschen dazu bringt, mit der Intensität eines Aufstands zu kämpfen, um Veränderungen zu fordern. Und an dieser Stelle wird es unangenehm: Denn unsere Gesellschaft kann diese Zustände nicht ohne massive finanzielle Ausgaben abschaffen.
King sagte 1968, wenige Wochen vor seiner Ermordung: „In gewisser Weise, könnte man vielleicht sagen, betreiben wir Klassenkampf.“ Er bezog sich auf die Kosten der Programme, die notwendig wären, um Schwarze aus Armut und Ungleichheit zu befreien, die wesentlichen Kennzeichen der rassistischen Unterdrückung. Die Rassentrennung im Süden zu beenden, war billig im Vergleich zu den enormen Kosten, die notwendig waren, um die Diskriminierungen zu beenden, die die Schwarzen von den Vorteilen der US-Gesellschaft ausschloss – gut bezahlte Arbeit, gut ausgestattete Schulen, gute Wohnungen und einen angenehmen Ruhestand. Dieser Preis klingt ziemlich happig, aber wenn wir ernsthaft darüber sprechen wollen, wie wir Amerika verändern, müssen wir zunächst das Ausmaß der Benachteiligung offen und ehrlich aussprechen. Rassistische und korrupte Polizeiarbeit ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Wir brauchen Raum für eine neue Politik, neue Ideen, neue Konstellationen und neue Leute.
Die Wahl von Biden zum Präsidenten mag das Elend der Präsidentschaft von Donald Trump beenden. Sie wird aber nicht die tieferliegenden Probleme lösen, die für über hunderttausend Covid-19-Tote oder die anhaltenden Proteste gegen die Übergriffe der Polizei verantwortlich sind. Wird die Regierung in Washington eingreifen, um die Zwangsräumungen zu stoppen, von denen schwarze Frauen überdurchschnittlich häufig betroffen sind? Wird sie ihre Macht und Autorität nutzen, um die Polizei zu bestrafen und die Gefängnisse und Haftanstalten zu leeren, die nicht nur den sozialen Tod herbeiführen, sondern wo auch Covid-19-Infektionen grassieren? Wird sie die ständigen Angriffe auf das System der Lebensmittelmarken einstellen und Afroamerikanern und den anderen Einwohnern dieses Landes inmitten der schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression erlauben, zu essen? Wird sie die medizinische Versorgung der Dutzenden Millionen Afroamerikaner finanzieren, die besonders anfällig für die schlimmsten Folgen des Coronavirus sind und infolgedessen sterben? Wird sie die Mittel für die heruntergekommenen öffentlichen Schulen bereitstellen, damit schwarze Kinder die Möglichkeit haben, in Frieden zu lernen? Wird sie Hunderte von Milliarden Dollar umverteilen, die notwendig sind, um die verwüsteten Communities der Arbeiterschaft wieder aufzubauen? Wird es kostenlose Kinderbetreuung und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr geben?
Wenn wir den Rassismus wirklich beenden und die USA grundlegend umgestalten wollen, dann müssen wir mit einer echten und ernsthaften Bewertung der Probleme beginnen. Wir greifen zu kurz, wenn wir weiter an jene Repräsentanten und Akteure appellieren, die diese Krise angeheizt haben, obwohl sie die Möglichkeit hatten, zu ihrer Lösung beizutragen. Noch wichtiger ist aber, dass die Aufgabe, das Land zu transformieren, nicht nur darin besteht, eine brutale Polizei in ihre Schranken zu weisen. Wir müssen die Logik überwinden, Polizei und Gefängnisse auf Kosten von öffentlichen Schulen und Krankenhäusern zu finanzieren. Die Polizei sollte nicht mit teurer Artillerie ausgerüstet sein, um Zivilisten zu verstümmeln und zu ermorden, während Krankenschwestern Müllsäcke um ihre Körper binden und Masken wiederverwenden, in dem vergeblichen Bemühen, sich das Coronavirus vom Leib zu halten.
Wir verfügen über die Mittel, um die Vereinigten Staaten neu zu gestalten, aber das wird auf Kosten der Oligarchen und Ausbeuter gehen müssen, und darin besteht das 300 Jahre alte Rätsel: Amerika nimmt die Werte des Lebens, der Freiheit und des Strebens nach Glück für sich in Anspruch. Dieser Anspruch wird aber immer wieder zunichte gemacht durch die Wirklichkeit von Schulden, Verzweiflung und der Erniedrigung durch Rassismus und Ungleichheit. Die Revolte, die sich gerade in den USA entfaltet, bietet eine echte Chance auf Veränderung. Die Bewegung erinnert an die gescheiterten historischen Versuche, gegen den Rassismus und die Polizeibrutalität anzugehen. Aber die Proteste gehen darüber hinaus. Im Gegensatz zum Aufstand in Los Angeles, bei dem koreanische Geschäfte angegriffen wurden und einige weiße Zuschauer verprügelt wurden, und anders als bei den Rebellionen der 1960er Jahre, die sich auf schwarze Viertel beschränkten, ist die multiethnische Solidarität der aktuellen Proteste atemberaubend. In den weißesten Bundesstaaten des Landes, darunter Maine und Idaho, gab es Proteste, an denen Tausende von Menschen beteiligt waren. Und es waren nicht nur Studierende oder Aktivisten. Die Forderung nach einem Ende der rassistischen Gewalt mobilisiert ein breites Spektrum gewöhnlicher Menschen, die es satt haben.
Die Proteste bauen auf der beeindruckenden Basisarbeit von Black Lives Matter auf. Junge Weiße protestieren heute nicht nur aus Furcht vor politischer Instabilität in diesem Land oder aus Angst wegen ihrer schwindenden Zukunftsaussichten, sondern auch, weil sie die Vorherrschaft der Weißen und die Fäulnis des Rassismus verabscheuen. Die antirassistische Politik der Black-Lives-Matter-Bewegung der vergangenen Jahre hat ihre Sichtweise geprägt. Sie betrachtet Rassismus nicht als zwischenmenschliches Problem oder eine Frage der Einstellung, sondern geht darüber hinaus und kommt zu der Einsicht, dass der Rassismus tief in den Institutionen und Organisationen verwurzelt ist. Dies mag zum Teil das starke politische Bewusstsein erklären, das in dieser Runde des Kampfes deutlich wurde. Deshalb waren die Aktivisten und Organisatoren so schnell in der Lage, Unterstützung für die Forderung zu mobilisieren, der Polizei finanzielle Mittel zu entziehen, und in einigen Fällen sogar die Idee in die Debatte einzubringen, die Polizei ganz abzuschaffen. Sie stellten die aufgeblähten Budgets der Polizeibehörden in Zusammenhang mit den Angriffen auf andere Teile des öffentlichen Dienstes, auch mit den geringen Möglichkeiten der Städte, auf die soziale Krise durch die Covid-19-Pandemie zu reagieren. Sie bauen auf den lebhaften Erinnerungen an frühere Misserfolge auf und geben sich nicht mit leeren Forderungen nach Wandel zufrieden. Dies ist ein erneuter Beleg dafür, dass die Kämpfe aufeinander aufbauen und weit mehr sind als nur die Wiederkehr vergangener Ereignisse.
Die Übersetzung des Originalbeitrags aus dem Englischen stammt von Matthias Becker.
[1] Der Ausdruck für erwerbslose Frauen, oft junge Mütter, die auf Staatskosten leben, spielt auf Afroamerikanerinnen an, ohne sie explizit zu nennen (d.Ü.).
[2 Barack Obama, How to Make this Moment the Turning Point for Real Change, www.medium.com, 1.6.2020.