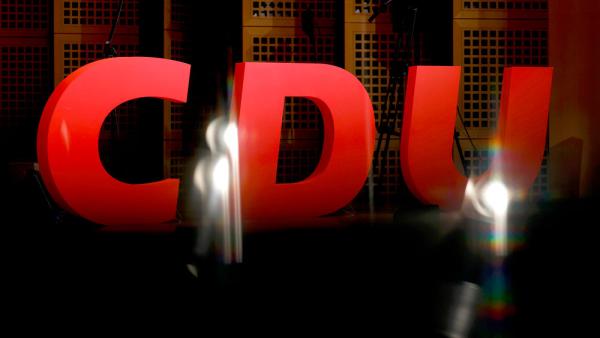Bild: Rekruten und Rekrutinnen anlässlich des 66. Gründungsjahres der Bundeswehr vor der Villa Hammerschmidt in Bonn, 12.11.2021 (IMAGO / Future Image)
Jenseits großer medialer Aufmerksamkeit hat sich an der Helmut-Schmidt-Universität (HSU) Hamburg ein folgenschwerer Wandel vollzogen: Ursprünglich wurde die Uni gegründet, um den zivilen, öffentlich verankerten, akademischen Teil der Ausbildung jener „Bürger in Uniform“ sicherzustellen, die eine Offizierslaufbahn anstreben. Nun aber soll sie, so erklärt es das Bundesministerium für Verteidigung, ein „Militärischer Sicherheitsbereich“ werden. Damit verlöre die Hochschule genau jene Offenheit, die sie bislang auszeichnete, und würde zu einer Kaserne – mit Zugangsbeschränkungen, eingeschränkter Wissenschaftsfreiheit und patrouillierendem Militärpersonal.[1] Dagegen regt sich Widerstand vor allem von Seiten der Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Dozent*innen. Bei dem Konflikt geht es jedoch um mehr als um die Freiheit der Wissenschaft. Vielmehr ist die Entscheidung des Verteidigungsministeriums Ausdruck eines tieferliegenden Problems: Dem Bundeswehrkonzept der „Inneren Führung“ mitsamt seiner gesamtgesellschaftlichen Verankerung wird immer weniger Beachtung geschenkt, während zugleich die Abschottung des Militärs gegenüber der Gesellschaft zunimmt.
Die Absicht des Ministeriums, die Hamburger Bundeswehruniversität als Militärischen Sicherheitsbereich (MSB) einzustufen, reicht bis 2017 zurück. Begründet wird dies weder mit einem konkreten Anlass noch mit einer erhöhten Gefahrenlage, vielmehr soll die Hochschule lediglich an die „allgemeine Gefährdungslage für die Einrichtungen der Streitkräfte“ angepasst werden. „Es soll sich um eine Gefahrenstufe handeln, wie sie offenbar weder auf dem Höhepunkt der RAF-Anschläge in den 1970er Jahren noch in der Zeitspanne unmittelbar nach dem 11. September erreicht wurde. In beiden Fällen dachte niemand daran, die Helmut-Schmidt-Universität aus Sicherheitsgründen dauerhaft nach außen hin abzuriegeln“, kommentierte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ den Vorstoß des Verteidigungsministeriums.[2]
Politisch wie auch symbolisch stellt diese Einstufung einen bemerkenswerten Akt der Militarisierung der akademischen Bildung dar. Denn in sicherheitspolitischer Hinsicht wird die Universität damit formal einer Kaserne gleichgestellt. Doch die HSU ist keine militärische Einrichtung wie beispielsweise Militärakademien, die für die militärische Ausbildung der Soldat*innen zuständig sind. Vielmehr vergibt sie zivile universitäre Abschlüsse unter anderem in erziehungs-, sozial-, politikwissenschaftlichen, historischen sowie technischen Fächern, in denen die angehenden Offizier*innen ausschließlich von zivilen Wissenschaftler*innen ausgebildet werden.
Die Universitätsmitarbeiter*innen verweisen in ihrer Kritik an der militärischen Umwidmung des Campus auf die Autonomie der Hochschule und die Wissenschaftsfreiheit, die sie nunmehr bedroht sehen: Offenheit und allgemeine Zugänglichkeit der Universität seien unabdingbar, um dem Auftrag einer Universität nachkommen zu können, heißt es in einem offenen Brief, der mittlerweile von über 400 Wissenschaftler*innen unterzeichnet wurde.[3] Die Entscheidung stehe nicht nur in einem eklatanten Widerspruch zu den Gründungsprinzipien der Universität. Die Kritiker*innen befürchten auch negative Effekte auf die Organisation von wissenschaftlichen Veranstaltungen, die internationale Vernetzung, Kooperationen und Kommunikation in der Wissenschaftsgemeinschaft.
Unfreie Wissenschaft
Mit der Einrichtung eines MSB gäbe es keinen freien Zugang mehr zum Campus. Personenkontrollen, Besucheranmeldung und -registrierung wären die Regel. Durchsuchungen und das Tragen von Schusswaffen sind bereits erlaubt, eine Waffenkammer soll eingerichtet werden und die Einschränkung der Grundrechte nach Maßgabe des „Gesetzes über die Anwendung unmittelbaren Zwanges“ (UZwGBw) ist jederzeit möglich.
Und obwohl beispielsweise Gastdozent*innen nach den üblichen universitären Gremienverfahren von der Universität ausgewählt werden, wird deren Bestätigung neuerdings mit folgendem Sicherheitshinweis versehen: „Sollten Erkenntnisse zu der Person bekannt werden, die Auswirkungen auf die Militärische Sicherheit haben, ist dies umgehend dem Sicherheitsbeauftragten mitzuteilen.“ Noch weit gravierender ist jedoch, dass Wissenschaftler*innen nunmehr vor Reisen ins nicht-westliche Ausland beim Militärischen Abschirmdienst (MAD) vorstellig werden und Auskunft über Kontakte sowie geplante Treffen vor Ort geben müssen. Mit Wissenschaftsfreiheit haben solche Restriktionen nicht mehr viel zu tun.
Dessen ungeachtet leugnet das Verteidigungsministerium die Einschränkungen der universitären Autonomie durch die Sicherheitsmaßnahmen und verweist zugleich darauf, dass „der Militärischen Sicherheit und insbesondere dem Schutz von Leib und Leben […] im Rahmen der flexiblen Gestaltungshoheit der Vorrang“ einzuräumen sei. Die durchgehende Großschreibung des Begriffs „Militärische Sicherheit“ im Schreiben zeigt an, dass das Bundesministerium der Sicherheit höchste Priorität einräumt, womit gleichsam alle anderen Grundrechte potentiell außer Kraft gesetzt werden können. Die Bedenken der Universität werden dabei als lediglich „gefühlte Einschränkungen“ relativiert.
Allerdings leistet das Ministerium mit dem geplanten Schritt einer militärischen Einhegung und symbolischen Neudefinition eines vormals öffentlichen (Bildungs-)Raums Vorschub, weil die HSU dann primär als militärisch definiertes Hoheitsgebiet gelten würde. Damit wäre jede*r externe Besucher*in unweigerlich verdächtig, ein potentielles Sicherheitsrisiko zu sein. Die mögliche abschreckende Wirkung auf Wissenschaftler*innen nimmt das Ministerium dabei in Kauf. Zugleich wertet es die Bedeutung der zivilen akademischen Bildung der Offiziere im Vergleich zur militärischen Ausbildung ab und verändert damit auch direkt Haltungen und Einstellungen von Soldat*innen. Dass dies keine Petitesse ist, sondern einer politischen Zäsur mit den Reformen der Bundeswehr der 1970er Jahre und dem Gründungskonzept der HSU gleichkommt, zeigt ein historischer Blick auf die Bundeswehruniversitäten.
Ende einer Reformära?
In den 1970er Jahren stieß der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt (1969-1972) gegen die Traditionalisten in Militär und Verteidigungspolitik eine grundlegende militärpolitische Reform an, in deren Folge die beiden Bundeswehruniversitäten in Hamburg und München gegründet wurden. Einen Kerngedanken der Reform bildete die enge Verbindung der „Inneren Führung“ mit dem Bildungsgedanken. Mit dem neuen Führungskonzept in einer demokratisch-rechtsstaatlich legitimierten und gesellschaftlich verankerten Armee sollte die traditionelle „paternalistische Führungskultur der tendenziellen Entmündigung der in der Hierarchie Abhängigen“[4] überwunden werden. Bildung in all ihren Facetten wurde hierbei als entscheidendes Mittel zur Umsetzung des neuen Leitbildes vom „Staatsbürger in Uniform“ erachtet: In Form politischer Bildung für die gesamte Truppe, mit der Modernisierung der Führungsakademie zur Weiterbildung sowie einem wissenschaftlichen zivilen Studium als Novum, das seit 1974 alle angehenden Offiziere neben ihrer militärischen Ausbildung absolvieren müssen.
Gegenüber dem traditionell-konservativen Standesdenken des Militärs, zu dem genuin die Abgrenzung gegen alles „Zivile“ und die Tendenz zur Selbstabschottung, ein Helden- und Männlichkeitskult[5] sowie ein grundständiger Anti-Intellektualismus bzw. eine Bildungsphobie und anti-akademische Ressentiments[6] gehörten, sollte eine klare Trennlinie gezogen werden. Der Bildungsbegriff löste hierbei den Erziehungsbegriff der 1950er Jahre ab,[7] der für die traditionalistische Fortsetzung alter Strukturen sorgte und einer nachhaltigen kulturellen Verankerung der Prinzipien der „Inneren Führung“ entgegenstand. Hierin liegt die systematische Bedeutung des Bildungskonzepts für die Bundeswehrreform der 1970er Jahre und des universitären Studiums, denn nur diese gewährleisteten „eine zeitgemäße Interpretation der Werte der Inneren Führung […], indem Freiheit und Selbstständigkeit des Individuums sowie Konflikt und Konsens der Demokratie zu gültigen Lernzielen der Ausbildung erhoben wurden“ und damit auch Normen gesellschaftlicher Individualisierung „ihren Platz im militärischen Raum finden konnten“.[8]
Damit wird auch deutlich, dass das Ziel der zivilen Bildung für Armeeangehörige gerade in der Differenz zur militärischen Ausbildung besteht und einen entscheidenden Reformimpuls bildet. Denn hierbei werden über fachspezifische Kenntnisse hinaus auch gesellschaftlich relevante Kompetenzen wie kritische Reflexion, Ethik, Entscheidungsautonomie, Kooperations- und Kommunikationskompetenzen mit dem Ziel vermittelt, die Urteils- und Handlungsfähigkeit der Bundeswehrangehörigen zu verbessern. Dies heißt, dass gerade die Erfahrungen, die Studierende auf einem offenen Campus im Austausch mit anderen Kommiliton*innen – an diesem Ort sind sie explizit keine „Kamerad*innen“ – machen, für die Identitäts- und Persönlichkeitsbildung, aber auch für den militärischen Bereich von hoher Relevanz sind. Ein Leitbild lässt sich nicht einfach verordnen, sondern es muss systematisch zu einem Teil einer Organisationskultur gemacht und gelebt werden.
Konservativer Backlash
Mit der von oben verordneten und bürokratisch verfügten Einrichtung eines militärischen Sicherheitsbereichs an der Hamburger Universität schwächt das Verteidigungsministerium dieses Leitbild und die Instrumente seiner Implementierung – und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem die Armee in einer tiefen Krise steckt und eine Rückbesinnung auf die Reform von vor mehr als fünfzig Jahren dringend nötig wäre.
So attestierte die vormalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen dem Heer, nachdem es durch das Bekanntwerden von entwürdigenden Initiationsritualen in der Rekrutenausbildung, dem Fund von NS-Devotionalien in Kasernen und rechtsradikalen Vorfällen in die öffentliche Diskussion geraten war, nicht nur ein grundlegendes „Führungsproblem“, sondern auch einen „falsch verstandenen Korpsgeist“. Der seinerzeit beauftragte Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hob in einem Gutachten zur Situation der „Inneren Führung“ hervor, dass „gravierende Defizite in Führung, Ausbildung, Erziehung sowie Dienstaufsicht festzustellen“ seien.[9]
Dies liegt aber nicht zuletzt daran, dass das Konzept der „Inneren Führung“ bei konservativen Politiker*innen und militärischen Traditionalisten stets umstritten war. Abhängig von Reformkonjunkturen war es immer wieder einer „Reideologisierung des Soldatenberufs“[10] ausgesetzt, die ein „Zuviel“ an ziviler Bildung monierte und stattdessen eine Rückbesinnung auf soldatische Tugenden forderte. Zugleich rufen die gesellschaftlichen Individualisierungs- und Modernisierungsprozesse der vergangenen Jahrzehnte, die schließlich in der vom Europäischen Gerichtshof erzwungenen Öffnung der Streitkräfte für Frauen gipfelten, Gegenbewegungen hervor: So ist in den Reihen junger Offiziere teilweise eine Tendenz zur „Rückkehr des Soldatischen“,[11] mit vermeintlich männlichen Tugenden wie Gehorsam, Opferbereitschaft und Ehre sowie dem Primat des Kampfes als Ziel militärischer Ausbildung zu beobachten, was im Kontext säkularer postheroischer Handlungsimperative in der Gesellschaft auch als neue „Sehnsucht nach dem Heldentum“ gedeutet wird.[12]
Die Prinzipien der Inneren Führung werden in diesem Diskurs als dysfunktional und anachronistisch delegitimiert. Etwa 36 Prozent der Soldaten befürchten etwa einen „Verlust an militärischer Kampfkraft infolge der Integration von Frauen“.[13] Diese Entwicklungen deuten eine doppelte Schließung des Soldatenberufs an: nach innen als Männerdomäne sowie nach außen gegenüber der Gesellschaft.
Mit der Entscheidung, die zivile akademische Ausbildung der Offiziere an der HSU zu militarisieren, verstärkt das Verteidigungsministerium diese Tendenzen noch, anstatt ihnen wirksam zu begegnen. Damit aber verdrängt sie einmal mehr die selbst attestierten Probleme – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für die Verfasstheit der Bundeswehr als einer Parlamentsarmee und damit für die Demokratie.
[1] Vgl. Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, Offener Brief zur Universität der Bundeswehr Hamburg als Offene Hochschule, www.netzwerk-wissenschaftsfreiheit.de, 4.6.2021.
[2] Rolf Wörsdörfer, Studieren in der Gefahrenzone, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 12.5.2021, S. 4.
[3] „Diese Offenheit ist nicht nur für Forschung, Lehre und das studentische Leben an der HSU, sondern auch für die Verankerung der Universität in der Stadt und den Austausch mit verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren von zentraler Bedeutung“ (www.padlet.com/nomsb/tjvfucnxmr9ina6x). Die rechtliche Grundlage dafür bildet das Hochschurahmengesetz, in dem es in §2, Abs. 1 heißt: „Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat.“
[4] Detlef Bald, Militär und Gesellschaft 1945-1990, Baden-Baden 1994, S. 68.
[5] Vgl. Ulrich vom Hagen, Homo militaris. Perspektiven einer kritischen Militärsoziologie, Bielefeld 2012, S. 56.
[6] Vgl. Bald, a.a.O, S. 74.
[7] Ebd., S. 71.
[8] Ebd., S. 77.
[9] Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, Die Konzeption der „Inneren Führung“ der Bundeswehr. Entstehungsgeschichte – Inhalte – Herausforderungen, Bonn 2017, S. 4. Vgl. dazu auch: Klaus Naumann, KSK oder: Bundeswehr ohne Innere Führung?, in: „Blätter“, 9/2020, S. 33-36.
[10] Bald, a.a.O., S. 60.
[11] Uwe Hartmann, Claus von Rosen, Christian Walther, Jahrbuch Innere Führung. Die Rückkehr des Soldatischen, Berlin 2009.
[12] Herfried Münkler, Kein Platz für Helden?, in: „Zur Sache BW“, 29/2016, S. 8-14.
[13] Gerhard Kümmel, Truppenbild ohne Dame. Eine sozialwissenschaftliche Begleituntersuchung zum aktuellen Stand der Integration von Frauen in die Bundeswehr, Potsdam 2014, S. 8.