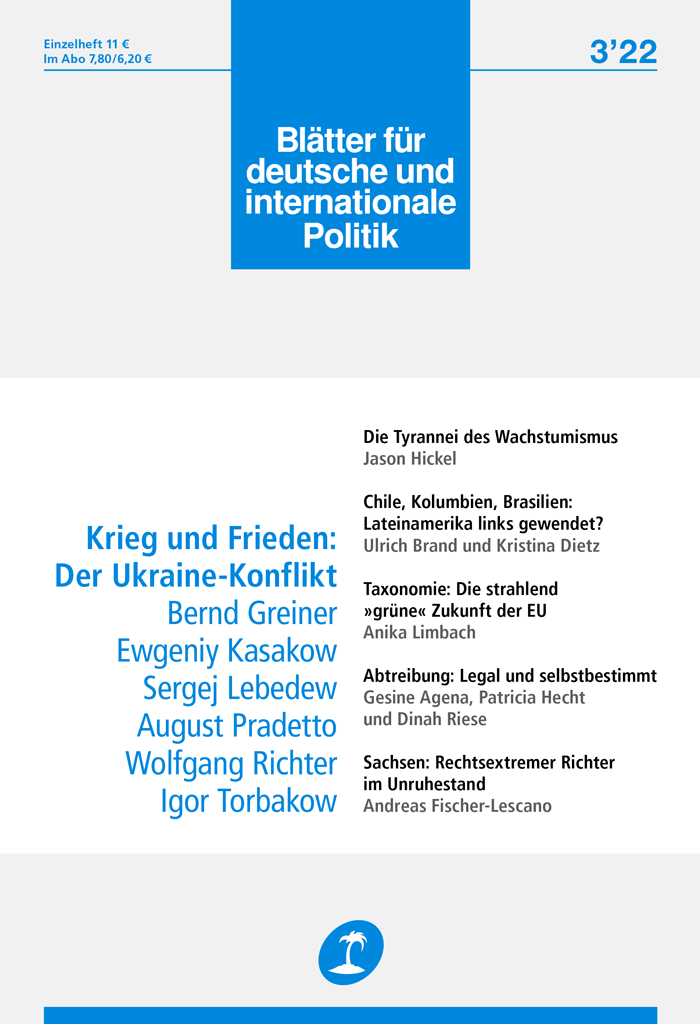Bild: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán während einer Pressekonferenz auf dem Gipfeltreffen der Regierungschefs der Visegrad-Gruppe in Kattowitz/Polen, 30.6.2021 (IMAGO / NurPhoto)
Viktor Orbán hat einmal einen Satz geprägt, der seitdem weit über Ungarn hinaus zitiert wird: „Früher hatten wir geglaubt, Europa sei unsere Zukunft, heute wissen wir schon, dass wir die Zukunft Europas sind.“[1] Damit gelang es dem ungarischen Premierminister vor zwei Jahren, zugleich das gewachsene Selbstbewusstsein der europäischen Nationalisten wie die zunehmenden Sorgen der Demokraten auf eine griffige Formel zu bringen: Die Rechten, so scheint es oft, sind stark genug, der Europäischen Union ihren Stempel aufzudrücken – und den Abschied von demokratischen und universalistischen Prinzipien nicht nur in ihren Ländern einzuläuten.
Ob dem jedoch wirklich so ist, werden ganz entscheidend die kommenden Monate zeigen. Europa steht vor einer Reihe von Wahlen, die Aufschluss über die Kräfteverhältnisse in gleich drei der fünf großen EU-Länder sowie dem symbolisch wichtigen Ungarn geben werden. Damit haben sie gerade auch für die Nationalisten des Kontinents richtungsweisenden Charakter.
Schon Anfang April muss Orbán seine Macht gegen ein großes Bündnis fast aller Oppositionskräfte verteidigen, während wenige Tage später Marine Le Pen erneut ins Stechen um die französische Präsidentschaft einziehen will, worauf auch ihr noch rechterer Konkurrent Éric Zemmour setzt.