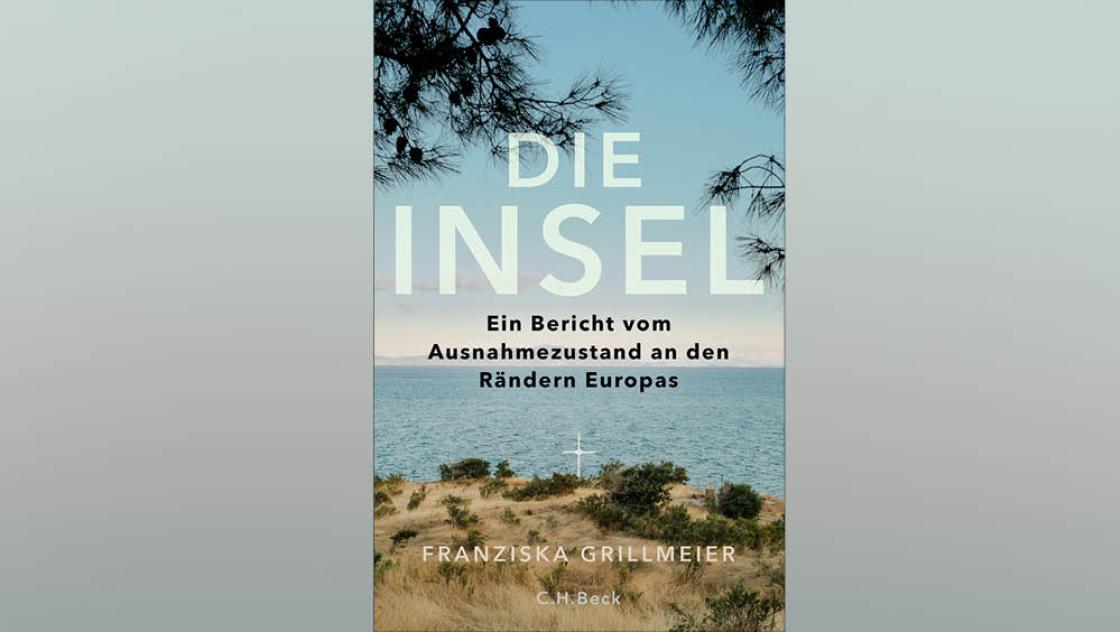
Bild: Franziska Grillmeier, Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas, Cover: C.H. Beck
Die Debatte über eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems hat wieder an Fahrt aufgenommen. Doch die zugrundeliegenden Probleme sind seit vielen Jahren bekannt. Das Flüchtlingsjahr 2015 und die zunehmenden Krisen und Konflikte in der EU-Nachbarschaft haben gezeigt, wie dringend nötig Reformen wären – und wie kompliziert sie sind. Denn bei kaum einem anderen Thema gehen die Haltungen zwischen den Mitgliedstaaten so weit auseinander.
Spätestens mit den zahlreichen Menschen, die hauptsächlich aus dem eskalierenden Syrienkrieg flohen, um in Europa – vor allem in Deutschland – Schutz zu suchen, implodierte das Dublin-System. Nach dieser Rechtsgrundlage der EU stehen praktisch nur die Erstaufnahmestaaten von Flüchtlingen in der Pflicht. So konnten sich jene Länder, die nicht an den Außengrenzen der EU liegen, über Jahre bequem darin einrichten, dass kaum Flüchtende zu ihnen gelangten. Aber 2015 kamen sie in hoher Zahl über die sogenannte Balkanroute. Und die zumindest in Deutschland kurz gefeierte „Willkommenskultur“ schlug bald in ihr Gegenteil um: Europa schottet seine Grenzen nun stärker ab denn je. Zäune, Grenzkontrollen an Land und auf dem Meer sowie Abkommen mit Drittstaaten zur Verhinderung von Migration sollen den Zustrom begrenzen.
Bei dieser auch als „Externalisierung“ der Migrationspolitik bezeichneten Strategie setzt Franziska Grillmeiers Buch „Die Insel“ an. Seit 2018 begleitet die Autorin aus der Nähe jene Menschen, die auf der Suche nach Sicherheit unter großen Risiken über die Türkei auf die griechische Insel Lesbos gekommen sind – und dort feststecken, im Sumpf des gescheiterten europäischen Asylsystems. Nicht selten müssen sie viele Jahre in einem aussichtslosen Wartestand verbringen, ohne Möglichkeit zur Weiterreise, ohne Möglichkeit, eine Ausbildung oder ein Studium aufzunehmen. Franziska Grillmeier beschreibt atmosphärisch und emphatisch die dramatischen Zustände auf „ihrer“ Insel. Vor allem aber sprechen in ihrem Buch die Geflüchteten selbst, über ihre Traumata, ihre individuellen Schicksale, ihre Hoffnungen auf eine Perspektive in Europa, die nicht selten an der Realität vor Ort zerbrechen.
Die Autorin dokumentiert zudem eindrucksvoll, wie Europa selbst die Lebensgefahren einer Flucht auf dem Wasser und an den Landgrenzen organisiert, um Geflüchtete gezielt abzuschrecken – mit oft grausamen und traumatisierenden Folgen. Die aktive Verhinderung von Seenotrettung und die systematischen Zurückweisungen („Pushbacks“) von Schutzsuchenden sind Teil dieses politischen Kalküls. In unzähligen Fällen könnten die Tode auf dem Mittelmeer verhindert werden, und zwar von der EU und ihren Mitgliedstaaten. In verschiedenen Reportagen, die Grillmeier in ihrem Buch stimmig zusammenführt, wird dies auf äußerst deprimierende Weise anschaulich: Ob an der kroatisch-bosnischen, an der türkisch-griechischen oder der belarussisch-polnischen Grenze, die Mechanismen der Abschottung, die Grenzanlagen, die brutale Polizeigewalt, die völkerrechtswidrigen Pushbacks, die Kriminalisierung von Helferinnen und Helfern ähneln sich.
Ausnahmezustand an den Rändern Europas
Das gilt ebenso für die Tendenz, Menschen in abgeschlossene Lager wegzusperren. Eindringlich dokumentiert Grillmeier diesen Prozess auf den ostägäischen Inseln und vor allem im berüchtigten Lager Moria auf Lesbos. Ursprünglich, so die Autorin, war dies ein für 2800 Menschen ausgelegtes Registrierungslager, nach spätestens 30 Tagen sollten die Flüchtenden weiterreisen. Doch nach Inkrafttreten des sogenannten EU-Türkei-Deals 2016 hielt eine andere Logik Einzug. Nun müssen die Flüchtenden dort auf unbestimmte Zeit verharren, bis ihnen eine Genehmigung zur Weiterreise erteilt wird. Um diese Prüfungen durchzuführen, fehlen den EU-Behörden aber die Ressourcen, der Wille – oder beides. Grillmeier beschreibt, wie willkürlich die Entscheidungen getroffen werden, die über das Schicksal ganzer Familien bestimmen. Binnen weniger Wochen wurde Moria 2016 zum größten Flüchtlingslager in Europa, mit bis zu 20 000 Menschen.
Dort herrschten unmenschliche Bedingungen, ohne Mindeststandards der Hygiene und Gesundheitsversorgung, ohne Privatsphäre, ohne Perspektive für die Weiterreise, ohne Würde. In Moria werden die Geflüchteten retraumatisiert, darunter viele Kinder, die nicht nur in kriegerischen Auseinandersetzungen zu Hause, sondern auch auf ihrer Reise schon vielfach schreckliche Erfahrungen machen mussten. Die Zustände ermüden auch die lokale Bevölkerung, deren ursprüngliche Hilfsbereitschaft aufgrund des politischen Versagens oftmals in Feindseligkeit umgeschlagen ist – bis schließlich rechtsradikale Mobs anreisten und Moria brannte, wohl angezündet von verzweifelten Bewohnern. Als Antwort wurden neue, abgeschottete Lager geschaffen, in denen die Geflüchteten wie in Gefängnissen weggesperrt werden und die sie nur für einige Stunden am Tag verlassen dürfen.
Einen „Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas“ nennt Grillmeier ihr Buch. Diese Beschreibungen sind besonders im Licht der aktuellen Diskussion über eine Reform des europäischen Asylsystems wichtig; denn die heutigen Vorschläge könnten dazu führen, dass dieser Ausnahmezustand endgültig zur Regel wird. Beabsichtigt ist unter anderem die Durchführung von Schnellverfahren an den Außengrenzen, in denen über den Zutritt auf das Territorium der EU entschieden werden soll.
„Es kann keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben“, sagte die deutsche Innenministerin Nancy Faeser im April – allerdings vor allem mit Blick auf die Ukraine. Für andere Länder wird das nicht gelten, sollten die derzeitigen Pläne umgesetzt werden. Wer aus Ländern kommt, die als sogenannte sichere Drittstaaten gelten, hätte kaum noch Chancen auf eine Einreise in die EU. Dazu gehören bereits heute Staaten wie die Türkei, in der Geflüchtete unter schwierigsten Bedingungen leben. Auch Tunesien soll bald dazuzählen, das sich gerade vom Hoffnungsträger des Arabischen Frühlings in einen autoritären Staat unter Diktator Kais Saied verwandelt hat. Sollten Geflüchtete aber nach Schnellverfahren ohne echte inhaltliche Prüfung in diese Länder zurückgeschickt werden, wäre das Asylsystem der Genfer Flüchtlingskonvention faktisch außer Kraft gesetzt.
Dabei hat der Ukrainekrieg gezeigt: Wenn politischer Wille da ist, ist auch ein rasches Handeln möglich. Infolge des russischen Angriffskrieges wurde erstmals die Temporary-Protection-Richtlinie aktiviert, ein europäischer Mechanismus, der ukrainischen Kriegsflüchtlingen unbürokratisch einen Aufenthaltsstatus gewährte. Das zeige einerseits, so Grillmeier, dass ein würdevoller Umgang mit Flüchtenden möglich ist – aber andererseits, wie drastisch die Ungleichbehandlung ausfällt. Während Grillmeier zum neuen Ausnahmezustand an die ukrainische Grenze reist, erhält sie Nachrichten über Flüchtlinge, die bei der Überfahrt nach Lesbos ums Leben gekommen sind.
Neben ihren so wichtigen investigativen Recherchen ist das größte Verdienst der Autorin, dass sie die Geflüchteten in ihrem Buch immer wieder selbst sprechen lässt. Viele entscheiden sich, aufgrund der eigenen traumatischen Fluchterfahrungen anderen zu helfen oder das Geschehene zu dokumentieren: als Ärztinnen und Pfleger, als Erzieher, als Journalistinnen, als Filmemacher. Diesen Persönlichkeiten, die sonst selten im Mittelpunkt stehen, setzt Grillmeier mit ihrem Buch ein Denkmal. Hier werden Menschen in den Blick genommen, die in der Debatte über die Reformvorschläge des Asylsystems gar nicht vorkommen, obwohl es um ihr Schicksal geht.
Franziska Grillmeier ist ein persönliches, poetisches Buch gelungen, das das moralische Versagen Europas eindrucksvoll dokumentiert. Obwohl sie erst gar nicht versucht, eigene politische Vorschläge für eine andere EU-Politik zu machen, ist „Die Insel“ ein zutiefst politisches Buch. Es entspringt Grillmeiers Empörung darüber, dass Europa jene Werte, die es so gern für sich reklamiert, im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten mit Füßen tritt. Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen ist das Buch daher als Menetekel zu verstehen: Meint die EU es noch ernst mit ihrer Verpflichtung für die Rechte von Schutzsuchenden, muss die Insel Lesbos abschreckendes Beispiel bleiben, anstatt der EU als Blaupause für die Reform ihrer Flüchtlingspolitik zu dienen.
Franziska Grillmeier, Die Insel. Ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. C.H. Beck, München 2023, 220 S., 24 Euro.











