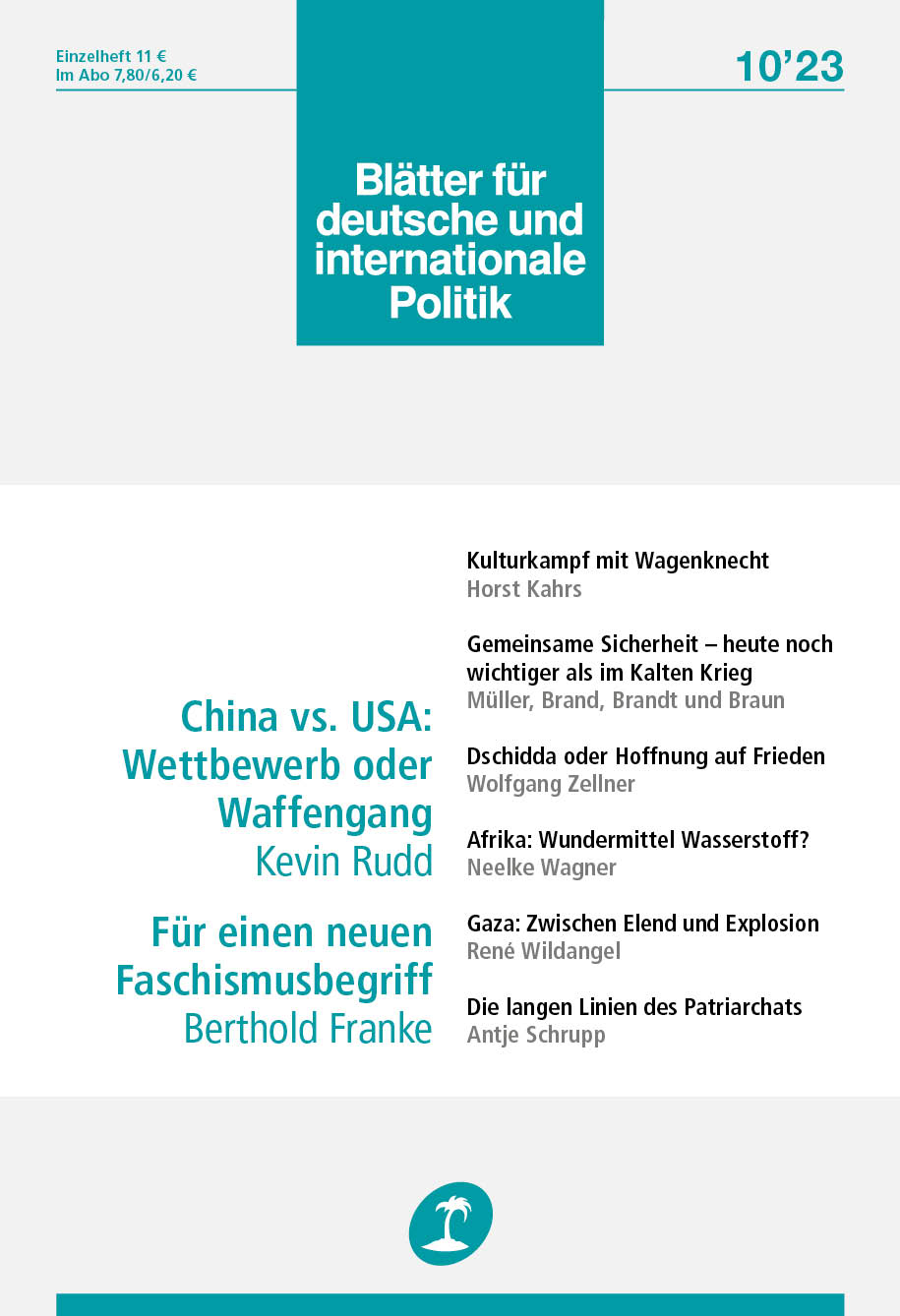Bild: Der Tsau/Khaeb-Nationalpark in Namibia, wo Hyphen sein Großprojekt ansiedeln will (IMAGO / imagebroker / Oliver Gerhard)
Es war der erste Klimagipfel, der den afrikanischen Kontinent in den Mittelpunkt stellte: Vom 4. bis 6. September trafen sich im kenianischen Nairobi die Vertreter zahlreicher afrikanischer Staaten zum Africa Climate Summit. Und das aus „gutem“ Grund: Denn die Klimakrise schlägt auf dem afrikanischen Kontinent besonders hart zu, während er selbst bisher kaum zur globalen Erwärmung beigetragen hat. Ein besonderer Schwerpunkt des Gipfels lag denn auch auf Investitionen in die Energiewende – sowohl in den afrikanischen Staaten selbst als auch weltweit. Das ist nur folgerichtig, da der Energiesektor für gut drei Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, Tendenz eher steigend.[1] In vielen afrikanischen Ländern sieht die Ökostrombilanz dagegen schon recht gut aus: Von denjenigen Ländern, die ihren Strom zu mehr als der Hälfte aus erneuerbaren Energien erhalten, liegt ein Drittel in Afrika. Allerdings sind dies überwiegend kleine oder wenig einwohnerstarke Staaten. Vor allem aber deckt die Stromerzeugung generell nur in den wenigsten Ländern den tatsächlichen Bedarf; oft müssen weite Teile der Bevölkerung ohne Zugang zu Strom auskommen. Zudem machen häufige Stromausfälle und steigende Preise vielerorts auch jenen Haushalten und Unternehmen das Leben schwer, die an ein Stromnetz angeschlossen sind. Dabei sind die Bedingungen für erneuerbare Energien in vielen Teilen Afrikas exzellent. Der Gastgeber des afrikanischen Klimagipfels, Kenias Präsident William Ruto, zeigte sich in seiner Eröffnungsrede denn auch überzeugt, die Potenziale der erneuerbaren Energien in Afrika reichten „nicht nur, um unseren eigenen Bedarf zu decken, sondern auch, um weltweit zum grünen Wandel beizutragen. Das bedeutet gleichzeitig milliardenschwere Investitionsmöglichkeiten für Afrika und den Rest der Welt.“
Ein wesentliches Element dieser Hoffnungen ist grüner Wasserstoff. Um diesen vielfältig einsetzbaren Energieträger herzustellen, braucht es viel Wind- und Solarstrom. Und in den Ländern des Globalen Nordens bahnt sich eine hohe Nachfrage an, die durch eigene Produktion kaum gedeckt werden kann. Deshalb sehen Ruto und einige seiner Amtskollegen den Wasserstoffhype als Chance, internationale Investoren in ihre Länder zu locken und damit auch die Energieversorgung ihrer Bevölkerung zu verbessern. Denn aus eigener Kraft schaffen es die meisten Staaten und überschuldeten öffentlichen Stromversorger nicht, die dafür nötigen Investitionen zu stemmen.
In Europa stößt dies auf offene Ohren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte auf dem Klimagipfel in Nairobi zusammen mit Ruto einen Fahrplan zur Herstellung von Wasserstoff in Kenia vor. Die EU bemüht sich überall auf der Welt um strategische Partnerschaften mit Staaten, die als vielversprechende Lieferanten von Wasserstoff gelten – in Afrika etwa mit Ägypten, Namibia oder Marokko. Zusätzlich dazu ergreifen die Mitgliedsstaaten der EU eigene Maßnahmen, um ihren Industrien die Versorgung mit Wasserstoff zu sichern. Auch die Bundesregierung hofft auf Wasserstoffimporte aus Afrika im großen Stil. Die deutsche Wasserstoffstrategie geht davon aus, dass in der Bundesrepublik 2030 etwa 95 bis 130 Terrawattstunden Wasserstoff benötigt werden. Etwa zwei Drittel davon sollen importiert werden. Ähnlich wie die EU verfolgt auch Deutschland eine Wasserstoffdiplomatie, die Beziehungen „auf Augenhöhe“ verspricht und Finanz- und Personalmittel bereitstellt, damit Staaten, die über ein hohes Potenzial bei erneuerbaren Energien verfügen, zum Aufbau einer – möglichst exportorientierten – Wasserstoffwirtschaft animiert werden.
In den Partnerstaaten steht dagegen eher die eigene industrielle Entwicklung im Vordergrund. So wie Kenia mit dem Wasserstoff vor allem die eigene Düngemittelindustrie „ergrünen“ lassen will – ein Vorhaben, das bei kenianischen Umweltorganisationen auf Kritik stößt –, hat auch Südafrika die eigene Stahlindustrie im Blick, die durch den Einsatz von grünem Wasserstoff klimaneutral werden könnte. Statt Eisenerz und Wasserstoff könnte dann auch gleich grüner Stahl exportiert werden. Das Nachbarland Namibia verspricht sich gar eine umfassende Industrialisierung, basierend auf grünem Wasserstoff. Die namibische Wasserstoffstrategie vom November 2022 sieht vor, drei Industriezentren zu errichten – im Norden, in der Mitte und im Süden des Landes. Bereits 2030 soll die Wasserstoffindustrie bis zu 80 000 Arbeitsplätze bereitstellen und bis zu sechs Mrd. US-Dollar zum BIP beitragen. So will Namibia den Wasserstoffhunger der Industrienationen decken, aber auch eigene Wertschöpfung aus der Weiterverarbeitung des Wasserstoffs zu synthetischen Kraftstoffen generieren. In Zusammenarbeit mit den Nachbarn Südafrika, Sambia, Botswana und Angola soll ein „integriertes, prosperierendes grünes Ökosystem im südlichen Afrika“ entstehen.[2]
Um Namibia bemüht sich Deutschland besonders intensiv. Als ehemalige Kolonialmacht hat es einen Völkermord in dem südafrikanischen Land zu verantworten. Die rassistische Kolonialherrschaft prägt die Vermögensverteilung in Namibia bis heute. Seit etwa zwei Jahren erstreckt sich die Zusammenarbeit Deutschlands mit Namibia auch auf Wasserstoff. Im August 2021 schloss das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Namibia eine Kooperationsvereinbarung ab und finanzierte damit auch die Erstellung der erwähnten namibischen Wasserstoffstrategie. Das BMBF will damit „heimischen Technologieanbietern die Tür zum namibischen Markt öffnen – und auch darüber hinaus neue Exportchancen für Wasserstofftechnologien ‚Made in Germany‘ schaffen“.[3] Im März 2022 vereinbarte auch das Bundeswirtschaftsministerium eine engere Zusammenarbeit mit Namibia.
Großprojekt im Nationalpark
Am wichtigsten ist dabei das Megaprojekt von Hyphen Hydrogen Energy, einem Joint Venture der Offshore-Investmentgesellschaft Nicholas Holdings Limited und der deutschen Firma Enertrag. Hyphen hat im Juni 2021 eine Ausschreibung im Rahmen der namibischen „Entwicklungsinitiative Südkorridor“ gewonnen. Damit erhält das Unternehmen das Recht, eine 4000 Quadratkilometer große Fläche im ehemaligen Sperrgebiet einer Diamantenmine für 40 Jahre zu pachten und dort Wind- und Solarkraftwerke mit insgesamt sieben Gigawatt und drei Gigawatt Elektrolyseleistung zu errichten, um damit bis zu 350 000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr zu produzieren. Der Wasserstoff soll zu Ammoniak weiterverarbeitet und größtenteils exportiert werden, angestrebt wird eine Mio. Tonnen im Jahr. Weil in der Gegend Wasser knapp ist, soll sich das Projekt über Meerwasserentsalzungsanlagen versorgen. 3000 Arbeitsplätze soll das Projekt dauerhaft schaffen und zusätzlich 15 000 Menschen für den Bau beschäftigen. Mit knapp zehn Mrd. Euro Investitionsvolumen entspricht das Budget ungefähr dem namibischen BIP.
Der Vertrag über die Nutzung des Areals zwischen Namibia und Hyphen enthält einige Auflagen, damit das Projekt die erhofften Vorteile für die Bevölkerung abwirft. Demnach sollen die Wind- und Solarparks, die für die Wasserstoffproduktion gebaut werden, zehn Prozent mehr Leistung aufweisen müssen als für die Elektrolyse notwendig. So soll nicht nur der namibische Bedarf gedeckt, sondern auch Strom nach Südafrika exportiert werden. Des Weiteren gibt es Vorschriften für Mindestanteile lokaler Produktion (bis zu 30 Prozent), für Ausbildungsplätze und die Beschäftigung namibischer Arbeitnehmer:innen (bis zu 90 Prozent).
Hyphen verfolgt einen ambitionierten Fahrplan: Anfang 2025 soll mit dem Bau begonnen werden und bereits 2027 die Ammoniakproduktion auf voller Kapazität laufen. Dabei gibt es in Namibia bisher kaum Arbeitskräfte, die für den Bau einer solchen technischen Großanlage ausgebildet sind. Hier sei der namibische Staat in der Pflicht und stehe vor einer riesigen Herausforderung, sagt Bertchen Kohrs, Vorsitzende der Menschenrechts- und Umweltorganisation Earthlife Namibia. Angesichts einer „Arbeitslosigkeit von etwa 37 Prozent, die bei Studienabgängern noch höher eingeschätzt wird, wäre diese Entwicklung außerordentlich willkommen“, meint sie. Die Frage sei allerdings, „ob Namibia eine so gewaltige Ausbildungsaufgabe stemmen kann“.[4]
Dazu kommt: In der Gegend, in der Hyphen ab 2026 grünen Ammoniak produzieren und exportieren will, gibt es dafür bisher weder die Infrastruktur noch die Arbeitskräfte. Lüderitz, die nächstgelegene Stadt, lebt vorwiegend von Fischerei und Tourismus. Auch der Tiefseehafen, von dem aus große Tankschiffe den Ammoniak nach Europa liefern sollen, existiert noch nicht. Obendrein ist fraglich, ob schnell ausreichend neue Ammoniaktanker gebaut werden können, die den wachsenden weltweiten Transportbedarf befriedigen können.[5]
Die schiere Größe des Projekts und die Tatsache, dass keine der beteiligten Firmen Erfahrungen über die gesamte geplante Wertschöpfungskette mitbringt, werfen Fragen auf. Der Finanzpartner im Joint Venture, die Nicholas Holding Ltd., ist auf den britischen Jungferninseln registriert und macht keine näheren Angaben zu ihren Geldgebern. Die Tochterfirma Principle Capital, die für Hyphen zuständig ist, listet auf ihrer Website unter „laufenden Investitionen“ neben Hyphen lediglich eine Schweizer Vermögensverwaltung für Superreiche und das südafrikanische Eisenbahnunternehmen Traxtion. Hyphen ist das erste Energieinvestment der Firma. Enertrag hat zwar langjährige Erfahrungen mit erneuerbaren Energien, in der Produktion von Wasserstoff und Ammoniak ist die Firma jedoch auch neu. Hyphen ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Partner. „Wie konnte ein sechs Monate altes Unternehmen ohne Erfahrungen die größte Ausschreibung in der Geschichte des Landes gewinnen?“, fragt Frederico Links vom Institute for Public Policy Research, einem Thinktank aus Namibias Hauptstadt Windhoek. Eine Antwort blieb die Regierung bisher schuldig.[6]
Generell ist es um die Informationspolitik der Regierung in Bezug auf Hyphen nicht sonderlich gut bestellt. Die namibische Bevölkerung habe aus einer Rede von Staatspräsident Hage Geingob in Paris erfahren, dass Hyphen den Zuschlag erhalten habe, moniert Kohrs und konstatiert: „Eine demokratische Vorgehensweise sieht anders aus.“ Besonders im Süden, wo das Projekt verwirklicht werden soll, kämen Informationen nur spärlich und verspätet an, beklagen Politiker:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft. In einem Interview mit der Deutschen Welle spricht Joseph Isaacks, der Vorsitzende des Regionalrats der Kharas-Region, sogar von einem Verfassungsbruch: „Obwohl das Projekt von dieser Region ausgehen soll, ist der Regionalrat von allen Diskussionen und Treffen ausgeschlossen. Wir sind kein Teil davon!“[7] Im namibischen Wasserstoffrat sitzen ausschließlich Mitglieder der Nationalregierung oder nationaler Behörden. Im Juni wurde Isaacks nach seiner Kritik zwar zum Sonderberater des Wasserstoffrates berufen – welche Befugnisse und Aufgaben das beinhaltet, bleibt aber unklar.
Eine weitere Möglichkeit der Bevölkerung, Einfluss zu nehmen, bietet die derzeit laufende Umweltverträglichkeitsprüfung, zu der auch eine öffentliche Konsultation gehört. Hier werden noch einmal grundlegende Fragen gestellt, etwa ob Hyphen sein Projekt auch an anderer Stelle verwirklichen könnte, wenn festgestellt wird, dass der Eingriff in die Umwelt im Tsau/Khaeb-Nationalpark, wo Hyphen bauen will, zu groß ist. Theoretisch könnte das Projekt also noch einmal wesentliche Veränderungen erfahren oder sogar gestoppt werden.
Starker Druck der Investoren
Doch Präsident Geingob hat sich längst festgelegt. Namibia wird einen 24-prozentigen Anteil an Hyphen erwerben, und zwar auf Pump. Das Geld kommt von der Europäischen Entwicklungsbank und der halbstaatlichen niederländischen Finanzierungsgesellschaft Invest International. Scheitert das Projekt, entgehen Namibia nicht nur die erhofften Pacht- und Steuereinnahmen sowie die versprochenen Arbeitsplätze, sondern auch der Schuldenberg des Landes würde sich erheblich vergrößern. Das ist besonders heikel, weil der Staat sich gegenüber Hyphen vertraglich verpflichtet hat, die „rechtlichen, steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Projektes zu schaffen“.[8] Sprich: An namibischer Regulierung darf die Umsetzung nicht scheitern. Somit ist nicht nur das politische Schicksal Geingobs, sondern auch die finanzielle Stabilität des Staates maßgeblich davon abhängig, dass das Projekt ein Erfolg wird. Damit schwindet die Hoffnung, dass die ökologischen, ökonomischen und sozialen Bedenken in Bezug auf das Hyphen-Projekt tatsächlich berücksichtigt werden.
Stattdessen tritt Geingob die Flucht nach vorne an. Bei der feierlichen Unterzeichnung des Machbarkeits- und Durchführungsabkommens mit Hyphen warnte er vor „exzessiver lokaler Einmischung“ und schwor die Bevölkerung darauf ein, nur der Erfolg des Projektes könne Wohlstand und Jobs nach Namibia bringen.[9] Das brachte ihm scharfen Protest aus der Zivilgesellschaft ein, aber sein Wasserstoffbeauftragter und Wirtschaftsberater James Mnyupe legt einen Monat später in einem Gastbeitrag für „The Namibian“ nach: Namibia befinde sich in einem internationalen Wettbewerb um Kapital, das in grüne Wasserstoffprojekte investiert werden solle. Manche lokale Ökonomen machten aber Vorschläge, „die Namibias Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen schmälern würden in einem äußerst kompetitiven Umfeld, in dem manche Länder Milliarden US-Dollar an Subventionen bieten“. Damit spielte er auf Vorschläge an, Namibia solle darauf beharren, seinen 24-prozentigen Anteil kostenlos zu erhalten. Das sei für Investoren unattraktiv, da diese dann ja das erforderliche Kapital anderswo auftreiben müssten.[10]
Diese Argumentation zeigt das Ausmaß der Probleme, vor denen Länder wie Namibia trotz (oder wegen) ihres Reichtums an Wind- und Solarpotenzial stehen. Solange ein Investor durchschnittlich zwei- bis dreimal so viel Geld für die Finanzierung seines Vorhabens ausgeben muss wie in der EU oder den USA, gehen die meisten Investitionen und damit auch die Anlagen in den Globalen Norden. Damit die Kapitalkosten die Wettbewerbsvorteile beim grünen Wasserstoff – sehr gute natürliche Bedingungen, niedrige Land- und Arbeitskosten – nicht konterkarieren, kommen Regierungen wie die von Geingob, die sich dieser Logik beugen, den Investoren weit entgegen. Das geht im Zweifel zulasten der lokalen Bevölkerung.
Zu oft wurde Staaten des Globalen Südens ein „trickle down“-Effekt versprochen, wenn sie ihre Genehmigungsverfahren und Regeln für ausländische Direktinvestitionen entsprechend anpassen. Auch die heutigen Abkommen klingen sehr stark nach den Programmen der 1990er Jahre, als IWF und Weltbank viele arme und überschuldete Staaten mit sogenannten Strukturanpassungsprogrammen überzogen und Werbung für Sonderwirtschaftszonen machten, in denen internationale Konzerne möglichst unbehelligt von lokalen Gesetzen und Steuersätzen Geschäfte machen konnten. Heute denkt die namibische Regierung über die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone nach, um die Wasserstoffindustrie zu fördern.
In der Abschlusserklärung des Afrikanischen Klimagipfels bekundeten 19 Regierungschef:innen, dass sie sich aus solchen Abhängigkeiten lösen wollen. Nicht sie wollen sich künftig an die Anforderungen eines ungerechten internationalen Finanzsystems anpassen, sondern die globale Finanz- und Handelsarchitektur müsse den Bedürfnissen und Erfordernissen der afrikanischen Staaten entgegenkommen, schreiben sie in dem Papier.[11] So fordern sie Umschuldung und Schuldenerlass, niedrigere Zinsen und faire Wettbewerbsbedingungen für afrikanische Produkte auf den Weltmärkten. Auch industriepolitisch stellt das Abschlussdokument selbstbewusste Forderungen auf: Die energieintensive Weiterverarbeitung der Rohstoffe, die bisher hauptsächlich exportiert werden, soll künftig in Afrika stattfinden, und globale Investitionen sollen dorthin fließen, wo sie die beste und nachhaltigste Klimawirkung entfalten und die lokalen Gemeinschaften die Vorteile davon auch genießen können. Denn eines ist klar: Internationale Investitionen genügen nicht, sie haben in den allermeisten Fällen nur dazu geführt, dass die Profite zurück ins Ausland gingen, während die Gemeinden vor Ort mit den Problemen zurückblieben: Vertreibung, Umweltverschmutzung sowie dem Verlust traditioneller Wirtschaftsbeziehungen und Nutzungsrechte.
Wenn sie nach der alten Logik geplant und installiert werden, drohen auch die neuen „grünen“ Investitionen diese Fehler zu wiederholen. Damit es wirklich zu einer Win-win-Situation kommt, müssen die europäischen Partner den Forderungen des Afrikanischen Klimagipfels entgegenkommen – und die Regierungschef:innen müssen anfangen, ihre lokalen Akteure mindestens ebenso ernst zu nehmen wie Investoren, die mit Megaprojekten riesige Gewinne versprechen. Denn nur wenn solche Projekte in einem offenen demokratischen Prozess auf ihre Chancen und Risiken geprüft und an lokale Bedingungen angepasst werden, werden sie einen nachhaltigen Beitrag zur Überwindung von Energiearmut und Klimakrise leisten können.
[1] Greenhouse Gas Emissions from Energy Data Explorer, iea.org, 2.8.2023.
[2] Ministry of Mines and Energy Namibia, Namibia. Green Hydrogen and Derivatives Strategy, Windhoek 2022.
[3] Grüner Wasserstoff aus Afrika: Namibia wird Forschungspartner, bmbf.de, 11.10.2022.
[4] Bertchen Kohrs, Überzogene Erwartungen?, in: „afrika süd“, 1/2023.
[5] Polly Martin, Are there enough ships to carry exports of hydrogen as ammonia?, hydrogeninsight.com, 22.8.2023.
[6] Update on the Green Hydrogen Procurement Transparency Issue, in: „Procurement Tracker Namibia”, 17/2022.
[7] Jasko Rust und Lisa Ossenbrink, Wasserstoff: Hoffnungen und Ängste in Namibia, dw.com, 3.12.2022.
[8] Government of the Republic of Namibia and Hyphen Hydrogen Energy, Feasibility and Implementation Agreement, hyphenafrica.com, Juni 2023.
[9] Donald Matthys, Geingob blasted for telling Namibians not to interfere with green hydrogen project, namibian.com.na, 1.6.2023.
[10] James Mnyupe, Competition for Green Hydrogen Capital, namibian.com.na, 26.6.2023.
[11] African Union, The African Leaders Nairobi Declaration on Climate Change and Call to Action, africaclimatesummit.org, 6.9.2023.