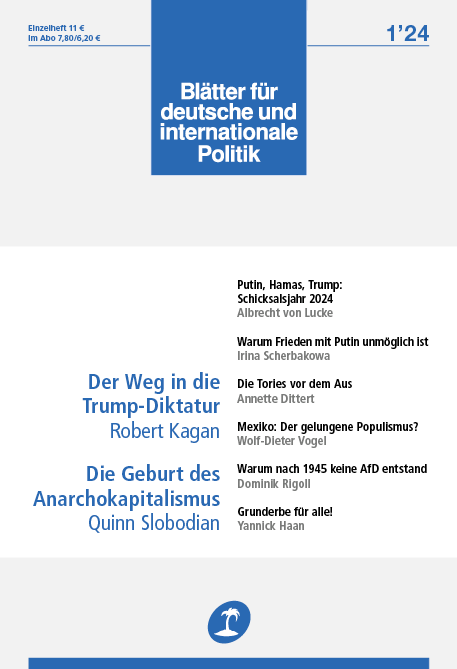Die Geburt des Anarchokapitalismus aus dem Geist des Rechtsradikalismus

Bild: Wolkenkratzer in Singapur. Hans-Hermann Hoppe, einem der Vordenker des Anarchokapitalismus, dienten Mikronationen und Stadtstaaten wie z.B. Singapur als Vorbilder, 13.12.2022 (IMAGO / Pond5 Images)
Versuchen Sie, die folgende Frage zu beantworten, ohne Ihr Smartphone zur Hand zu nehmen: Wie viele Länder gibt es auf der Erde? Sie sind nicht sicher? Es sind etwa 200. Versuchen Sie sich jetzt vorzustellen, wie viele Länder es im Jahr 2150 geben wird. Mehr als 200? Weniger? Was, wenn es dann 1000 Länder gibt? Oder nur noch 20? Oder zwei? Oder nur noch ein einziges? Wie sähe die Zukunft mit einer solchen Landkarte aus? Was, wenn das Schicksal der Menschheit von der Antwort abhinge?“
Dieses Gedankenexperiment schlug 2009 der damals 41-jährige Wagniskapitalgeber Peter Thiel vor. Nachdem er mit der Gründung von Paypal und einer frühen Investition in Facebook ein kleines Vermögen verdient hatte, hatte Thiel im Jahr 2008 in der Finanzkrise viel Geld verloren. Jetzt verfolgte der frühe Trump-Sympathisant ein klares Ziel: Er wollte dem demokratischen Staat entkommen, der ihn zwang, Steuern zu zahlen. „Ich glaube nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie vereinbar sind“, schrieb er in einem selbsterklärten Forum für kontroverse Ideen. „Die große Aufgabe der Libertären besteht darin, einen Weg zu finden, um der Politik in all ihren Formen zu entkommen.“ Und Thiel war überzeugt, je mehr Länder es gebe, desto mehr Orte könnten als Zufluchtsort für das Geld dienen, womit die Wahrscheinlichkeit geringer werde, dass ein Land die Steuern anhebe, da es sonst befürchten müsse, die Gans zu verscheuchen, die goldene Eier legt. „Wenn wir mehr Freiheit wollen“, erklärte er, „sollten wir die Zahl der Länder erhöhen.“
Es ist jedoch gar nicht einfach, einen neuen Staat zu errichten. Denn der Planet ist bereits aufgeteilt. Wer einen Staat gründen will, muss einem bereits bestehenden Staat Territorium wegnehmen. Die Staaten versuchen daher mit gutem Grund zu verhindern, dass dies geschieht. Da sie keine Änderung der Grenzen wollen, verteidigen sie das bestehende Völkerrecht, das die Grenzen festschreibt. Selbst während der Entkolonialisierung Afrikas und Asiens behielten die neuen Staaten die oftmals willkürlichen kolonialen Grenzen bei. Das Streben von Minderheiten nach Unabhängigkeit wurde ignoriert oder unterdrückt, und die Staatengemeinschaft erhob keinen Widerspruch. Die Kartografie war jahrzehntelang Schicksal.
Doch in den 1990er Jahren verlor diese Ordnung ihre Gültigkeit. Die Auflösung des sowjetisch beherrschten Ostblocks brachte eine Vielzahl wiederhergestellter sowie neuer Nationen hervor und veränderte die Konturen Europas. An den Rändern der roten Fläche auf der Weltkarte, die das Territorium der Sowjetunion gewesen war, lösten sich zahlreiche bunte Republiken ab. Der Zerfall des sozialistischen Europa schien die Büchse der Pandora zu öffnen. Der Geist der Staatsbildung war freigesetzt worden.
Die Tschechoslowakei machte eine Mitose durch. Und das längliche Gebilde Jugoslawiens wurde zu einem Flickenteppich. Immer mehr nationale Gruppen verlangten das Recht auf Sezession: die Katalanen in Spanien, die Flamen in Belgien, die Tamilen in Sri Lanka. In meinem Geburtsland war die Provinz Quebec nahe daran, sich per Referendum von Kanada abzuspalten. In den 90er Jahren nahm die UNO winzige Länder auf, die lange ausgeschlossen gewesen waren: Andorra, San Marino, Monaco und Liechtenstein erhielten ihren eigenen Sitz in der Vollversammlung.
Die meisten Beobachter betrachteten das Auftauchen neuer Nationen unter politischen Gesichtspunkten, und einige machten sich Sorgen über die Geburt eines „Neonationalismus“. Die radikalen Anhänger des freien Marktes hingegen sahen die Entwicklung durch die Linse des Kapitalismus – und freuten sich über das, was sie sahen. Jeder durch Sezession entstandene Staat war ein neuer Rechtsraum, ein Start-up-Territorium, das sich als Zufluchtsort für Kapital oder als Standort für eine nicht regulierte Unternehmens- oder Forschungstätigkeit anbieten konnte.
Die Mikronationen waren Zonen, rechtlich abgegrenzte Räume, die klein genug waren, um dort wirtschaftliche Experimente durchzuführen. Und sie waren Phylen – freiwillige Zusammenschlüsse gleichgesinnter Einwohner. Die Sezession war eine Methode, um die Erdoberfläche weiter zu unterteilen und den geschäftigen Markt des globalen Wettbewerbs durch neue Territorien zu erweitern. Der Neonationalismus war – aus neoliberaler Sicht – möglicherweise der Vorbote eines von stetig schrumpfenden Staatswesen geprägten goldenen Zeitalters der sozialen Sortierung.
Die neue Symbiose von Marktradikalen und Neokonföderierten
In Reaktion auf diese geopolitischen Umwälzungen schlossen sich in den Vereinigten Staaten zwei Gruppen zusammen: Marktradikale, die einen Weg zu einem kapitalistischen Gemeinwesen jenseits der Demokratie suchten, und Neokonföderierte, welche die alten amerikanischen Südstaaten wiederbeleben wollten, verschmolzen die Prinzipien des dezentralisierten kapitalistischen Wettbewerbs und der ethnischen Homogenität miteinander. Ihr rechtsextremes Bündnis träumte von eigenen Bantustans wie in Südafrika – von einer Apartheid von unten. Obwohl ihr unmittelbares Vorhaben scheiterte, lebte ihre Vision von einer Laissez-faire-Segregation weiter. In ihren Augen war die Sezession der Weg zu einer Welt, die sozial gespalten, aber wirtschaftlich integriert war – separat und global zugleich.
Die Hauptfigur im sezessionistischen Bündnis war Murray Rothbard. Er war 1926 in der Bronx zur Welt gekommen und hatte sich im Universum der neoliberalen Denkfabriken hochgearbeitet. Seit den 1950er Jahren war er Mitglied in der Mont Pèlerin Society. In seiner gesamten Laufbahn arbeitete er an der Entwicklung einer besonders radikalen Version des Libertarismus, die als „Anarchokapitalismus“ bezeichnet wird.[1] Er lehnte jede Art von Regierung ab, betrachtete Staaten als „organisiertes Banditentum“ und Steuern als „Diebstahl in gewaltigem Ausmaß“. In seiner idealen Welt sollte der Staat vollkommen beseitigt werden. Innere Sicherheit, Versorgungswirtschaft, Infrastruktur, Gesundheitswesen: Sämtliche Dienste sollten über den Markt angeboten werden, und ein Sicherheitsnetz für jene, die sie nicht bezahlen konnten, würde es nicht geben. Die Verfassungen sollten durch Verträge ersetzt werden, und die Menschen würden nicht länger Bürger eines Landes, sondern Klienten verschiedener Dienstleister sein. Das Gemeinwesen wäre eine Antirepublik, in der das Privateigentum und der wirtschaftliche Austausch jede Spur der Volkssouveränität auslöschen würden.
Durch Sezessionismus zur staatlichen Desintegration
Wie aber war Rothbard zu einer derart extremen Haltung gelangt?
Obwohl das moderne Staatssystem, dem er entkommen wollte, auf der Idee der nationalen Selbstbestimmung beruhte, sah er in deren Radikalisierung ein Instrument, um den Staat zu zersetzen. Der Sieg des Prinzips der Sezession würde eine Kettenreaktion der staatlichen Desintegration auslösen. Die meisten neuen Gemeinwesen würden nicht anarchokapitalistisch sein, aber der Prozess der Spaltung würde den Staat seiner größten Stärke berauben: des Eindrucks der Dauerhaftigkeit. Die Entstehung neuer Länder untergrub die Legitimität der alten und weckte Zweifel an deren eigennützigen Mythen. Wenn es den neuen Territorien gelang, sich der Rachsucht der alten Zentralstaaten zu entziehen, könnten sie unterschiedliche Formen annehmen.
Und wenn sich einige von ihnen für die von ihm bevorzugte Staatslosigkeit entschieden? „Je größer die Zahl der Staaten“, schrieb Rothbard, „desto weniger Macht kann sich jeder einzelne Staat aneignen.“ In seinen Augen mussten Sezessionsbewegungen daher prinzipiell begrüßt und unterstützt werden, „wo und wie auch immer sie entstehen mögen“. Die Zersplitterung der Staaten war das Schwungrad des menschlichen Fortschritts. Rothbard suchte sein Leben lang nach Hinweisen auf potenzielle Sezessionsbewegungen – nach Rissen im Gebäude des öffentlichen Vertrauens in existierende Staaten. Wenn er solche Risse entdeckte, tat er alles, um sie zu vertiefen.
In den 60er Jahren schien ihm der Widerstand der Neuen Linken gegen den Vietnamkrieg vielversprechend. Rothbard selbst lehnte den Krieg entschieden ab. Für ihn war die Rolle der USA als selbsternannter Weltpolizist ein Vorwand für die Zentralisierung der staatlichen Macht und für die Ausweitung von Vetternwirtschaft, Verschwendung und Ineffizienz im militärisch-industriellen Komplex. Eine mit Steuergeldern finanzierte stehende Armee mit einem Monopol auf moderne Waffen war unvereinbar mit seinen Prinzipien, und in der Wehrpflicht sah er eine „Massenversklavung“.
Die sozialistische Neue Linke lehnte Rothbards Anarchokapitalismus ab, aber er fragte sich, ob ihr Widerstand gegen einige Eingriffe des Staates in eine Ablehnung des Staates als solchen umgewandelt werden konnte. War das „Aussteigen“, konsequent betrachtet, nicht gleichbedeutend mit dem Austritt? In einer Zeitschrift namens „Left & Right“, die Rothbard gemeinsam mit Gleichgesinnten aus der Taufe hob, warb er für die Sezession als revolutionäre Praxis. Radikale sollten den Staat nicht erobern, sondern verlassen, um ihre eigenen politischen Ordnungen zu errichten.
Der Nationalismus als positive Kraft
Da der Nationalismus ein Motor der Sezession war, war er in Rothbards Augen eine positive Kraft. Separatistische Bewegungen von Schottland über Kroatien bis Biafra, erklärte er, beruhten auf dem von den Mitgliedern einer Gruppe geteilten Gefühl, einer eigenen Nation oder Ethnie anzugehören. In den Vereinigten Staaten galt sein besonderes Interesse dem Potenzial des schwarzen Nationalismus. Er bewunderte jene schwarzen Freiheitskämpfer, die kommunitäre Selbsthilfe und kollektive Selbstverteidigung befürworteten, und gab dem Separatismus von Malcolm X den Vorzug vor Martin Luther Kings Aufruf zu Zurückhaltung und Gewaltlosigkeit.
Rothbard und seine Mitstreiter hielten eine Sezession der Schwarzen aus den Vereinigten Staaten für möglich und erklärten, die Gemeinden sollten das Prinzip der Segregation respektieren. Er war enttäuscht angesichts der ausbleibenden Zusammenarbeit zwischen weißen und schwarzen Radikalen. In seinen Augen sollten sich die Schwarzen mit Schwarzen zusammentun, so wie „die Weißen dafür verantwortlich sind, die weiße Bewegung aufzubauen“.
Die Abweichung der Neuen Linken von seinem bevorzugten Skript des rassifizierten Ausstiegs bewegte Rothbard Anfang der 70er Jahre dazu, sie aggressiv zu bekämpfen. Ihr hartnäckiger Egalitarismus war unvereinbar mit seiner Überzeugung, Individuen und Gruppen unterschieden sich in ihrer Begabung und entsprechende Hierarchien seien biologisch festgelegt. Er lehnte die positive Diskriminierung und Quoten für unterrepräsentierte Gruppen ab, erinnerten ihn diese Eingriffe doch an den dystopischen Roman „Facial Justice“, in dem der Staat plastische Chirurgie vorschreibt, damit die Gesichter aller Mädchen gleich hübsch sind. Er hielt eine Gegenbewegung für nötig – eine Revolte gegen die Gleichheit der Menschen.
Nachdem er den rechtskonservativen Multimilliardär Charles Koch im Jahr 1976 bei der Gründung des Cato Institute unterstützt hatte, beteiligte er sich 1982 am Aufbau einer neuen Denkfabrik im Herzen des amerikanischen Südens: In Auburn (Alabama) entstand das Ludwig von Mises Institute for Austrian Economics, benannt nach Friedrich August von Hayeks Mentor, dessen Seminare Rothbard zwischen 1949 und 1959 in New York besucht hatte.
Möglichst radikal und möglichst weit entfernt von Washington
Obwohl Mises selbst kein Anarchokapitalist war, wurde das nach ihm benannte Institut das Flaggschiff der radikalsten Strömung des Libertarismus. Dass die Denkfabrik so weit von Washington entfernt war, zeigte deutlich, dass sie das von Mainstream-Einrichtungen wie dem Cato Institute und der Heritage Foundation betriebene Lobbying ablehnte. Das Mises Institute vertrat Außenseiterpositionen und sprach sich für die Sezession, die Notwendigkeit einer Rückkehr zum Goldstandard und Widerstand gegen die Desegregation aus. Sein Leiter war Rothbards Geistesverwandter und engster Vertrauter, Llewellyn „Lew“ Rockwell Jr., der seit seiner Tätigkeit für den konservativen Verlag Arlington House (der wenig subtil nach dem letzten Wohnort des Konföderiertengenerals Robert E. Lee benannt war) sowohl ein radikaler Libertärer als auch ein Befürworter des ethnischen Separatismus war. Als Lektor gab Rockwell Bücher über die katastrophalen Auswirkungen der Aufhebung der Apartheid und den Verrat an der weißen Politik im südlichen Afrika in Auftrag, die neben David Friedmans „Machinery of Freedom“ und hysterisch schwarzmalerischen Bestsellern wie „How to Profit from the Coming Devaluation” erschienen. Ein Buch, das Rockwell einem Autor vorschlug, trug den Arbeitstitel „Integration. The Dream that Failed”.
Persönlich war er überzeugt, die einzige Option sei eine „De-facto-Segregation“ zumindest der Mehrheit der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Wie Rothbard verband Rockwell eine extreme Laissez-faire-Politik mit einer Fixierung auf das Thema Hautfarbe. Im Jahr 1986 begann er, den Investment-Newsletter des Politikers und Münzhändlers Ron Paul herauszugeben, der sich ähnlichen Fragen widmete. Die Publikation, deren Name im Jahr 1992 in „Ron Paul Survival Report“ geändert wurde, war einträglich – die Abonnements spülten jedes Jahr fast eine Million Dollar in die Kassen. Der Newsletter, eine Art Ikea-Katalog für den kommenden „Rassenkrieg“, kommentierte aktuelle Ereignisse und informierte über Bücher und Dienste, die dem Leser dabei helfen konnten, sein Hab und Gut zu vergraben, sein Vermögen in Gold anzulegen oder ins Ausland zu schaffen, das eigene Haus in eine Festung zu verwandeln und seine Familie zu verteidigen. „Seien Sie vorbereitet“, empfahl die Redaktion. „Wenn Sie in der Nähe einer Großstadt mit einer nennenswerten schwarzen Bevölkerung leben, brauchen beide Eheleute eine Schusswaffe und müssen im Umgang damit geübt sein.“
In Südafrika sahen die Autoren ein warnendes Beispiel. Sie beklagten sich über die „Säuberung von Weißen“ und befürworteten eine Kantonisierung des Landes. Wenn die Palästinenser ein „Homeland“ haben könnten, fragte der Newsletter, warum konnten dann die weißen Südafrikaner keines haben?
Der Survival Report legte eine Vision für eine universelle Apartheid vor. „Die Integration hat nirgendwo Liebe und Brüderlichkeit hervorgebracht“, verkündete er. „Die Menschen ziehen die Gesellschaft von ihresgleichen vor.“ Das „Verschwinden der weißen Mehrheit“ bedeute, dass sich die Vereinigten Staaten langsam in Südafrika verwandelten. Die Weißen „ersetzen sich nicht selbst“, und Minderheitengruppen eigneten sich die staatlichen Ressourcen an. Die vorgeschlagene Lösung war altbekannt. „Der Alte Süden verstand es genau richtig: Sezession bedeutet Freiheit“, hieß es 1994 im Survival Report.
»Sezession bedeutet Freiheit«
Es war kein Zufall, dass im Newsletter dieselben Themen behandelt wurden wie im Rothbard-Rockwell Report, den die beiden Männer im Jahr 1990 zu veröffentlichen begannen. (Die Publikation wurde später in „Triple R“ umbenannt; als Paul nach Washington zurückkehrte, erhielten seine Leser kostenlose Abonnements.) Rockwell bezeichnete die Ideologie, die er gemeinsam mit Rothbard entwickelte, als „Paläolibertarismus“. Das Präfix drückte ihre Überzeugung aus, dass der Libertarismus von den freigeistigen Trends der 60er Jahre „gereinigt“ werden musste, um stattdessen konservative Werte hervorzuheben. Die Paläolibertären wollten „Hippies, Drogensüchtige und militant antichristliche Atheisten“ in der breiteren libertären Bewegung abschütteln, um die jüdisch-christlichen Traditionen sowie die westliche Kultur zu verteidigen und Familie, Kirche und Gemeinde als Schutz gegen den Staat und als Bausteine für eine kommende staatslose Gesellschaft in den Mittelpunkt zu rücken.
Die Paläolibertären sehnten eine kapitalistische anarchistische Zukunft herbei, aber sie gingen nicht davon aus, dass eine amorphe Masse atomisierter Individuen entstehen würde. Stattdessen glaubten sie, dass die Menschen in auf der heterosexuellen Kernfamilie beruhenden Gemeinschaften verankert sein würden, die Edmund Burke als die „kleinen Unterabteilungen“ (little platoons) bezeichnet hatte, denen wir in der Gesellschaft angehören. Es wurde als selbstverständlich betrachtet, dass sich diese kleinen Unterabteilungen abhängig von der ethnischen Zugehörigkeit voneinander trennen würden. „Der Mensch hat eine natürliche und normale Neigung dazu, sich mit Angehörigen der eigenen Hautfarbe, Nationalität, Religion, Klasse, des eigenen Geschlecht oder sogar der eigenen politischen Partei zusammenzutun“, schrieb Rockwell. „Es ist nichts schlecht daran, dass Schwarze ‚das Schwarze‘ bevorzugen. Aber die Paläolibertären sagen dasselbe über Weiße, die ‚das Weiße‘, oder Asiaten, die ‚das Asiatische‘ bevorzugen.“
In der Wiederbelebung des Sezessionismus nach dem Ende des Kalten Kriegs sahen die Paläolibertären eine Gelegenheit zur Neugestaltung der politischen Geografie. „So muss es gewesen sein, die Französische Revolution zu erleben“, notierte Rothbard. „Normalerweise bewegt sich die Geschichte im Schneckentempo voran … und dann: Wumms!“ Über die Auflösung der Sowjetunion schrieb Rothbard, es sei „wunderbar, mit eigenen Augen den Tod eines Staates zu sehen“. Damit meinte er natürlich das Ende eines bestimmten Staats, aber zugleich auch den erhofften Tod aller Staaten. Die Sezession war das Mittel, die anarchokapitalistische Gesellschaft der Zweck. Die Paläolibertären hofften, die Auflösung werde sich auf der anderen Seite des Atlantik fortsetzen. Rothbard wählte harte Worte: „Wir müssen der Sozialdemokratie ein Ende machen“, schrieb er. „Wir müssen der Great Society ein Ende machen. Wir müssen dem Wohlfahrtsstaat ein Ende machen. […] Wir müssen das 20. Jahrhundert rückgängig machen.“
Ihre eigene Aufgabe sahen die Paläolibertären darin, sich auf den Tag nach dem Zusammenbruch vorzubereiten. Angesichts des Schicksals der Sowjetunion stellten sie verlockende Fragen: Was würde in ihrem eigenen Land geschehen, wenn die Staatsordnung über Nacht zusammenbräche? Wie könnte das kollektive Leben weiter funktionieren?
Der Gedanke war nicht unangenehm. Er eröffnete die reizvolle Möglichkeit, ein Jahrhundert weltfremder staatlicher Eingriffe ungeschehen zu machen und von vorn zu beginnen. Rockwell träumte von einer selbstverabreichten Schocktherapie, in der Luft, Boden und Wasser privatisiert werden sollten. Man würde Autobahnen und Flughäfen verkaufen, das Wohlfahrtssystem zerschlagen, den Dollar wieder ans Gold koppeln und die Armen sich selbst überlassen. Allerdings waren sich die Paläolibertären der Tatsache bewusst, dass sie auf den Trümmern des Staates eine neue Ordnung errichten müssten. Mit der extremen Rechten teilten sie die Überzeugung, dass Traditionen und zivilisatorische Werte benötigt wurden, um die Gemeinschaften zusammenzuhalten. Beide Gruppen sprachen sich ausdrücklich für ein „Rassenbewusstsein“ aus, was sie in der öffentlichen Meinung marginalisierte, aber Möglichkeiten für neue Allianzen eröffnete.
Ein Bündnis zwischen Wirtschaftsradikalen und Rechtsextremen
Rothbard vermittelte ein Bündnis mit einer rechtsextremen Gruppe, die ihre Basis im Rockford Institute in Illinois hatte und deren Mitglieder sich als „Paläokonservative“ bezeichneten. Beide Partner in der „Paläo-Allianz“ waren der Meinung, dass der Verleugnung der Realität kultureller und ethnischer Unterschiede ein Ende gemacht werden musste, und sie wollten die politischen Einrichtungen mit Blick auf grundlegende psychologische und biologische Tatsachen neu gestalten. Beide Gruppen spotteten über die Programme des „Kriegs-und-Wohlfahrtsstaats“. Militärische Interventionen im Ausland, Bürgerrechte und Armutsbekämpfung dienten in ihren Augen lediglich der Beschäftigung träger Bürokraten und den Interessen parasitärer Politiker.
Das erste Treffen der Paläo-Allianz fand im Jahr 1990 in Dallas statt. Die weitläufige Ebene rund um Dallas und das südafrikanische Veld unterschieden sich nicht allzu sehr voneinander. An beiden Orten waren Mythen entstanden, die sich hartnäckig hielten. In beiden Ländern waren weiße Siedler in Wellen eingetroffen und hatten im 19. Jahrhundert das von einer indigenen Bevölkerung bewohnte Gemeinschaftsland in Privatbesitz umgewandelt. In Südafrika waren die Voortrekkers ins Landesinnere vorgestoßen, in Texas waren Wagenzüge aus dem Westen zum Golf vorgedrungen. Es wurden noch immer Geschichten über diese beiden Migrationsbewegungen erzählt: über die Formbarkeit der politischen Geografie, über weiße Hände, die vermeintlich unfruchtbarem Boden Früchte abgewannen, und über die Notwendigkeit der ethnischen Solidarität angesichts eines existenzbedrohenden dunkelhäutigen Feindes.
Die Siedlerideologie verband Menschen auf verschiedenen Seiten des Erdballs. Rothbard gestand Pionieren und Siedlern, in denen er die libertären Akteure par excellence sah, einen Sonderstatus zu: Sie waren „die ersten Nutzer und Verwandler“ des Territoriums. Den Besitz von „unberührtem Land“, das durch harte Arbeit in wertvollen Boden verwandelt worden war, rückte er in den Mittelpunkt des „neuen libertären Credos“. Auf den Einwand, das von den Siedlern vorgefundene Land sei nie wirklich menschenleer gewesen, erwiderte Rothbard, selbst wenn die indigene Bevölkerung Nordamerikas ein Recht auf das Land gehabt habe, das sie gemäß dem Naturrecht bebaute, habe sie dieses Recht eingebüßt, da ihre Mitglieder es nicht individuell innegehabt hätten. Die indigene Bevölkerung, erklärte er, habe „unter einem kollektivistischen Regime“ gelebt. Es habe sich um Protokommunisten gehandelt, also sei ihr Anspruch auf das Land nichtig.
»Ich liebe die Freiheit, ich hasse die Gleichheit«
Die neue Gruppe bezeichnete sich als John Randolph Club. Ihr Namenspatron war ein Sklavenhalter, dessen Leitspruch lautete: „Ich liebe die Freiheit, ich hasse die Gleichheit.“ Die Mitgliederliste war ein Who’s who der extremen Rechten. Zu den Gründungsmitgliedern zählte Jared Taylor, dessen weiß-nationalistische Zeitschrift „American Renaissance“ gegen eine fortschreitende „Enteignung“ der Weißen durch Nicht-Weiße protestierte. Sodann war da Peter Brimelow, der bekannteste Gegner der nichtweißen Einwanderung, dessen Buch „Alien Nation“ eine „ausdrücklich suprematistische Position“ als Gegenstand der öffentlichen Debatte reetabliert hatte. Weitere Mitglieder waren der Kolumnist Samuel Francis, der die Amerikaner europäischer Herkunft dazu aufrief, ihre „Identität“ und „Solidarität“ mittels eines „weißen Rassenbewusstseins“ zu bekunden, sowie der Journalist und Politiker Pat Buchanan, dessen nativistische Tiraden gegen die nichtweiße Einwanderung Vorboten der Rhetorik Donald Trumps darstellten.
Statt der indigenen Selbstbestimmung vertrat der John Randolph Club die Forderung nach Autonomie für die weiße Bevölkerung des amerikanischen Südens. Die Anhänger des Alten Südens, die als „neokonföderierte Bewegung“ bekannt waren, trugen den globalen Geist der Sezession direkt in die amerikanische Politik. Die Neokonföderierten versuchten, ihre Forderungen mit dubiosen Forschungsergebnissen zu untermauern, denen zufolge sich die Amerikaner im Süden ethnisch von denen im Norden unterschieden, da sie nicht englischstämmig, sondern Nachfahren von Einwanderern aus Wales, Irland und Schottland waren. Die These vom „keltischen Süden“, die im Wesentlichen auf einem 1988 erschienenen Buch mit dem Titel „Cracker Culture“ beruhte, wies zahlreiche Lücken auf – ganz zu schweigen von dem kleinen Problem der Geschichte der Sklaverei und ihres demografischen Vermächtnisses –, aber sie taugte als behelfsmäßige Übersetzung paralleler Entwicklungen auf der anderen Seite des Atlantiks.
Italiens Lega Nord als Vorbild
Die Neokonföderierten wurden explizit von europäischen Beispielen inspiriert. Ihre wichtigste Organisation, die Southern League (die später in League of the South umbenannt wurde), hatte ihren Namen bei der Lega Nord entlehnt, der rechtsradikalen Partei, die lange für die Loslösung Norditaliens vom übrigen Land eintrat. Im „New Dixie Manifesto“, das in der „Washington Post“ veröffentlicht wurde, rief die Southern League zur Abspaltung vom „multikulturellen kontinentalen Imperium“ der Vereinigten Staaten und zur Gründung eines Commonwealth der Südstaaten auf. Auf ihrer Website fand der Besucher Material über Homelands mit Links zu Sezessionisten im Südsudan, auf Okinawa, in Flandern und Südtirol. „Unabhängigkeit. Wenn sie in Litauen gut klingt, wird sie auch in Dixie toll klingen!“ Auf der Seite fand man auch einen Link zu einer Partei, die später den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union durchsetzen sollte: zur UK Independence Party (Ukip).
Die meisten Neokonföderierten waren keine Anarchokapitalisten, aber Rothbard stimmte zu, dass „das Recht auf Sezession, das Recht verschiedener Regionen, Gruppen oder ethnischer Nationalitäten zum Ausscheiden aus der größeren Einheit und zur Gründung einer eigenen unabhängigen Nation“ erhalten und verteidigt werden müsse. Er verfocht auch eine revisionistische Interpretation des Bürgerkriegs. Er verglich die Sache der Union mit der abenteuerlichen Außenpolitik der Vereinigten Staaten in den 90er Jahren: Die USA durchforsteten die Welt nach Ungeheuern, die sie im Namen der Demokratie und der Menschenrechte zur Strecke bringen konnten, doch dieser perverse Feldzug erreiche keines seiner erklärten Ziele, sondern führe lediglich zu Tod und Zerstörung. „Die Tragödie der Niederlage des Südens im Bürgerkrieg“ sah er darin, dass sie „die Idee der Sezession in diesem Land beerdigte. Aber Macht macht kein Recht, und die Ursache der Sezession kann erneut auftreten.“
Beim ersten Treffen der Paläo-Allianz erklärte Rothbard, beide Gruppen verträten den sozialen Konservatismus und befürworteten einen Austritt aus dem größeren Staat. In einer Welt ohne Zentralregierung werde die Form neuer Gemeinschaften von „Nachbarschaftsverträgen“ zwischen Grundeigentümern festgelegt. An anderer Stelle bezeichnete er diese Einheiten, die große Ähnlichkeit mit Neal Stephensons Idee der Phylen hatten, als „Nationen durch Zustimmung“ (nations by consent). Das Programm bestand in Desintegration und Segregation, um die Homogenität der Gemeinschaft zur Grundlage des Gemeinwesens zu machen.
Die „alte amerikanische Republik“ von 1776 war nach Rothbards Einschätzung zuerst von „Europäern und dann von Afrikanern, nichtspanischen Lateinamerikanern und Asiaten“ überschwemmt und überwältigt worden. Da die Vereinigten Staaten „nicht länger eine einzige Nation“ seien, schrieb er, „sollten wir ernsthaft über eine nationale Trennung nachdenken“. Man könne klein anfangen und nur einen Teil des nationalen Territoriums beanspruchen. „Wir müssen es wagen, das Undenkbare zu denken“, erklärte er, „bevor wir irgendeines unserer edlen und weitreichenden Ziele erreichen können.“ Wenn es nach ihm ging, würde der wunderbare Tod des Staates auch nach Amerika kommen.
Sezession und Kapitalismus
Sezessionistische und rechtsextreme Bewegungen wie die Neokonföderierten werden oft ausschließlich unter politischen oder kulturellen Gesichtspunkten betrachtet, als Symptome einer manchmal krankhaften Fixierung auf die Ethnizität, die alle wirtschaftlichen Überlegungen ausschließt. Aber das ist ein Irrtum. Wir müssen die radikale Politik der 90er Jahre auch mit Blick auf den Kapitalismus verstehen.
Denn Rothbard und Rockwell gingen stets von der Wirtschaft aus. Als Anhänger des Goldstandards, den die USA in den 70er Jahren aufgegeben hatten, waren sie der Meinung, das auf dem Fiatgeld beruhende monetäre System sei dazu verurteilt, in eine Hyperinflation zu schlittern. Die Zerstückelung der großen Staaten war eine Möglichkeit, der drohenden monetären Kernschmelze zu entgehen und kleinere Staaten zu gründen, die nach dem Zusammenbruch besser in der Lage sein würden, sich zu reorganisieren. Ron Paul äußerte die Überzeugung, der Wandel werde „mit einem Desaster und einer Explosion“ einhergehen. Er verglich die Vereinigten Staaten mit der Sowjetunion und erklärte: „Unter den gegebenen Bedingungen wird der Staat schließlich zerfallen.“ Er beschrieb seinen Traum von einer Republik Texas „ohne Einkommenssteuer, mit einer stabilen Währung und einer blühenden Metropole“. Selbst jene, die keine Katastrophe in der nahen Zukunft erwarteten, waren überzeugt, dass die Globalisierung der 90er Jahre bessere Bedingungen als je zuvor für das Gedeihen kleiner Staaten schuf. Singapur zeigte, dass eine Konzentration auf Export und Freihandel eine Volkswirtschaft den Schwankungen der globalen Nachfrage ausliefern konnte, aber ein Land brauchte keine eigene Landwirtschaft mehr, um seine Bevölkerung zu ernähren. Die Marktradikalen wiesen immer wieder darauf hin, dass winzige Staaten wie Luxemburg und Monaco zu den reichsten der Welt zählten. Die Paläolibertären hofften, die Ausbreitung der Option Sezession werde zur Beschleunigung von Wirtschaftsreformen beitragen, welche die Sozialdemokratie durch eine schlankere Version des Kapitalismus ersetzen würden. Der eloquenteste Vertreter dieser Argumentation war Rothbards Schützling Hans-Hermann Hoppe, der die Fackel der Vision seines Mentors nach dessen Tod im Jahr 1995 weitertrug.
Hoppe, ein gebürtiger Österreicher, der in Frankfurt am Main Soziologie studiert hatte, war in die Vereinigten Staaten ausgewandert und hatte sich Rothbard 1986 an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der University of Nevada in Las Vegas angeschlossen. Er war im John Randolph Club aktiv und gelangte zu der Einschätzung, dass die Verhältnisse nach dem Kalten Krieg auf den Kopf gestellt wurden, da der sozialistische Ostblock, der lange Zeit vor sich hin gedämmert hatte, sich zum Vorreiter des globalen Kapitalismus entwickelte. Estland wurde von einem Mann Anfang dreißig regiert, der erklärte, das einzige Buch über Wirtschaft, das er je gelesen habe, sei Milton Friedmans „Free to Choose“. Im winzigen Montenegro gründete man eine libertäre Privatuniversität. Überall in Osteuropa wurden auf Anraten neoliberaler Denkfabriken die Steuern gesenkt.
Hoppe war der Meinung, ein Osteuropa kleiner, offener Volkswirtschaften werde die westlichen Sozialstaaten unter Druck setzen, da die osteuropäischen Länder Investitionen aufsaugten und Industriearbeitsplätze dorthin verlagert wurden. „Die Entstehung einer Handvoll osteuropäischer ‚Hongkongs‘ oder ‚Singapurs‘“, schrieb er, „würde rasch beträchtliche Mengen Kapitals und unternehmerisches Talent aus dem Westen anlocken.“
Das zweite Jahrtausend rückgängig machen (Hans-Hermann Hoppe)
Hoppe sah eine deutliche Verstärkung der Dynamik der nationalen Selbstbestimmung voraus, die Woodrow Wilson nach dem Ersten Weltkrieg angeregt hatte, als das Habsburgerreich und das Osmanische Reich in Staaten und Mandatsgebiete aufgespalten wurden. Die zukünftigen Staaten würden intern homogen sein, schrieb er; die „erzwungene Integration der Vergangenheit“ werde durch die „freiwillige physische Trennung unterschiedlicher Kulturen“ ersetzt. Wenn es nach Hoppe ging, würden die neuen Territorien sehr viel kleiner sein als die zeitgenössischen Nationalstaaten. „Je kleiner das Land“, erklärte er, „desto größer der Druck, sich nicht für den Protektionismus, sondern für den Freihandel zu entscheiden.“ Er führte die Mikronationen und Stadtstaaten als Vorbilder an und forderte eine Welt von „Zehntausenden freien Ländern, Regionen und Kantonen, von Hunderttausenden freien Städten“. Hoppe schwebte dabei so etwas wie das mittelalterliche Europa vor – im Jahr 1000 war der Kontinent von einem Flickenteppich von Tausenden verschiedenen Staatsorganisationen bedeckt gewesen, die im Lauf der Zeit zu wenigen Dutzend Nationalstaaten verschmolzen worden waren. Rothbard hatte gefordert, das 20. Jahrhundert rückgängig zu machen. Hoppe ging noch weiter: Er wollte das zweite Jahrtausend rückgängig machen.
Im Jahr 2005 veranstaltete Hoppe an der türkischen Ägäis im vergoldeten Ballsaal eines Hotels, das seiner Frau gehörte, das erste Treffen der „Property and Freedom Society“ (PFS). In ihren jährlichen Versammlungen bringt die PFS frühere Mitglieder des 1996 aufgelösten John Randolph Club mit neuen Befürwortern des staatslosen Libertarismus und der rassifizierten Sezession zusammen. Propheten der ethnischen und sozialen Aufgliederung teilen sich die Bühne mit Investmentexperten und Finanzberatern. Bei einem Treffen präsentierte der Psychologe und „Rassen“-Theoretiker Richard Lynn sein neues Buch über Hautfarbe und Intelligenz, „The Global Bell Curve“, während andere Redner über Themen sprachen wie „Das öffentliche Gesundheitswesen als Hebel für die Tyrannei“, „Wie man sich auf Kosten anderer bereichert, ohne dass es jemand merkt“ oder „Das Trugbild der billigen Kredite“.
Bei einem Treffen, bei dem auch Leon Louw einen Vortrag hielt, sprach Carel Boshoffs Sohn Carel Boshoff IV. über das „Experiment“ in Orania. Einer der Organisatoren pries Orania als ein „seltenes Beispiel“ für eine friedliche Sezession. Peter Thiel, der in dieser Mischung aus Sozialkonservatismus und antidemokratischem Marktradikalismus zu Hause war, sollte ebenfalls bei einer PFS -Versammlung sprechen, sagte seinen Auftritt jedoch in letzter Minute ab.
Der Kampf gegen das allgemeine Wahlrecht
Beim Jahrestreffen 2010 betrat ein in Texas aufgewachsener Weißer die Bühne. Er war jünger als die anderen Teilnehmer, trug einen Tweed-Blazer und stellte ein Macbook auf das Rednerpult. Richard Spencer sah aus wie der Geschichtsstudent, der er vor Kurzem noch gewesen war. Er hatte gerade ein Onlinemagazin namens „The Alternative Right“ gegründet, eine Bezeichnung, die ihn berühmt machen sollte. In seinem Vortrag zeichnete Spencer das Bild einer zukünftigen Welt, die große Ähnlichkeit mit der Vision der Paläo-Allianz hatte. Die Trennung von Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben würde die neue Norm sein: „Nationalistische Latino-Gemeinschaften“ in Kalifornien und dem Südwesten, schwarze Gemeinden in den „Innenstädten“, ein „christlicher rekonstruktivistischer protestantischer Staat“ im Mittleren Westen. In Spencers Augen steuerte die zeitgenössische Politik auf die Desintegration zu. Die Aufgabe bestand darin, den Zusammenbruch zu beschleunigen und sich darauf vorzubereiten.
Die breite Öffentlichkeit lernte Spencer sechs Jahre später kennen, als er den nationalsozialistischen Gruß „Sieg Heil!“ abwandelte und bei einer Kundgebung in Washington „Heil Trump! Heil unserem Volk! Heil dem Sieg!“ rief. Manche sahen die Verwirklichung des Traums vom großen Bruch nach Trumps Wahlsieg näherrücken. Der Präsident des Mises Institute schrieb, Trump habe „die Risse im globalistischen Narrativ“ von einer geeinten Weltregierung aufgedeckt, und die Libertären sollten dies nutzen, indem sie alle Formen der Sezession unterstützten.
Vor allem Hoppe wurde zu einer Ikone der extremen Rechten. Er verdankte sein Ansehen in diesen Kreisen insbesondere seinem Buch „Democracy: The God That Failed“, in dem er das allgemeine Wahlrecht als die Erbsünde der Moderne bezeichnete, habe es doch die Kaste der „natürlichen Eliten“ entmachtet, die im Feudalismus die Gesellschaft organisiert hatten. Der von der Demokratie hervorgebrachte Sozialstaat habe dysgenische Auswirkungen, da er die Reproduktion der weniger Fähigen fördere und die Talentierten an der Entfaltung hindere. Hoppe stützte sich auf die Behauptungen von „Rassen“-Forschern, um seine These zu untermauern, laut welcher der Prozess der „Entzivilisierung“ nur rückgängig gemacht werden könne, indem sich die Gemeinwesen in kleinere, homogene Gemeinschaften aufspalteten.
Besonderen Anklang bei der extremen Rechten fand eine Passage, in der sich Hoppe für die Ausweisung politisch unerwünschter Personen aussprach: „In einer libertären Gesellschaftsordnung kann es keine Toleranz gegenüber Demokraten und Kommunisten geben. Sie werden physisch von der übrigen Gesellschaft getrennt und ausgestoßen.“ Hoppes Konterfei taucht regelmäßig in den sozialen Medien auf; die „Hoppean Snake“, eine Schlange, die die Mütze des chilenischen Diktators Augusto Pinochet trägt und bisweilen zusammen mit einem Helikopter abgebildet wird (eine Anspielung auf südamerikanische Todesschwadronen, die linke Oppositionelle ins offene Meer warfen), ist ein beliebtes Meme unter Rechtsextremen, die über die Möglichkeit der „physischen Beseitigung“ (removal) fantasieren.
In einem seiner letzten Vorträge vor seinem Tod malte sich Rothbard auf einer Plantage in der Nähe von Atlanta den Tag aus, an dem die Statuen von Generalen und Präsidenten der Union „gestürzt und eingeschmolzen“ würden wie die Statue Lenins in Ost-Berlin; an ihrer Stelle sollten Monumente für Helden der Konföderierten errichtet werden. Natürlich existierten bereits zahlreiche entsprechende Statuen. Die Verteidigung eines dieser Denkmäler, eines Reiterstandbilds von General Robert E. Lee in Charlottesville (Virginia), wurde im August 2017 zu einem symbolischen Akt für weiße Nationalisten. In Uniformen aus weißen Poloshirts und Khakihosen gekleidet, marschierten sie mit Ölfackeln durch die Stadt und gaben ihrer Angst vor einem weißen Bevölkerungsschwund Ausdruck: „Ihr werdet uns nicht ersetzen.“ Einer der Organisatoren der Kundgebung, ein weißer Nationalist und Anhänger Hoppes, verkaufte Aufkleber mit dem Slogan „I love Physical Removal“. Und anstatt sich von solchen Anhängern zu distanzieren, lobte Hoppe ihre Ansichten. Im Jahr 2018 schrieb er das Vorwort für ein Buch mit dem Titel „White, Right, and Libertarian“, dessen Umschlag vom Bild eines Hubschraubers geziert wurde, an dem vier Körper hingen, deren Köpfe mit den Symbolen von Kommunismus, Islam, Antifa und Feminismus versehen waren. Hoppe war der Meinung, die extreme Rechte zeige mit ihrer Betonung einer gemeinsamen Kultur und sogar der gemeinsamen Hautfarbe, wie in einer zukünftigen staatslosen Gesellschaft soziale Kohäsion erreicht werden konnte. Ihr militanter Widerstand gegen die Einwanderung Nicht-Weißer war auch mit der Forderung nach geschlossenen Grenzen vereinbar, welche die Paläolibertären seit den frühen 90er Jahren erhoben. Er schien keine Einwände gegen ein Bild zu haben, das in Internetforen auftauchte und das Rothbard, Hoppe und Mises (gezeichnet im Stil von Pepe dem Frosch, einem beliebten Symbol der Far Right) vor der schwarz-goldenen anarchokapitalistischen Flagge zeigte. Hoppe trug darauf ein Sturmgewehr.
Hier zeigt sich in Reinkultur, was diese extreme Version des Anarchokapitalismus kennzeichnet – ethnisch homogene Zonen, die durch die Hautfarbe definiert sind, und eine radikal-militante Intoleranz.
Dieser Beitrag beruht auf dem neuen Buch von Quinn Slobodian „Kapitalismus ohne Demokratie. Wie Marktradikale die Welt in Mikronationen, Privatstädte und Steueroasen zerlegen wollen“, das soeben im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Dort finden sich auch die Quellennachweise. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Stephan Gebauer.