Warum sich das BSW zu Unrecht auf die Brandtsche Ostpolitik beruft
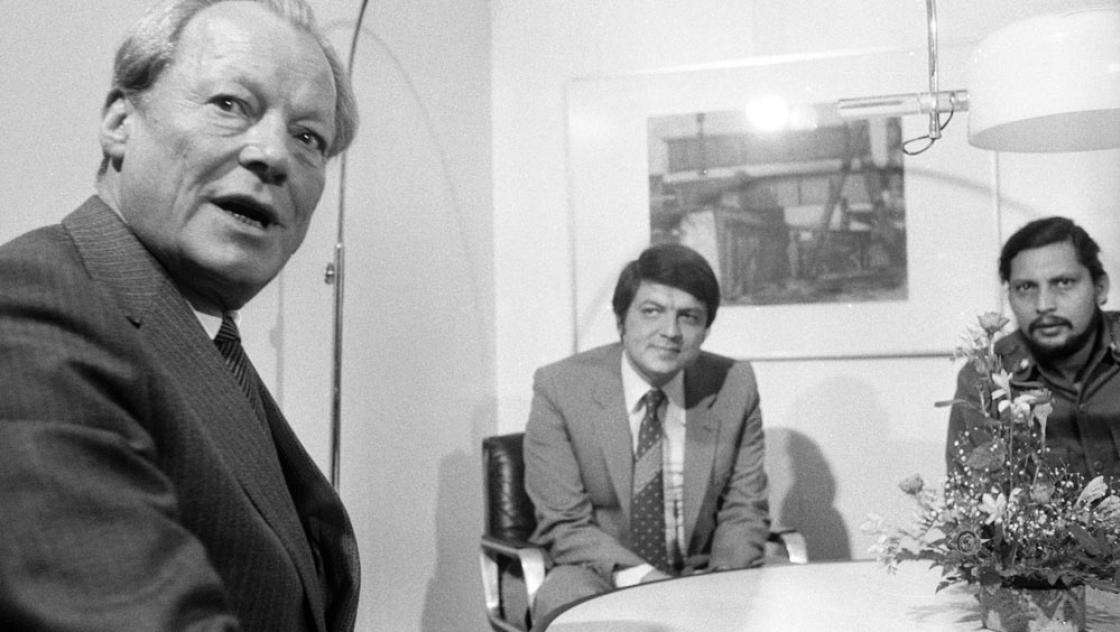
Bild: Willy Brandt und Sergio Ramirez (2.v.li., Nicaragua) in Bonn, 12.3.1980 (IMAGO / sepp spiegl)
Wird in Deutschland über Krieg oder Frieden, über Wehrhaftigkeit oder Abrüstung gestritten, dann fällt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Name: Willy Brandt. Von Sahra Wagenknecht bis Boris Pistorius reklamieren viele auf der Linken, die wahren Erben Brandts zu sein. Gute Argumente – oder besser: passende Zitate – scheint dafür jeder vorbringen zu können.
Brandts politischer Werdegang ist facettenreich wie kaum ein anderer. Dass er kein Pazifist war, wusste man seit dem Spanischen Bürgerkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. Welch überragenden Stellenwert für ihn der Frieden besaß, brachte er auf die Formel „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“. Wie wichtig ihm zugleich die Wehrhaftigkeit der Bundesrepublik war, beweisen Verteidigungsausgaben in Höhe von drei Prozent des Brutto-Inlandsprodukts in seiner Zeit als Kanzler. Dass er aber auch die Furcht vor einem Atomkrieg ernst nahm und teilte, zeigt seine Ablehnung der Nachrüstung. Willy Brandt: ein Politiker voller Widersprüche, gar ein Opportunist oder die Inkarnation des kräftigen Sowohl-als-Auch? Welchen Sinn ergibt da der Wettbewerb um das überzeugendste Brandt-Zitat?
Nicht viel, das scheint klar zu sein. Doch führt gerade diese scheinbare Widersprüchlichkeit auf die richtige Spur. In seiner Abschiedsbotschaft an den Kongress der Sozialistischen Internationale (SI), der im September 1992, wenige Wochen vor Brandts Tod, in Berlin zusammentrat, findet man einen Satz, der hilft, Brandt zu verstehen: „Jede Zeit will eigene Antworten.“[1]
Gemeinhin wird der Satz als Mahnung an die Nachgeborenen verstanden, sie sollten nicht auf alte Rezepte vertrauen. Er kann aber auch als Resümee von Brandts politischem Wirken aufgefasst werden: Weil jede Zeit eigene Antworten will, fallen die Antworten je nach den Zeitumständen unterschiedlich aus. Über fünfzig Jahre zuvor hatte er nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes bereits gefordert: „Eine neue Lage ist entstanden, und diese neue Lage erfordert nachzudenken, um zu Klarheit zu gelangen. Die Haltung der Bewegung muss mit den neuen Ereignissen in Übereinstimmung gebracht werden.“[2] Brandt war demnach kein Opportunist, kein Politiker ohne inneren Kompass, sondern ein Realist, der stets die Lage neu analysierte und daraus seine Antworten ableitete. Mit Prinzipienlosigkeit hatte dies nichts zu tun. Im Gegenteil: Die Freiheit stand für Brandt über allem, sie musste verteidigt werden, notfalls auch mit Waffengewalt, aber direkt danach kam schon das Streben nach Frieden, der errungen und gesichert werden müsse.
Wenn man Willy Brandt und seine Politik nicht gänzlich einmotten, sondern weiterhin als Füllhorn voller Anregungen und Warnungen nutzen will, dann gilt es, historische Umstände zu identifizieren, die den heutigen ähneln. Dann kann man sehen, was uns das politische Handeln von Brandt für die Gegenwart sagt. Einen solchen Fall stellt Brandts Politik gegenüber dem sandinistischen Nicaragua in den 1980er Jahren dar. Die US-Regierung unter Ronald Reagan betrachtete das Land als Bedrohung der amerikanischen Sicherheit, wie dies heute Wladimir Putin von der Ukraine behauptet. Wie reagierte vor vierzig Jahren Brandt, und wie sehen im Vergleich dazu die Argumente derjenigen deutschen Linken aus, die heute Putins Bedrohungsanalyse teilen? Können sie sich zu Recht auf Willy Brandt berufen?
Die These vom bedrängten Russland
Schauen wir uns zuerst die Argumente der „Putin-Versteher“ an, wie sie von ihren Gegnern despektierlich genannt werden. Auch sie sagen, Russland sei der Angreifer. Dies gilt selbst für den Journalisten und Friedensaktivisten Reiner Braun, lange Jahre DKP-Mitglied. Er stellte Ende 2022 in einem Beitrag für die Zeitschrift „Wostok“, Nachfolgerin des Botschaftsorgans „Sowjetunion heute“, fest, es handele sich um einen „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine“. Kein Passus der UN-Charta rechtfertige diesen „präventiven Angriffskrieg gegen ein unabhängiges Land“.[3]
An dieser Stelle wird die Distanzierung von Moskaus Vorgehen bereits brüchig: Der Überfall soll ein „Präventivkrieg“ gewesen sein, Russland soll also einem ukrainischen Angriff zuvorgekommen sein. Nicht nur deswegen entsteht bei Braun wie auch bei Äußerungen von Sahra Wagenknecht und anderen BSW-Mitgliedern schnell der Eindruck, ihre Charakterisierung des russischen Vorgehens als völkerrechtswidrig sei nicht mehr als eine angesichts der erdrückenden Evidenz pflichtschuldig vorgebrachte Distanzierung, die aber sogleich durch eine Einschränkung überkompensiert wird. Die Einschränkung, die stets folgt, nimmt den Westen in Mitverantwortung. Braun: „Natürlich hat auch dieser Krieg eine Vorgeschichte oder besser eine jahrzehntelange westliche Provokation, genannt Nato-Osterweiterung. Und dieser Krieg hat auch nicht am 24. Februar 2022 begonnen, wahrscheinlich ist auch das Jahr 2014/15 als Kriegsbeginn zu kurz gegriffen.“ EU und Nato wollten schon zuvor, „die Ukraine in das ‚westliche Lager‘ holen“. Braun verweist als Beleg auf Reden des damaligen EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso aus dem Jahr 2008. „Dieses Ziel, verbunden mit einer massiven Militarisierung der Ukraine durch die Nato, und auch der Schießkrieg gegen die ‚Volksrepubliken Donezk und Luhansk‘ sind Teil einer aggressiven westlichen Politik.“
Sahra Wagenknecht teilt diese Sichtweise: „‚Es geht darum, dass die Russen nicht akzeptieren, dass die Ukraine ein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird, mit Militärstützpunkten und Raketenbasen.‘“[4] Und ebenso das BSW-Mitglied Michael von der Schulenburg: „Der Grund dieses Krieges war auch die geplante Expansion der Nato in die Ukraine.“[5] Auch Sozialdemokraten wie beispielsweise Peter Brandt, der älteste Sohn Willy Brandts, werden nicht müde, die Rolle des Westens beim Weg in den Krieg zu betonen.
Die Ukraine und darüber hinaus der Westen tragen also in dieser Lesart eine Mitschuld daran, dass Russland den Nachbarstaat überfiel. Angeblich sah Putins Regierung keinen anderen Ausweg, um einer unmittelbaren militärischen Bedrohung an seiner Westgrenze, womöglich sogar einem Angriff aus dieser Richtung, zuvorzukommen. Braun schlussfolgert: „Für den Frieden in der Ukraine sind Nato-Freiheit und Neutralität der Ukraine eine unabwendbare Voraussetzung. […] Frieden ist möglich, bei vorhandenem politischen Willen! Die Ukraine blockiert hier aus Systemüberlebensinteressen.“
Vereinnahmung der Entspannungspolitik
Zugleich beschwören Braun und andere immer wieder Willy Brandt als Vorbild und seine Ostpolitik als Mahnung, trotz allem eine Verständigung mit Russland zu suchen. Braun fasst – zustimmend – Äußerungen von Gesprächspartnern in Moskau Ende 2022 so zusammen: „Viele hätten in der Tradition von Willy Brandt und Egon Bahr eine [von den USA] eigenständige, verständnisvollere Rolle [der Bundesregierung] erwartet.“ Für sich selbst reklamiert er: „Es bleibt die Grundlage unseres Engagements und unserer Überzeugung, was Willy Brandt bei der Verleihung des Friedensnobelpreises ausgeführt hat: ‚Frieden ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Frieden.‘“[6] Ähnlich klingt Sevim Dağdelen, BSW-Außenpolitikerin und Wagenknecht-Vertraute: „Willy Brandt hat mit seiner Entspannungspolitik ja auch nicht in einer ganz komfortablen Lage begonnen. Das sollte Vorbild sein.”[7] Im BSW-Programm heißt es: „Unsere Außenpolitik steht in der Tradition des Bundeskanzlers Willy Brandt und des sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow, die dem Denken und Handeln in der Logik des Kalten Krieges eine Politik der Entspannung, des Interessenausgleichs und der internationalen Zusammenarbeit entgegengesetzt haben.“[8]
Was hat das alles mit Nicaragua zu tun? Nach den gerade dargelegten Maßstäben für die Verteilung der „Schuld“ am Krieg Russlands gegen die Ukraine hätte Willy Brandt sich in den 1980er Jahren von Nicaragua distanzieren und stattdessen Verständnis für Ronald Reagan aufbringen müssen. Denn auch die Sandinisten waren in der Logik von Braun, Wagenknecht und Co. „mitschuldig“. Klingt abstrus, ist aber die Konsequenz aus deren Analyse der Vorgeschichte des russischen Angriffskrieges. Wie Putin heute die Ukraine, betrachtete Reagan damals Nicaragua als Bedrohung der nationalen Sicherheit. Damals wie heute lässt sich trefflich darüber streiten, wie ernst solche Äußerungen zu nehmen sind, aber wer Putin dies zubilligt, muss es retrospektiv auch bei Reagan gelten lassen. Denn er konnte Argumente anführen, die nicht weniger stichhaltig – oder andersherum: nicht weniger herbeigeholt – waren als heute die von Putin.
Kurz zur Erinnerung: 1979 stürzte in Nicaragua die Sandinistische Befreiungsfront FSLN den Somoza-Clan, der hinter der Fassade von Pseudo-Wahlen seit Jahrzehnten eine Familiendiktatur aufgebaut hatte. Bis kurz vor Schluss standen die Vereinigten Staaten zu Somoza. Die Sandinisten bezeichneten sich mehrheitlich als Marxisten-Leninisten, aber durch Maßnahmen wie eine Alphabetisierungskampagne und eine Bodenreform sowie durch das Versprechen baldiger Wahlen gewannen sie die Unterstützung der westeuropäischen Sozialdemokratie.
Außenpolitisch orientierte sich die neue Regierung schnell zum Ostblock. Ab 1980 gelangten sowjetische Waffen über Libyen und Algerien nach Nicaragua. Im Mai des Jahres reiste eine sandinistische Delegation nach Moskau, um die Beziehungen zu vertiefen. Eines der Ziele war der Beitritt zum östlichen Wirtschaftsbündnis Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). Im Juli 1981 trafen in Nicaragua schwere Waffen wie Panzer und Artillerie aus der Sowjetunion ein und im November unterzeichneten die Verteidigungsminister einen Vertrag über weitere Waffenlieferungen. Bis 1985 sollten demnach Mig-21-Flugzeuge geliefert werden, Piloten des mittelamerikanischen Landes begannen ihre Ausbildung in Bulgarien, doch am Ende war Moskau das Geschäft zu heikel, die Flugzeuge wurden nie auf den Weg gebracht.
Erdöl erhielt Nicaragua von der Sowjetunion zu Vorzugspreisen, auch günstige Kredite gewährte Moskau seinem Verbündeten. 1984 bekundete die Regierung Nicaraguas erstmals öffentlich ihren Wunsch, Mitglied des Warschauer Pakts zu werden. Seine „Linientreue“ hatte das Land bereits 1981 unter Beweis gestellt, als es die Verhängung des Kriegsrechts in Polen begrüßte, mit dessen Hilfe dort die Gewerkschaft Solidarność unterdrückt werden sollte. Im Inneren verschärfte die sandinistische Regierung kontinuierlich die Repression gegen Oppositionelle, die Wahlen wurden immer weiter hinausgeschoben, weil man – so ein führender Sandinist – das Schicksal der Revolution nicht dem Zufall von Wahlen überlassen wollte.
Wählt man die Perspektive der jeweiligen Hegemonialmacht, dann war das „Sündenregister“ der Sandinisten länger als das der Ukraine vor dem russischen Überfall. Eine marxistisch-leninistische Regierung 2500 Kilometer von der US-Grenze entfernt und in der Nähe des Panamakanals – das war aus Sicht Reagans eine Bedrohung wie zwanzig Jahre zuvor Fidel Castros Sieg in Kuba. Deshalb begannen die USA einen unerklärten Krieg gegen das Land, nachdem Reagan 1981 Präsident geworden war. Nicaraguanische Häfen wurden vermint und konterrevolutionäre Söldner finanziert. Ähnlichkeiten zum Vorgehen Russlands im Donbass und auf der Krim drängen sich auf.
Brandt und das Recht auf nationale Selbstbestimmung
Wie aber reagierte Europas Sozialdemokratie, wie der damalige Präsident der Sozialistischen Internationale, Willy Brandt? Brandt nahm die außenpolitischen Entscheidungen der Sandinisten, die man wahlweise dumm oder provokant nennen kann, nicht zum Anlass, Verständnis für Reagan zu zeigen, wie dies in der Logik der heutigen Argumente von Braun, Wagenknecht und anderen läge. Von ihm vernahm man kein „Ja, aber“, wie wir es von seinen selbst ernannten Erben heute hören. Wären Wagenknecht und Braun ehrlich mit sich selbst und konsequent, dann müssten sie heute erklären, dass Reagan damals durchaus Gründe gehabt habe, gegen Nicaragua vorzugehen.
Brandt hingegen äußerte sich 1983 wie folgt: „Die Regierung Reagan begreift revolutionäre Bewegungen, die im Volkskampf gegen oligarchische und terroristische Unterdrückung tief verwurzelt sind, als Agenten einer sowjetischen oder kubanischen Verschwörung. Wir betrachten diese Auffassung als eine radikale Verzerrung der Realität.“[9] Ebenso deutlich formulierte der sozialdemokratische Außenpolitiker Hans-Jürgen Wischnewski 1985 in einem Brief an den US-Präsidenten: „Die Finanzierung des gegen Nicaragua geführten Krieges aus dem Haushalt der Vereinigten Staaten ist mit dem Völkerrecht nicht vereinbar.“ Diejenigen, die gegen Nicaragua Krieg führen, „als Freiheitskämpfer zu bezeichnen, ist ein Hohn auf die Freiheit“.[10]
Willy Brandt wird von den sogenannten Putin-Verstehern also fälschlich vereinnahmt. Die Maxime, der seiner Auffassung nach eine sozialdemokratische Außenpolitik folgen sollte, erläuterte er mehrfach mit einem Zitat aus der „Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation“, verfasst 1864 von Karl Marx. In Brandts Worten lautete die Maxime so: „Die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, welche die Beziehungen von Privatpersonen regeln sollten, so hieß es dort, seien als die obersten Gesetze auch des Verkehrs von Nationen geltend zu machen.“[11] Das genügt eigentlich bereits, um den Unterschied deutlich zu machen. Denn in welchem „Verkehr von Privatpersonen“ zeigt man mehr Verständnis für den Angreifer als für den Angegriffenen?
Aber nicht nur das markiert einen entscheidenden Unterschied. Brandt ließ sich vom Prinzip der nationalen Selbstbestimmung leiten, ein Prinzip, das die Ex-Kommunistin Wagenknecht und der Ex-DKPler Braun doch bei Lenin gelernt haben müssten. Das nicaraguanische Volk hatte sein Schicksal in die eigenen Hände genommen, wollte soziale Reformen und politische Demokratie. Darin verdiente es Unterstützung. Wenn die Sandinisten von diesem Kurs abwichen, dann ermahnte Brandt sie intern, aber zu keiner Zeit folgte für ihn daraus, dass die USA legitimiert seien, das Land zu destabilisieren.
Das Recht auf nationale Selbstbestimmung leitete Brandt auch 1989/90. Nicht seine eigene Sympathie für die Wiederherstellung der deutschen Einheit, für die er seit den 1950er Jahren gekämpft hatte, war sein stärkstes Argument gegen Günter Grass und Oskar Lafontaine, als diese die Einheit gänzlich ablehnten oder auf die lange Bank schieben wollten. Das Selbstbestimmungsrecht der Menschen in der DDR galt für Brandt uneingeschränkt. Entschieden sie sich für die Einheit, dann war dem zu folgen. Das Ergebnis der Volkskammerwahl im März 1990 war in der Beziehung eindeutig.
Auch in der Ukraine haben die Menschen das Recht auf nationale Selbstbestimmung ausgeübt – im Referendum vom 1. Dezember 1991. 84 Prozent stimmten damals für die Unabhängigkeit, selbst auf der Krim und in Sewastopol ergaben sich Mehrheiten (54 bzw. 57 Prozent). Wenn Sahra Wagenknecht heute vorschlägt, die Menschen im Donbass und auf der Krim sollten über die territoriale Zugehörigkeit entscheiden, ist das ein Hohn auf das Recht zur nationalen Selbstbestimmung, nach der Flucht und Vertreibung der loyal zur Ukraine stehenden Teile der Bevölkerung aus diesen Gebieten und nach der Ansiedlung russischer Staatsbürger dort.
Die nationale Selbstbestimmung war und ist insbesondere ein Schutz für kleinere Staaten. Im skandinavischen Exil hatte Brandt gelernt, die Welt nicht nur aus dem Blickwinkel der Großmächte zu betrachten. Diese Erfahrung prägte ihn für Jahrzehnte. „Nie mehr eine Politik über Polen hinweg“, war eine der Konsequenzen, die er daraus zog.[12] In Zentralamerika setzte er sich dafür ein, dass die Akteure vor Ort eine Lösung des Konflikts fanden, ohne Einmischung aus Washington oder Moskau. Auf heute gemünzt hieße das: „Keine Friedenslösung über die Ukraine hinweg“. Aber wer sich die Äußerungen aus den Reihen des BSW anschaut, wird erkennen, dass dort der Ukraine keine eigenständige Rolle zugebilligt wird. Auch das trennt Brandt von Wagenknecht und anderen. Vielmehr propagieren Braun, Wagenknecht und Co. mit ihrer ständigen Mahnung, auf Russlands Interessen Rücksicht zu nehmen, eine Neuauflage der Breschnew-Doktrin – oder mit Blick auf Lateinamerika: der Monroe-Doktrin. Demnach hat der regionale Hegemon das Recht, den Kurs der umliegenden Länder zu bestimmen. Michail Gorbatschow verkündete bereits 1988 die Abkehr vom „proletarischen Internationalismus“, mit dem die UdSSR 1968 ihren Einmarsch in der Tschechoslowakei begründet hatte. Auf ihn berufen sich Braun, Dağdelen,, Wagenknecht und andere also ebenso zu Unrecht wie auf Brandt.
Nicht nur Nicaragua zeigt, wo Brandt heute stünde. Putins Russland hat mit der Sowjetunion ganz besonders eines gemeinsam: die Macht des Geheimdienstes. Wie Stalins NKWD (später umfirmiert in KGB) vorging, hatte Brandt 1937 am eigenen Leib erfahren, als er sich von Februar bis Juni in Barcelona aufhielt, um die Sache der spanischen Republik zu unterstützen. Mehrere seiner Genossen von der linkskommunistischen POUM verschwanden spurlos; schnell wurde klar, dass die spanische KP im Verbund mit Emissären des NKWD dafür verantwortlich war. Brandt selbst musste Anfang Juni Hals über Kopf das Land verlassen, um der Verschleppung in ein Geheimgefängnis der Stalinisten zu entgehen.
Ostpolitik und Westorientierung
Während des Zweiten Weltkriegs hielt Brandt im schwedischen Exil Kontakt zu den Botschaften der USA und der Sowjetunion. Aber er machte Unterschiede: Mit der sowjetischen Botschafterin Alexandra Kollontai traf er einmal zusammen, der US-Botschaft lieferte er beständig detaillierte Informationen über die Lage in Norwegen, die er als Angehöriger des Widerstands seiner zweiten Heimat erlangt hatte. Roosevelts vier Freiheiten (Rede- und Glaubensfreiheit, Freiheit von Not und Angst) wurden auch über das Kriegsende hinaus zu wichtigen programmatischen Orientierungspunkten von Brandt: „Die freiheitliche Tradition Amerikas […] berührte einen entscheidenden Impuls meines eigenen Denkens.“[13]
Nach dem Sieg über Hitlerdeutschland hoffte Brandt auf eine dauerhafte Verständigung zwischen den Alliierten, auch auf eine Überwindung der Spaltung der Arbeiterbewegung. Aber die Zwangsvereinigung von KPD und SPD in der SBZ, der Februar-Putsch der tschechoslowakischen KP 1948 und die Berlin-Blockade 1948/49 machten ihn zu einem entschiedenen Verfechter der Westorientierung. Mit dem auf die nationale Einheit abzielenden SPD-Chef Kurt Schumacher geriet er darüber in Konflikt. Von 1948 bis 1952 arbeitete Brandt sogar mit dem Militärgeheimdienst CIC der USA zusammen.[14]
In Berlin war Brandt ein „Kalter Krieger“, wie er in einem lebensgeschichtlichen Interview für das ZDF 1988 bekannte.[15] Noch 1962 forderte er in einem Vortrag an der Harvard University, der Westen müsse der Sowjetunion klarmachen, „daß wir entschlossen sind, uns notfalls mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen“. Der Westen habe glaubwürdig zu vermitteln, dass dann die Selbstvernichtung der Menschheit drohe. Etwaige Zweifel an seiner Botschaft räumte Brandt aus: „Die Frage ‚Sterben für Berlin?‘ ist falsch gestellt. […] Hier geht es darum, die Frage auch nach Osten zu stellen: Will Moskau für seine Berlin-Ziele einen Krieg führen? Würde diese Frage bejaht, dann würde Moskau seinen Krieg bekommen, und weder die Feigen noch die Mutigen unter uns würden dann den Kreml abhalten können, seinen Krieg zu beginnen. […] Nur die innere Bereitschaft, auch das letzte Risiko einzugehen, kann uns vor der Selbstvernichtung bewahren.“[16]
„Auch das letzte Risiko einzugehen“, hieß vereinfacht, dass Brandt sich durch keine noch so scharfe Drohung aus dem Kreml von seinem Kurs abbringen lassen und bis zum Letzten dagegenhalten wollte, in der Hoffnung, dass Moskau dann klein beigeben würde.
Das war der eine Teil von Brandts Antwort auf die sowjetische Politik, welche immer noch die Freiheit Westberlins existenziell bedrohte und kurz nach seinem Vortrag mit der Stationierung von Raketen auf Kuba die Welt leichtfertig an den Rand eines Atomkriegs brachte. Der andere Teil bestand darin, das sowjetische Angebot einer friedlichen Koexistenz auszutesten, ohne dabei die Westbindung, die Nato-Zugehörigkeit und die Wehrhaftigkeit infrage zu stellen. Eine ähnliche Mischung aus militärischer Wachsamkeit und politischer Dialogbereitschaft prägte die 1967 beschlossene neue Nato-Doktrin, den sogenannten Harmel-Bericht, an dessen Erarbeitung Brandt, nun Bundesaußenminister, wesentlichen Anteil hatte. Diese Doktrin war der Ausgangspunkt der „Neuen Ostpolitik“. Sie war dezidiert keine Alternative zur Westpolitik Adenauers, sondern ihre zwingende Ergänzung. Kernpunkt der Ostpolitik war die Anerkennung der Realitäten, sprich: der Grenzen, die nach 1945 entstanden waren. Damals war die Bundesrepublik in dieser Hinsicht der einzige revisionistische Staat in Europa. Wenn heute verlangt wird, Deutschland müsse in der Tradition der Ostpolitik die Realitäten anerkennen, um zum Frieden zwischen Russland und der Ukraine beizutragen, dann wird unterschlagen, dass es damals um die eigenen, die deutschen Grenzen ging. Heute geht es um die Grenzen der Ukraine, die Putin verändern will, entgegen dem Recht auf nationale Selbstbestimmung, dem Willy Brandt verpflichtet war. Nicht Deutschland hat Putins Eroberungen zu bestätigen, ohne die Ukraine zu konsultieren. Umgekehrt wird ein Schuh daraus: Im Sinne von Brandts Ostpolitik wäre es, die heutige grenzrevisionistische Macht Russland aufzufordern, die Realitäten von 1991 wieder anzuerkennen und die damals festgelegten Grenzen der Ukraine zu respektieren, wie es Russland im Budapester Memorandum von 1994 ausdrücklich zugesichert hat.
Alles ist ohne den Frieden nichts?
In der Debatte über die deutsche Reaktion auf den russischen Überfall wird gerne mahnend darauf verwiesen, Willy Brandt habe seine Ostpolitik nur 15 Monate nach dem sowjetischen Einmarsch in die Tschechoslowakei gestartet. Nur war die Lage damals ganz anders als heute. Die Besetzung der CˇSSR, so verurteilenswürdig sie war und ist, änderte keine Grenzen, wahrte die Einflussbereiche der Blöcke, ging nicht mit Kriegsverbrechen einher; die tschechoslowakische Armee leistete den Invasoren keinen Widerstand. Zudem: Die Sowjetunion bot im Frühjahr 1969 Verhandlungen über Entspannungsschritte an und räumte bislang formulierte Vorbedingungen beiseite, etwa die der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch die BRD.
Putin wie Breschnew sind bzw. waren Diktatoren, aber nicht einmal Reiner Braun oder Sahra Wagenknecht würden über Putin das sagen, was Willy Brandt 1981 über den KPdSU-Generalsekretär zum Ausdruck brachte: „Breschnew zittert um den Frieden.“[17] Die Ostpolitik ist in die Geschichte eingegangen als Teil der Détente zwischen Ost und West. Dabei ist in Vergessenheit geraten, dass beide Seiten des Konflikts ihre militärische Stärke bewahren wollten. Willy Brandt war dem Frieden, aber nicht dem Pazifismus verpflichtet. Deshalb blieben die Ausgaben für Verteidigung auch in seiner Zeit als Bundeskanzler stets hoch.
Und was ist mit dem friedensbewegten Willy Brandt der 1980er Jahre? Auch in der Rede aus dem Jahr 1981, in der der berühmte Satz „Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts“ fiel, plädierte er für den Verbleib in der Nato, grenzte die Sozialdemokratie vom Pazifismus ab, bekannte sich zum Widerstandsrecht der Völker mit Waffen. Auf der Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten am 22. Oktober 1983 lehnte er zwar die Nachrüstung ab, verteidigte aber die Nato-Zugehörigkeit der Bundesrepublik.
Auf Brandts Beispiel, auch dort aufzutreten, wo viele ihm kritisch begegneten, beriefen sich Ralf Stegner und Wolfgang Thierse, als sie zur Teilnahme an der sogenannten Friedensdemonstration am 3. Oktober dieses Jahres in Berlin aufforderten. Auf der Friedenskundgebung im Bonner Hofgarten im Jahr 1983 redeten neben Brandt auch Heinrich Böll, Petra Kelly und andere. Heute hätte er es mit Sahra Wagenknecht und dem Querfrontaktivisten Reiner Braun zu tun. Ob Brandt das in Kauf genommen hätte? Damals war der Demo-Aufruf Ergebnis intensiver Debatten im Vorfeld, heute wurde der maßgebliche Aufruf von Braun und Wagenknecht dekretiert. Er enthält keinerlei Hinweis darauf, dass Russland der Angreifer ist. Ob das in der Tradition von Willy Brandt steht? Selbst die DFG-VK (Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen) sagte deshalb ihre Teilnahme ab.
Neue Antworten nach 1989
Als die Auflösung der Blöcke 1989 begann und ab Anfang 1990 über die künftige Rolle der Nato diskutiert wurde, konnte man Brandt dabei beobachten, wie er die „eigene Antwort“ suchte, welche die neue Zeit wollte. Ständig galt es, die eigenen Positionen zu überprüfen. Im Februar 1990 schrieb er an Gorbatschow: „Die sozialdemokratischen Parteien in beiden Staaten lehnen die Nato für das vereinte Deutschland ab.“ Vier Monate später, beim Römerberggespräch, klang Brandt schon anders: „[W]ie käme die Bundesrepublik dazu, ihre Zugehörigkeit zur Nato aufzukündigen? Auch bei einer weitreichenden Anpassung an die veränderte Weltlage möchte man – auch ich – die Verklammerung mit den Amerikanern nicht zur Disposition stellen.“[18] Auch jetzt lehnte Brandt eine Äquidistanz zu Moskau und Washington ab.
Übrigens ging Oskar Lafontaine anderthalb Jahre später, was die Rolle der Nato angeht, viel weiter als Brandt. „Der Spiegel“ berichtete Anfang 1992: „Lafontaine will den osteuropäischen Staaten Sicherheitsgarantien der Nato anbieten [...]. Auch die Nachfolgerepubliken der früheren Sowjetunion sollen derartige Verträge schließen können [...].“[19] Die Nato hätte, wäre diese Idee umgesetzt worden, der Ukraine gegen Russland militärisch beistehen müssen. Ob Oskar das Sahra gebeichtet hat?
Seine letzte große Rede hielt Willy Brandt im Mai 1992 in Luxemburg. Er bedauerte, dass die KSZE institutionell zu schwach sei, zeigte sich hingegen erfreut, dass die Nato „eine Offenheit gezeigt [hat], die ihr manche nicht zugetraut hatten“. Sie müsse nun „ehemalige Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes weitgehend ‚einbinden‘, damit in Mitteleuropa kein Sicherheitsvakuum bleibt“.[20] Heute besteht wieder ein Sicherheitsvakuum in Europa. Es ist entstanden, weil Russland das Völkerrecht und bilaterale Abkommen gebrochen hat. Putin hat es geschafft, dass das Vertrauen in die Vertragstreue seines Landes auf null gesunken ist. 1973 erklärte Willy Brandt vor der UN-Vollversammlung: „Sicherheit kann nicht durch Vertrauen allein entstehen: Auch das ist eine Realität. Diese Feststellung braucht gleichzeitig Umkehrung: Vertrauen entsteht durch Sicherheit.“[21] Auf die Gegenwart bezogen bedeutet dies: Sicherheit vor Russland ist erforderlich.
Wie kann es im Sinne von Willy Brandt weitergehen? Für Nicaragua hatte er in den 1980er Jahren vorgeschlagen, die Länder der Region sollten ohne Einmischung der Großmächte einen Weg zum Frieden suchen – was auch gelang. Dieses Modell eignet sich für die Ukraine nicht. Sie bedarf weiterhin der militärischen und auch der diplomatischen Unterstützung durch möglichst viele Länder. Wenn am Ende nicht die Kapitulation der Ukraine stehen soll, dann hängt alles von Russland ab. Es muss zu Verhandlungen bereit sein. Die Forderung nach mehr Diplomatie ist berechtigt, aber sie gilt zuvorderst gegenüber Moskau. Bisher hat sich Putin allen diplomatischen Initiativen verschlossen.
Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen war einer der Bausteine der Ostpolitik. Verhandlungen über einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine können nur gelingen, wenn das verlorene Vertrauen in die Vertragstreue und in die Friedfertigkeit Moskaus wiederhergestellt wird. Und es bedarf vertrauenswürdiger Sicherheitsgarantien anderer Staaten für die Ukraine, wie auch immer ihre Grenzen nach einem Friedensvertrag aussehen. Das sind Herausforderungen an Russland und an den Westen, deren Bewältigung heute noch in den Sternen steht. Aber ohne ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen, das war Willy Brandt bewusst, ist eine Entspannung zwischen Gegnern nicht möglich.
Die Freiheit zu erringen, zu verteidigen, sie auszubauen – das war die Konstante in Brandts politischem Denken und Handeln. Friedlich sollte dies geschehen, wenn möglich, aber mit Waffengewalt, wenn es anders nicht geht. Frieden war ihm dann doch nicht alles, sofern er der Friedhofsruhe von Diktaturen glich. Der wirkliche Willy Brandt hat daher wenig zu tun mit dem Bild, das sich manche heute von ihm herbeifantasieren – zum Glück.
[1] Willy Brandt, Berliner Ausgabe, Bd. 8, Bonn 2006, S. 515 f.
[2] Ders., Berliner Ausgabe, Bd. 1, Bonn 2002, S. 461.
[3] Reiner Braun, Moskau. November 2022 – Eine Reise für den Frieden, in: „Wostok. Informationen aus dem Osten für den Westen“, Winter 2022, S. 22-25. Dort finden sich auch die weiteren Zitate.
[4] Vgl. Peter Sieben, Bündnis Sahra Wagenknecht – Politiker für Wiederannäherung an Russland: „Wir brauchen ein starkes Europa“, fr.de, 16.1.2024.
[5] Vgl. das Interview mit Fabio De Masi und Michael von der Schulenburg: Was Wagenknechts Kandidaten wirklich über Russland denken, spiegel.de, 23.1.2024.
[6] Tatsächlich stammt dieses Zitat aus dem Jahr 1981.
[7] Interview mit Sevim Dağdelen, BSW: Das sind unsere Forderungen, wir werden keinen Kotau machen, berliner-zeitung.de, 7.9.2024.
[8] Vgl. Für ein neues Selbstverständnis in der Außenpolitik, bsw-vg.de.
[9] Rede in der Heimvolkshochschule Saarbrücken der Friedrich-Ebert-Stiftung, 22.5.1983.
[10] Offener Brief des Präsidiumsmitgliedes und Schatzmeisters der SPD, Hans‑Jürgen Wischnewski, an US‑Präsident Ronald Reagan, Mai 1985.
[11] Vgl. die Rede Brandts beim SI-Kongress, 26.11.1976. Im Original lautet das Zitat: Die Arbeiterklassen haben „die Pflicht […] die einfachen Gesetze der Moral und des Rechts, welche die Beziehungen von Privatpersonen regeln, als die obersten Gesetze des Verkehrs von Nationen geltend zu machen.“ MEW, Bd.16, Berlin (DDR) 1973, S. 13.
[12] „Vorwärts“, 4.12.1980.
[13] Willy Brandt, Begegnungen und Einsichten. Die Jahre 1960-1975, Hamburg 1976, S. 80.
[14] Ein Antrag des Autors auf Freigabe aller Akten der CIA über eine Zusammenarbeit mit Brandt soll im Februar 2026 beschieden werden.
[15] Interview von Horst Schättle mit Willy Brandt, willy-brandt-biografie.de, 1988, Zitat bei Min. 0:12.
[16] Willy Brandt, Koexistenz – Zwang zum Wagnis, Stuttgart 1963, S. 12 f., 63.
[17] Interview mit Willy Brandt, „Breschnew zittert um den Frieden“, in: „Der Spiegel“, 5.7.1981.
[18] Willy Brandt, Berliner Ausgabe, Bd. 10, Bonn 2009, S. 444, 449.
[19] „Der Spiegel“, 4/1992, S. 34.
[20] Willy Brandt, Berliner Ausgabe, Bd. 10, Bonn 2009, S. 543 f.
[21] Ders., Berliner Ausgabe, Bd. 6, Bonn 2005, S. 501.









