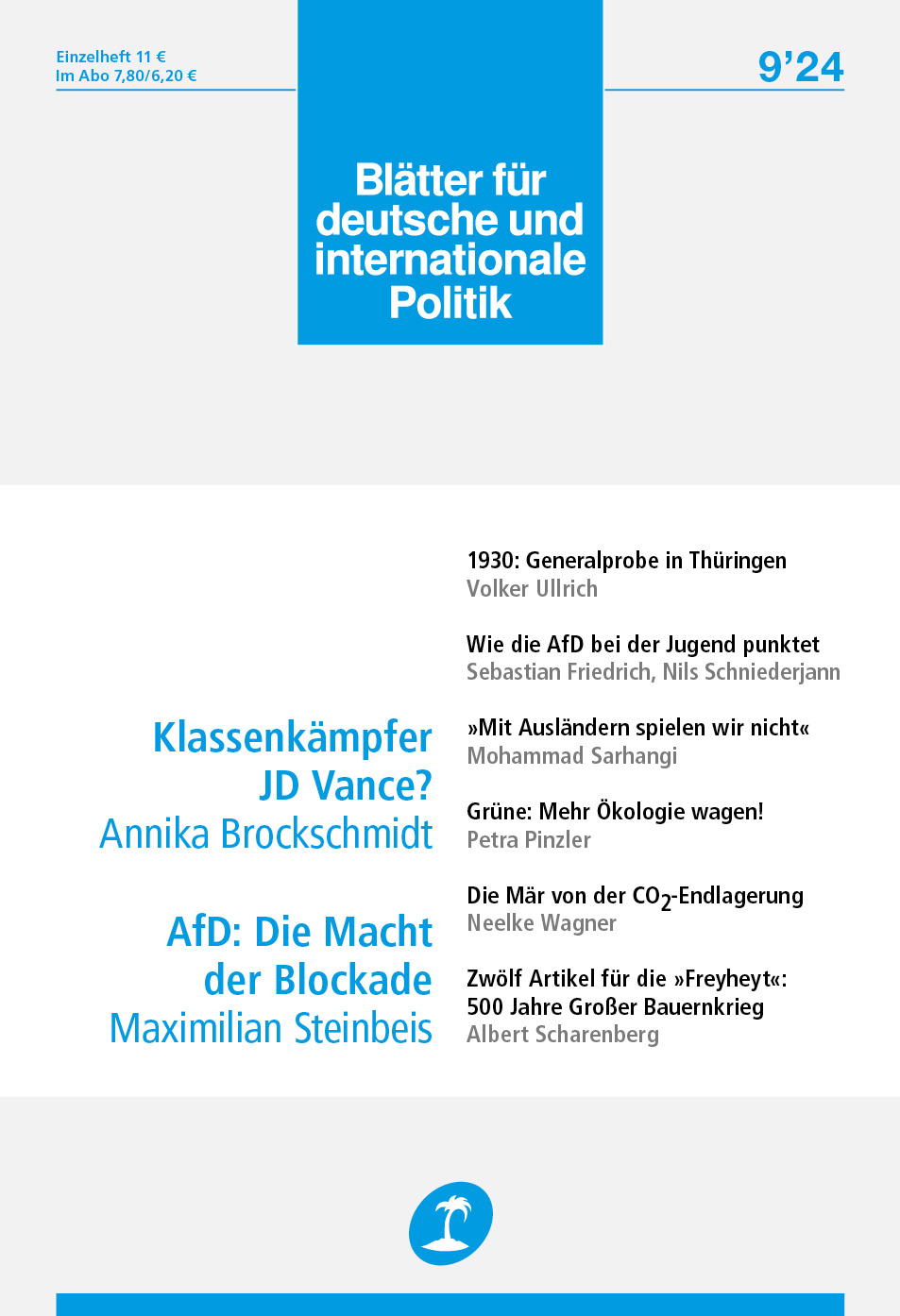Bild: Auf dem Gelände des Industrieparks Schwarze Pumpe war bis zum 15. Mai 2014 eine Pilotanlage zur CO2-Abscheidung in Betrieb, 5.5.2011 (IMAGO / Jürgen Heinrich)
Während die Klimakrise an Dramatik zunimmt, erhebt sich ein totgeglaubtes Konzept für den Klimaschutz aus der Mottenkiste: die massenhafte Abscheidung und Speicherung von CO2, auf Englisch „Carbon Capture and Storage“ (kurz CCS).[1] Das Konzept erfreut sich anhaltender Beliebtheit insbesondere in der Öl- und Gasindustrie. Sie propagiert es, um den Ausstieg aus fossilen Rohstoffen wie Kohle, Öl und Gas in eine unbestimmte Zukunft zu verschieben. Auf der vergangenen Weltklimakonferenz in Dubai, die von einem Vertreter dieser Industrie geleitet wurde, hat intensives Lobbying für diese Idee dem dringend notwendigen weltweiten Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe das Wörtchen „unabated“ vorangestellt, zu Deutsch: „unvermindert“. Das heißt: Nur wenn die Emissionen einer Anlage „unvermindert“ bleiben, soll sie als klimaschädlich gelten. „Abated“, also mit Abscheidung von CO2, soll sie dagegen weiterlaufen dürfen.
In Europa verfängt die Vorstellung von CO2-Deponierung vor allem in der Industriepolitik. Das „Netto-Null-Industrie-Gesetz“ der EU („Net Zero Industry Act“ kurz NZIA), seit dem 29. Juni 2024 in Kraft, misst CCS große Bedeutung bei. Bis 2030 soll eine Injektionskapazität von 50 Millionen Tonnen CO2 in der EU geschaffen werden. Für 2050 schätzt die EU-Kommission, werde die EU „jährlich bis zu 550 Millionen Tonnen CO2 abscheiden müssen, um das Ziel von null Nettoemissionen“ zu erreichen. Die Zahlen zeigen, dass es dabei nicht um die Speicherung einer kleinen Menge unvermeidlicher Restemissionen geht. Die Speicherkapazität aller weltweit operierenden CCS-Anlagen beläuft sich Schätzungen der IEA zufolge auf ein Fünfzigstel dieser Menge. Die Mitgliedsstaaten sollen deshalb in großem Stil geologische Untersuchungen vorantreiben und geeignete Speicher identifizieren, die von der neu entstehenden CO2-Deponierungsindustrie dann genutzt werden können. Auch die deutsche Bundesregierung macht sich bereit, dieser neuen Vorgabe zu entsprechen.
Die Speicherung von CO2 ist in Deutschland bisher verboten und dem Bau von Pipelines für seinen Transport sind enge Grenzen gesetzt – ein Sieg der Bürgerinitiativen, die vor zwölf Jahren gegen entsprechende Pläne für Kohlekraftwerke auf die Barrikaden gingen. Doch inzwischen hat die Bundesregierung einen Entwurf für ein neues CO2-Speicherungsgesetz vorgelegt, das zum Bau eines flächendeckenden CO2-Transportnetzes führen und CO2-Deponien unter der Nordsee erlauben soll. So etwas planen sämtliche Anrainerstaaten der Nordsee – schon wird eine „Billionen-Euro-Industrie“ beschworen.[2]
Dieser Siegeszug von CCS ist auf den ersten Blick verblüffend. Denn es ist keineswegs so, dass neue technologische Errungenschaften dazu geführt hätten, dass diese Technik auf einmal verlässlich funktioniert oder nennenswert billiger geworden wäre.[3] Dieselben Gründe, die vor zwölf Jahren zum Verbot von CCS in Deutschland geführt haben, gelten nach wie vor: Massiver CCS-Einsatz bietet nach heutigem Stand keinen Mehrwert für den Klimaschutz, sondern verlängert und erweitert fossile Geschäftsmodelle. Mit einem riesigen energetischen und materiellen Aufwand sollen Schäden beseitigt werden, die durch einen konsequenten Ausstieg aus fossilen Energien einfacher und billiger verhindert werden könnten. Es werden wertvolle Ressourcen verplempert, die besser in eine echte Industrietransformation investiert würden.
Ein zu schöner Traum
Zugegeben, es klingt verlockend: Das CO2, Hauptverursacher der Erderhitzung und Endprodukt vieler prinzipiell nützlicher chemischer Prozesse, wird einfach aufgefangen und endgelagert. Es gelangt nicht mehr in die Atmosphäre, das Klimaproblem ist gelöst. Überall auf der Welt schaffen es Varianten der Erzählung, ohne CCS wäre das Klima nicht zu retten, in Regierungserklärungen und Gesetzestexte. Oftmals wird zunächst auf die „unvermeidbaren“ Emissionen verwiesen, die etwa anfallen, wenn man Zement herstellt.[4] So verfährt auch die „Carbon Management“-Strategie der Bundesregierung: Da „Emissionen in bestimmten Bereichen bzw. Prozessen nur schwer oder anderweitig nicht vermeidbar sind“, brauche man CCS – und ein deutschlandweites Pipelinenetz, in dem das Treibhausgas zu den künftigen Endlagern unter der Nordsee gepumpt wird.
Schaut man sich das Volumen des geplanten CO2-Pipelinenetzes und die Sektoren genauer an, die künftig von dieser Infrastruktur profitieren sollen, wird schnell klar, dass es kaum nur um Baustoffe geht. Neben Produktionsanlagen für Wasserstoff aus Erdgas (blauer Wasserstoff) sollen auch Gaskraftwerke, Müllverbrennungsanlagen und „Bereiche der Grundstoffindustrie“ in den Genuss nachträglicher CO2-Abscheidung kommen. Warum? Weil sie „durch die Verknappung der Zertifikate des Europäischen Emissionshandels zunehmend unter Kosten- und Minderungsdruck geraten“ und dieser Druck durch die Möglichkeit von CCS gemindert werden soll, heißt es in den Eckpunkten weiter. Aber CCS ist fürchterlich teuer. Gerade wenn es um Minderungskosten geht, ist überhaupt nicht ersichtlich, warum CCS das Mittel der Wahl sein sollte – es sei denn, der Staat zahlt.
Ein weitaus größeres Problem als die Kosten ist jedoch, dass die Technik unterm Strich bisher eher zu mehr statt weniger CO2 in der Luft führt. Anlass zur Hoffnung, dass sich das in naher Zukunft ändern könnte, gibt es kaum. Denn einige der Probleme, mit denen CCS zu kämpfen hat, sind grundlegender Natur und nicht einfach durch technischen Fortschritt zu lösen.
Ursprünglich wurde die „Aminwäsche“, so heißt der Vorgang, mit dem CO2 abgeschieden wird, in der Gasindustrie verwendet, weil Erdgas, wenn es aus dem Boden kommt, CO2 enthält. Dies wurde vom Methan getrennt und meist einfach in die Atmosphäre entlassen. Seit den 1970er Jahren wurde es zunehmend zurück in die Lagerstätte gepresst. So lässt sich aus versiegenden Ölquellen auch das letzte Öl herausholen, das nennt sich „Enhanced Oil Recovery“. Nutzen für den Klimaschutz bringt dieser Anwendungsfall offensichtlich nicht – im Gegenteil. Auch eine Überprüfung, ob das verpresste CO2 tatsächlich im Boden bleibt, findet nicht statt. Die „langjährigen Erfahrungen“, aufgrund derer CCS eine „erprobte Technologie“ sei, beziehen sich aber auf diesen Anwendungsfall.
Viel Energie für eine Scheinlösung
Ganz grundsätzlich ist mit dem Auftreten von CO2 ein energetischer Endpunkt erreicht. Das bedeutet, was immer man mit ihm anstellen will, erfordert Energie – auch seine Abscheidung aus der Luft oder selbst aus einem Abgasstrom mit hoher CO2-Konzentration.[5] Ein Müllverbrennungskraftwerk mit CCS könnte nur noch die Hälfte des erzeugten Stroms liefern, der Rest ginge für Abscheidung, Transport und Speicherung des CO2 drauf.[6] Sogar für die „erweiterte Ölausbeute“ haben Forschende gezeigt, dass sie sich aus energetischer Sicht nicht lohnt.[7] Der Prozess verbraucht mehr Energie, als durch die Nutzung des so geförderten Öls zur Verfügung stünde. Für Kohlekraftwerke haben sie berechnet, dass die Abscheidung sogar fast so viel Energie frisst, wie das Kraftwerk zur Verfügung stellt. Und das ist kein Phänomen, das bei besonders schlechten Anlagen im Realbetrieb auftaucht, sondern eine Bilanz, die anhand grundlegender physikalischer Eigenschaften der beteiligten Substanzen und Prozesse gezogen wurde. Der Aufwand für die Herstellung des Amin-„Waschmittels“, den Anlagenbau und die dauerhafte Überwachung der CO2-Speicher wurde nicht mitgerechnet.
Dieser erhöhte Energiebedarf garantiert zudem keineswegs, dass am Ende tatsächlich weniger CO2 in die Luft gelangt. Die meisten CCS-Projekte bleiben im Realbetrieb deutlich hinter den angekündigten Abscheideraten zurück – entweder weil der Prozess nicht funktioniert, Havarien passieren oder der Speicher sich als ungeeignet erweist. Eine Untersuchung des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) aus dem Jahr 2022 hat 13 CCS-Anlagen unter die Lupe genommen, die zusammen damals gut die Hälfte der weltweiten Speicherkapazitäten zu dem Zeitpunkt umfassten. Das Ergebnis: Zehn von ihnen scheiterten ganz oder erreichten ihre Ziele nicht.[8]
Die Konsequenz: Große Mengen CO2, die eigentlich aus der Atmosphäre herausgehalten werden sollten, wurden dennoch emittiert. Und das betrifft nur den Teil der Emissionen, die überhaupt durch eine Abscheideanlage erfasst werden. Schon die Energie, die der Prozess selbst benötigt, kommt in der Regel aus fossilen Quellen. Diese Emissionen werden nicht mitgezählt. Zwar ist es prinzipiell möglich, dass diese Energie auch aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt wird, doch würde dies das Problem nur verlagern. Bislang sind wir noch weit von einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien entfernt. Das bedeutet, dass jeder zusätzliche Energiebedarf zunächst aus fossilen Quellen gedeckt werden muss und somit deren Nutzung verlängert.
Die unsichere Endlagerung von CO2
Das Ziel, CO2 sicher und dauerhaft zu speichern, verfolgt bisher nur eine Minderheit der weltweit in Betrieb befindlichen CCS-Anlagen. Unter ihnen sind die Speicher Sleipner und Snøhvit des norwegischen staatlichen Öl- und Gaskonzerns Equinor die ältesten und vermutlich bestüberwachten ihrer Art. Dadurch wurde aber auch bekannt, dass trotz strenger Auflagen und intensiver geologischer Begleitung unvorhergesehene Dinge passieren. In einem der Speicher entwischte das CO2 in eine Gesteinsformation, die gar nicht bekannt war, und der andere entpuppte sich als viel kleiner als gedacht.[9] Zwar blieb immerhin, soweit bekannt, das verpresste CO2 im Boden, aber es wird deutlich, wie fragil das Versprechen einer dauerhaften Lagerung ist.
Die Industrie argumentiert, die aktuell noch sehr hohen Kosten für CCS würden künftig stark sinken, wenn die Technologie nur erst in großem Stile eingesetzt würde – das klassische „Scale“-Argument. Dabei wird unterschlagen, dass CO2-Lager „von der Stange“ aus geologischen Gründen niemals Realität werden können. Um herauszufinden, ob der Untergrund an einer bestimmten Stelle für die CO2-Lagerung geeignet ist, sind aufwendige und langjährige geologische Untersuchungen erforderlich, und selbst dann ist nicht ausgeschlossen, dass wichtige Details nicht bekannt sind – siehe die Probleme in Norwegen, die nur unter hohen zusätzlichen Kosten behoben werden konnten. Die einfache Vorstellung, man könne doch leere Gasfelder nutzen, verkennt erstens die geologischen Probleme, die durch die Gasausbeutung entstehen – Druckveränderungen, Erdbeben, vergessene oder mangelhaft verschlossene Bohrlöcher etc. Und zweitens ist auch unter der Erde viel in Bewegung – selbst wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Verhältnisse herrschen, wird das nicht für immer so bleiben. Die Lager müssen tendenziell auf ewig überwacht werden. Zwar gibt es Gesteinsformationen, in denen das CO2 mit vorhandenen Substanzen zu festen Mineralien reagiert. Doch die Regel sind Speicher, in denen das Gas in überkritischem Zustand (in einem Stadium zwischen flüssig und gasförmig) verbleiben muss, was gleichbleibende Druck- und Temperaturverhältnisse erfordert.[10]
Das vierfache Geschäftsmodell mit CCS
Wenn man vor den Gefahren und dem Unsinn von CCS warnt, ist paradoxerweise ein Argument der Politiker:innen, die das Verfahren erlauben wollen: Das ist viel zu teuer und lohnt sich ohnehin nicht, wo es nicht unbedingt nötig ist. Deshalb brauche zum Beispiel niemand Angst vor CCS an Gaskraftwerken zu haben. Dieses Argument wird unterfüttert von einer Meldung aus Norwegen, wo Equinor Kosten von 570 Euro pro Tonne abgeschiedenes und verpresstes CO2 für eine CCS-Anlage an einem Gaskraftwerk veranschlagte und sich dann doch für die Nutzung von Ökostrom entschied. Dabei liegt diese Anlage in unmittelbarer Nachbarschaft des konzerneigenen Snøhvit-Speichers, und Equinor gehört zu den größten Gasproduzenten und eifrigsten Werbern für CCS in Europa.
Wie kommt es dann, dass sich die Mär von der einfachen, sauberen und günstigen CO2-Speicherung dennoch so hartnäckig hält? Eine wichtige Erklärung sind die umfangreichen und vielgestaltigen Werbekampagnen der fossilen Industrie.[11] Eine Untersuchung im Auftrag der Demokraten im US-Kongress legte offen, wie die US-amerikanische Fossilindustrie systematisch falsche Lösungen anpreist, um ihr Geschäftsmodell zu retten. Ein prominentes Beispiel für diese Strategie: CCS. Während CCS in Werbekampagnen der Industrie, in öffentlichen Statements und in Gesprächen mit Politiker:innen als saubere, einfache und sofort in großem Stil einsatzbereite Maßnahme angepriesen wird, offenbaren interne E-Mails der Konzerne, dass sie keineswegs die Absicht haben, nennenswert in die Technik zu investieren. Wenn es gut für sie läuft, müssen sie das auch nicht.
Für die fossilen Industrien ist eine Politik zur Förderung von CCS-Anlagen eine vierfache Win-Situation. Erstens, weil sie die Technik zur Verfügung stellen und mit ausgeförderten Öl- und Gasvorkommen über wesentliche potenzielle Speicherorte verfügen. Zweitens, weil so nicht nur der Ausstieg aus Öl und Gas in eine unbestimmte Zukunft verschoben wird, sondern auch zusätzlicher Verbrauch angereizt wird, da CCS viel zusätzliche Energie benötigt. Die Konzerne könnten gleichzeitig Öl und Gas bis zum letzten Molekül fördern und eine riesige symbolische Maschine betreiben, die unter hohem Energie- und Materialverbrauch einen Teil des Drecks wieder wegzumachen verspricht.
Das funktioniert aber nur, wenn Staaten in großem Stil Geld in dieses System pumpen. Und danach sieht es derzeit leider aus. Klimaschutzprogramme auf allen Kontinenten sehen teils milliardenschwere Unterstützung für CCS vor – ein dritter „Win“. Der vierter „Win“ zeichnet sich in der CCS-Debatte ab: Wenn CCS die Lösung ist, dann sind nicht mehr die Verursacher von Treibhausgasen das Problem, sondern diejenigen, die sich der Endlagerung dieser Emissionen in den Weg stellen. Thomas Hahn, CEO des Zementherstellers Holcim Deutschland, macht es vor: Wer den Aufbau einer Infrastruktur für den CO2-Transport etwa durch Klagen verzögere, sei dafür verantwortlich, „dass jährlich 1,2 Millionen Tonnen CO2unwiderruflich ausgestoßen werden“, schreibt er in einem Kommentar. Nicht mehr der Emittent, sondern rechtsstaatliche Verfahren und Menschen, die diese in Anspruch nehmen, sind in dieser Sichtweise verantwortlich für die Klimakrise. Und andere, echte Klimaschutzmaßnahmen sind durch diese Volte gleich ganz aus dem Bewusstsein gestrichen.
Der Hype um CCS kostet wertvolle Zeit und Ressourcen
Die eigentliche Gefahr von CCS ist nicht, dass es kommt und dann nicht funktioniert. Gefährlich ist das Konzept, weil wir mit der Debatte darum wertvolle Zeit vergeuden, die wir angesichts des sich abzeichnenden Klimakollapses nicht haben. Die Transformation der Industrie ist eine große Aufgabe und es ist überfällig, sich ihr in aller Ernsthaftigkeit zu stellen. Das umfasst weit mehr als CO2-Reduktion: Artensterben, Plastikkrise, Bodenzerstörung und -versiegelung, Wasserknappheit – alles von unserer aktuellen Industrieproduktion mitverursacht und mit dem Potenzial, ebenso existenzbedrohend für die Menschheit zu werden wie die Klimakrise. Doch statt an echten Lösungen zu arbeiten, versucht die Industrie sogar, den Begriff der Kreislaufwirtschaft zu kapern, um CO2 als „wertvollen Rohstoff“ darzustellen, der „im Kreis geführt wird“, weil daraus neue Produkte erzeugt werden könnten.[12] Diesem Unsinn müssen wir uns entgegenstellen. Wir brauchen eine echte Kreislaufwirtschaft, wir brauchen eine drastische Reduktion unseres Rohstoffverbrauches durch Mehrweg, Wiederverwendung und Recycling. Das alles sind neue Geschäftsfelder, neue Möglichkeiten für gute Jobs, wenn auch nicht mit den traumhaften – und giftigen – Renditen der fossilen Industrie. Aber es gäbe einen viel größeren, unbezahlbaren Gewinn: den Erhalt einer Biosphäre, in der Mensch und Natur gesund und sicher leben können.
[1] Wenn das CO2 nach dem Auffangen weiterverarbeitet werden soll, heißt das Konzept „Carbon Capture and Usage“ (CCU). Zusammengefasst lautet die Abkürzung dann „CCUS“ oder CCU/S“. In diesem Artikel wird im Folgenden „CCS“ behandelt.
[2] So verkündete es der Deutsche Verband für Negative Emissionen im Juni 2024. Vgl. Europa und Deutschland als Katalysatoren einer Billionen-Euro-Industrie, foleon.com, Juni 2024.
[3] Forscher der Universität Oxford konstatieren „keine Evidenz für technologisches Lernen und damit assoziierte Kostenreduktion“. Vgl. Andrea Bacilieri, Richard Black und Rupert Way, Assessing the relative costs of high-CCS and low-CCS pathways to 1.5 degrees, in: Oxford Smith School of Enterprise and the Environment, Working Paper No. 23-08, 2023.
[4] nWelche Emissionen tatsächlich unvermeidbar sind und ob diese kleine Menge dann mit Hilfe von CCS oder doch besser durch naturbasierte Speicherung gebunden werden sollte, ist eine eigene Diskussion wert, die hier nicht geleistet werden kann.
[5] Vgl. Bernhard Wessling, Entropie als Kriterium für Nachhaltigkeit – CO2-Endlagerung bzw. -Nutzung (CCS/CCU) nicht nachhaltig, in: „Leibniz Online“, 52/2024.
[6] Technical Report “CCS on Waste to Energy”, 2020-06, ieaghg.org, Dezember 2020.
[7] Farajzadeh et. al., On the sustainability of CO2 storage through CO2-Enhanced oil recovery, in: „Applied Energy“, 261/2020.
[8] Milad Mousavian und Bruce Robertson, The carbon capture crux: Lessons learned, ieefa.org, September 2022.
[9] Greg Hauber, Norway’s Sleipner and Snøhvit CCS: Industry models or cautionary tales?, ieefa.org, Juni 2023.
[10] Vgl. Umweltbundesamt, Technische Kohlenstoffsenken, umweltbundesamt.de, 25.9.2023.
[11] Vgl. Christian Stöcker, Einlullen, verschleiern, Zweifel säen, in: „Blätter“, 7/2024, S. 75-84.
[12] Überschriften wie „Vom Klimasünder zum wertvollen Rohstoff“ oder „Resozialisierung für den Klimakiller Nr. 1“ zeigen: Das Narrativ ist attraktiv und wird von den Medien gern rezipiert.