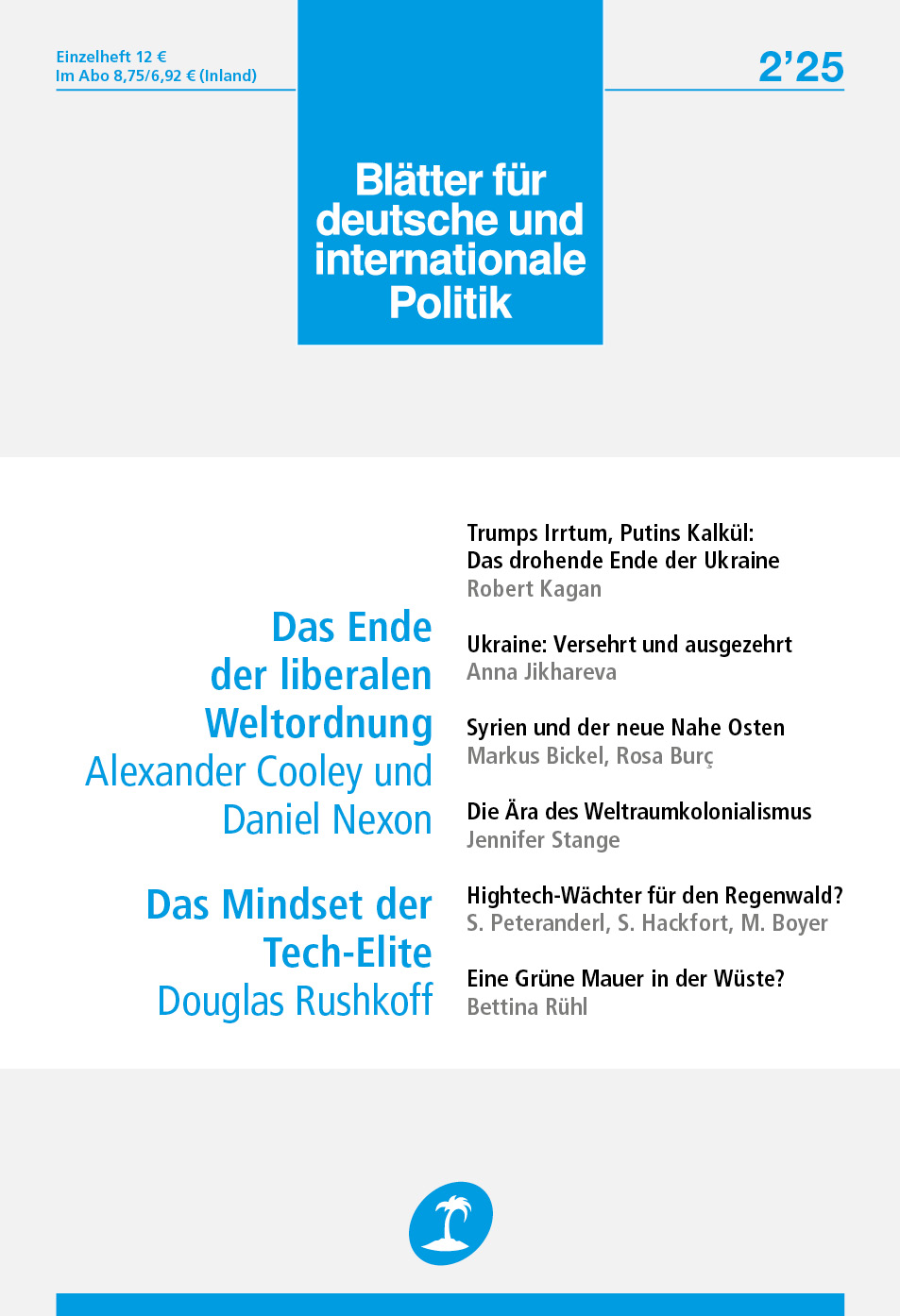Bild: Beim globalen Klimastreik in München, 3.3.2023 (Sachelle Babbar / IMAGO / ZUMA Press Wire)
In der Ausgabe 12/2024 skizzierte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, wie die ökologische Transformation wieder Schwung aufnehmen könnte. Diese sei im Gang, aber es fehle an sozialer Sicherheit und attraktiven Zukunftsentwürfen, um die Veränderungsbereitschaft der Menschen zu stärken. Die Politikwissenschaftler Ulrich Brand und Achim Brunnengräber teilen Messners relativen Optimismus nicht. Um eine nachhaltige Transformation gegen mächtige Kapitalinteressen durchzusetzen, brauche es mehr als kluge staatliche Steuerung.
Die Klimabewegung oder der Europäische Green Deal hätten 2019 noch „viel Anlass zu Optimismus“ gegeben, schreibt Dirk Messner. Diese Diagnose teilen wir nicht. Wir sehen leider auch nicht, dass sich die Gesellschaft „nun mitten in der Transformation“ befindet. Die Veränderungen, die stattfinden, sind hochgradig selektiv, denn zu stark ist nach wie vor die Macht des fossilen Kapitals im Staat verankert. Und zu schwach ist, trotz des vielfältigen sozialen Engagements in diese Richtung, der gesellschaftliche Druck für eine sozial und ökologisch nachhaltige Lebensweise.
Der weltweite Ölverbrauch hat bereits im Jahr 2019 die historische Marke von 100 000 000 Barrel Öl – pro Tag – überschritten und nimmt zu. Der globale CO2-Ausstoß steigt weiter an. Das vereinbarte Klimaziel von 1,5 Grad Erwärmung wurde 2024 erstmals für ein ganzes Jahr überschritten und ist längst nicht mehr einzuhalten. Das relativiert die teilweise Dekarbonisierung in Deutschland. Zwar sind hier die Emissionen zwischen 1990 und 2023 um 46 Prozent gesunken, aber teilweise wurde klimaschädliche Produktion ins Ausland verlagert. Im Verkehrssektor ist der Ausstoß an Treibhausgasen ohnehin gestiegen, weshalb das Umweltbundesamt völlig zu Recht Nachbesserungen von der Politik zur „drastischen“ Emissionsminderung verlangt. Selbst im „Vorreiterland“ China mit seinem Bestand von 45 Prozent der weltweiten Elektrofahrzeuge ist deren Betrieb nicht nachhaltig. Denn der Strom kommt zum großen Teil aus Kohle-, Gas- und Atomkraftwerken – und vom enormen Energie- und Rohstoffbedarf der Elektromobilität wird kaum gesprochen.[1]
Zugleich nimmt die soziale Ungleichheit in Deutschland und global weiter zu, was ein wichtiger Aspekt der von Messner konstatierten „Transformationsmüdigkeit“ ist. Er spricht die „sozialen Implikationen“ des angestoßenen Umbaus der Wirtschaft an. Das ist sehr zurückhaltend formuliert.
Tatsächlich kommen bei vielen Menschen die ökologischen Umbauprojekte als „ökologische Austerität“ an, denn die Kosten der teilweisen Transformation müssen bisher vor allem ärmere Menschen tragen, während Besserverdienende von den staatlichen Subventionen, etwa beim E-Auto-Kauf oder dem Heizungswechsel, profitieren. Das wiederum nutzen rechtsautoritäre Parteien populistisch und mit antiökologischer Ausrichtung, um gegen jeglichen Klimaschutz zu agitieren.
»Die Klimabewegung hatte nicht den nötigen langen Atem und nicht die nötige Mobilisierungsstärke.«
Es ist richtig, dass es 2019 durch Fridays for Future eine starke Politisierung der Klimakrise gab, und Teile der Industrie schienen ökologische Probleme ernstzunehmen. Auch das Bundesverfassungsgericht trug mit seinem Urteil im April 2021 – nach dem die Belange künftiger Generationen schon jetzt zum Handeln verpflichten – zu einem gewissen Veränderungsdruck bei.
Doch die Wirkung dieser Initiativen blieb insgesamt gering. Die Klimabewegung hatte nicht den nötigen langen Atem und die ausreichende Mobilisierungsstärke. Dass sich Bündnis 90/Die Grünen letztlich gegen die Proteste von Lützerath stellten und somit die Kohleverstromung verteidigten, steht symbolisch für diese Kräfteverhältnisse.[2] Wie Messner vor allem auf eine „klare Kommunikation und Überzeugungskraft zum individuellen und gesellschaftlichen Nutzen der Umbauprozesse“ zu hoffen, verkennt, wie stark der Fossilismus weiterhin wirtschaftlich, staatlich und gesellschaftlich in Deutschland verankert ist.
Der Widerstand aus Politik und Wirtschaft gegen die notwendige CO2-Minderung ist groß und gut organisiert, die Verteidigung der „imperialen Lebensweise“ ist weitgehend Konsens. Das gilt international und auch für die Europäische Union, die sich selbst auf den Klimakonferenzen immer wieder als Vorreiter inszenierte.[3] Folglich konnten die klimapolitischen Maßnahmen den kontinuierlichen weltweiten Anstieg fossiler Energien in den letzten 30 Jahren auch nicht verhindern. Vielmehr werden die erneuerbaren Energien nur als Ergänzung ausgebaut, während gleichzeitig fossile Energieträger intensiv gefördert, genutzt und neu erschlossen werden.
»Der Emissionshandel eröffnet kriminelle Schlupflöcher.«
Diese Dynamik konnte auch der Emissionshandel bisher nicht brechen. Trotzdem bewertet Messner diesen als „erfolgreiches Anreizsystem, das Marktkräfte für den Klimaschutz mobilisiert“. Doch zum einen ist der Emissionshandel sozial ungerecht, weil er ärmere Bevölkerungsschichten durch höhere Heizkosten oder die Verteuerung der Mobilität stärker belastet als Vermögende. Wie Messner sehr berechtigt bemängelt, werden etwa die hohen staatlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Verschmutzungsrechten bisher nicht in Form eines Klimageldes ausgezahlt. Dies müsste sozial gerecht erfolgen.
Zum anderen ermöglicht er eine „kreative“ Kohlenstoffbuchführung. Auf die (kriminellen) Schlupflöcher, die der Mechanismus für saubere Entwicklung und der Emissionshandel eröffnen, wurde schon früh hingewiesen.[4] Seit 2024 sieht sich auch das Umweltbundesamt damit konfrontiert, weil deutsche Konzerne unter Betrugsverdacht geraten sind. Messner selbst vermutet an anderer Stelle ein „Täuschungssystem“ mit fingierten Projekten, die es etwa Ölkonzernen ermöglichen, ihre Klimaziele auf dem Papier zu erreichen, ohne ein Gramm CO2 eingespart zu haben.[5]
»Die sozial-ökologische Transformation ist ohne Veränderung der Machtverhältnisse zuungunsten des fossilen Kapitals nicht zu erreichen.«
Die selektive Transformation, die wir beobachten, findet unter Kontrolle starker Kapitalgruppen statt und ist nur mit massiver staatlicher Unterstützung möglich. Die Akkumulations- und Wachstumsdynamik kapitalistischer Gesellschaften führt zudem zu widersprüchlichen Entscheidungen der Politik. Die aktuelle und selbstverursachte Krise der deutschen Automobilindustrie ist ein anschauliches Beispiel dafür. Mit staatlicher Rückendeckung wurde zu lange – gegen jede Diskussion über Konversion oder Elektromobilität – eine Klientel bedient, die im fossil betriebenen SUV ihren Mobilitäts- und Freiheitsanspruch verteidigte.
In Messners Beitrag erscheint der Staat dennoch als der zentrale Akteur der Transformation, der die Implementierung von politischen Maßnahmen für den sozial-ökologischen Umbau beschleunigen muss. Staatliche Politik sollte sich dabei „nicht auf die Detailsteuerung konzentrieren, sondern den Gestaltungswillen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen mobilisieren“. Er erweckt den Eindruck, als seien die Unternehmen im Wesentlichen guten Willens. Es sind aber nicht nur wenige „potenzielle Verlierer der Transformation, etwa die Gas- und Kohleindustrie oder die Hersteller von Verbrennermotoren“, die sich gegen den notwendigen grundlegenden Umbau wehren. Die Studie „Banking on Climate Chaos“, die jährlich von großen Umweltverbänden publiziert wird, zeigt für das Jahr 2023, dass die 60 größten Privatbanken weltweit über 700 Mrd. US-Dollar in fossile Energien investiert haben, davon 350 Mrd. in die Expansion der Förderung; Tendenz steigend.[6]
Die wesentlichen Zukunftsentscheidungen werden über solche Investitionen von profitorientierten Unternehmen getroffen. Diese unter Weltmarktkonkurrenz stattfindenden Dynamiken lässt Messners Text unberücksichtigt. Die sozial-ökologische Transformation ist aber ohne Veränderung der Machtverhältnisse zuungunsten des fossilen Kapitals nicht zu erreichen.
»Der Staat ist selbst Bestandteil des fossilen Kapitalismus.«
Das Umweltbundesamt ist eine staatliche Institution, die wichtige Beiträge zum Klimaschutz leistet und die es gerade jetzt im Wahlkampf gegen die Angriffe etwa von der FDP zu verteidigen gilt. Es entwickelt naturgemäß vor allem Vorschläge für staatliches Handeln. Bei der Analyse der Klimakrise sollten wir aber nicht einer Steuerungsillusion verfallen und glauben, allein der Staat könne mit den angemessenen Rahmenbedingungen die Dekarbonisierung vorantreiben. Denn der Staat ist selbst integraler Bestandteil des fossilen Kapitalismus, der sich mit Trump und Co. zu einem „fossilen Faschismus“ auszuweiten droht.[7]
Auch in der Europäischen Union werden ernsthafte Bemühungen um eine sozial-ökologische Transformation auf dem Altar von Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit geopfert und in Ländern wie Ungarn, Slowenien oder Tschechien zunehmend autoritär abgesichert.
Fraglos handelt es sich bei dem Beitrag von Messner um eine kurze und pointierte Intervention. Dennoch halten wir es für problematisch, die internationale Dimension der sozial-ökologischen Transformation weitgehend auszublenden. Der Ausbau der dekarbonisierten Wirtschaftssektoren des Globalen Nordens ist nicht nur unzureichend und findet unter Bedingungen geopolitischer und geoökonomischer Konkurrenz statt (vgl. etwa den Draghi-Report für die EU-Kommission), sondern er vertieft die Ausplünderung der rohstoffreichen Länder des Globalen Südens mit allen negativen und ungerechten Folgen für die dort lebenden Menschen.
»Veränderungen werden in harten sozialen Auseinandersetzungen von engagierten Bürger:innen, sozialen Bewegungen und NGOs erzielt.«
Es stimmt: „Ohne Klimaschutz und die Vermeidung von Erdsysteminstabilitäten ist Wohlstandssicherung unmöglich“. Genau deshalb müssen viel konkretere und auch unangenehme Vorschläge auf die Transformationsagenda: Eine Vermögensteuer für Wohlhabende und Superreiche, der Rück- und Abbau der fossilen Industrien, das Ende des – auch „grünen“ – Extraktivismus im Globalen Süden mit all seinen sozialen Verwerfungen.
Die „planetaren Grenzen“ müssen um „gesellschaftliche Grenzen“[8], vor allem für die Vermögenden und Mächtigen, ergänzt werden. Davon sind Deutschland und die Welt jedoch noch weit entfernt. Dass sich staatliche Akteure, Pionierallianzen oder sogar die Gesellschaft als Ganzes in nächster Zeit auf einen „ambitionierten Entwicklungspfad zur Nachhaltigkeit verständigen“ werden, ist deshalb unrealistisch. Veränderungen werden in mitunter harten sozialen Auseinandersetzungen von engagierten Bürger:innen, sozialen Bewegungen und NGOs erzielt. Sie können sich allenfalls in staatlicher Politik ausdrücken, wenn es dort progressive und konfliktbereite Akteure gibt, die die Transformation unterstützten.
Dafür bedarf es in Organisationen und auch im Staat vermehrter „transformativer Zellen“.[9] Auch wissenschaftliche Einrichtungen, politiknahe Thinktanks wie das UBA können mit progressiven Positionen dagegenhalten und Vorschläge entwickeln, wie die Machtkonstellationen sozial-ökologisch umgebaut werden können. Solche Ideen gibt es, Konflikte um ihre Stärkung finden schon lange statt.
Ein Ansatzpunkt wäre eine breite Debatte um sozial-ökologische Infrastrukturen, also die physischen, institutionellen und mentalen Bedingungen für alltägliche nachhaltige Praktiken des Arbeitens, Fortbewegens, Konsumierens und Zeitverbringens: Etwa ein anderes Mobilitätssystem, weg von der heutigen Auto- und Flugzeugfixierung, oder eine nichtindustrielle und zumindest fleischarme Landwirtschafts- und Ernährungsweise.[10]
In Zeiten von Krieg, populistischen Erzählungen, Ängsten und Unsicherheiten ist der Gegenwind stärker geworden. Solche Vorschläge bleiben dennoch wichtig, um im Sinne Messners „attraktive Zukunftsbilder“ entstehen zu lassen und gesellschaftlich umsetzen zu können.
[1] Achim Brunnengräber und Tobias Haas (Hg.), Baustelle Elektromobilität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf die Transformation der (Auto) Mobilität, Bielefeld 2020.
[2] Markus Wissen und Ulrich Brand, Lützerath als Fanal. Warum wir transformative Strategien im Kampf gegen die Klimakrise brauchen, in: „Blätter“, 2/2023, S. 90-94.
[3] Dieter Plehwe, Tobias Haas und Moritz Neujeffski, Climate Obstruction in the EU: Business Coalitions and the Technocracy of Delay, in: Robert Brulle (Hg.), Climate Obstruction in Europe, Oxford 2024, S. 320-346.
[4] Elmar Altvater und Achim Brunnengräber (Hg.), Ablasshandel gegen Klimawandel?, Hamburg 2008.
[5] UBA schaltet Zertifikate bei acht UER-Projekten nicht frei, umweltbundesamt.de, 6.9.2024.
[6] Banking on Climate Chaos 2024: Fossil Fuel Finance Report, oilchange.org, 14.5.2024.
[7] Andreas Malm, Zetkin Collective, White Skin, Black Fuel. On the Danger of Fossil Fascism, London 2021.
[8] Ulrich Brand, Barbara Muraca, Miriam Lang et al., From Planetary to Societal Boundaries, in: „Sustainability: Science, Practice and Policy“, 2021, S. 265-292.
[9] Ulrich Brand und Markus Wissen, Kapitalismus am Limit. Öko-imperiale Spannungen, umkämpfte Krisenpolitik und solidarische Perspektiven. München 2024.
[10] Christoph Görg u.a. (Hg.), Strukturen für ein klimafreundliches Leben, APCC Special Report, Wiesbaden 2023.