Wie die ökologische Transformation noch gelingen kann
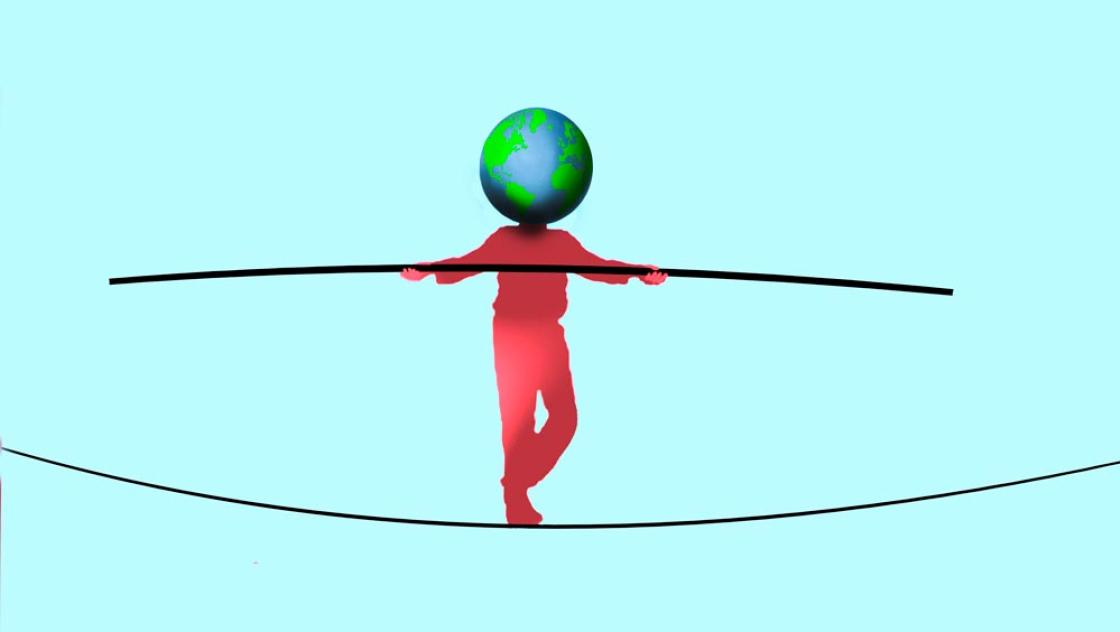
Bild: Symbolblid: Ein Mensch mit Globus als Kopf balanciert auf einem Seil (IMAGO / Westend61)
Wir waren schon mal weiter mit der Transformation hin zur Nachhaltigkeit. Noch vor wenigen Jahren schien das Tor weit aufgestoßen zu sein für den Weg in eine Gesellschaft, die Wohlstand, Freiheit und Demokratie in den Grenzen der Ökosysteme organisiert. So entschied im April 2021 das Bundesverfassungsgericht, dass dem Klimaschutz für die körperliche Unversehrtheit der Bürger sowie für die Rechte zukünftiger Generationen eine hohe Bedeutung zukomme. Die Karlsruher Richter schrieben, dass „die Schonung künftiger Freiheit verlangt […], den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten“. Der Klimaschutz in Deutschland müsse daran ausgerichtet werden, die durchschnittliche globale Temperaturerhöhung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Auch beim Bundesverband der Deutschen Industrie schien die Botschaft angekommen zu sein. Der Verband veröffentlichte im Oktober 2021 seine Studie „Klimapfade 2.0 – Ein Wirtschaftsprogramm für Klima und Zukunft“, in der Wege beschrieben wurden, um bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen. Etwa zeitgleich erschien, pünktlich zu den Koalitionsverhandlungen der Ampelregierung, die Publikation „Deutschlands neue Agenda“.[1] Darin skizzierten 50 CEOs wichtiger deutscher Unternehmen den Umbau ihrer Betriebe zur Klimaneutralität.
Zur gleichen Zeit mobilisierte Fridays for Future Millionen vor allem jüngerer Menschen für den globalen Klimaschutz. Und der von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, einer Christdemokratin, angestoßene European Green Deal (EGD) signalisierte, dass Klima- und Umweltschutz ins Zentrum wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Modernisierungsdebatten gerückt waren. „Grünes Wirtschaften“ hatte die Blase der klassischen Umwelt-Community verlassen. Folgerichtig übertrug die Ampelregierung die Kernziele des EGD in ihren Koalitionsvertrag.
50 Jahre nachdem mit dem ersten Bericht des Club of Rome die Debatte um die Grenzen des Wachstums begonnen hatte, schien endlich die Dekade der Klima- und Nachhaltigkeitspolitik anzubrechen. Es gab viel Anlass zu Optimismus. Doch heute, nur wenige Jahre später, fällt es vielen Beobachtenden schwer, sich an diese Aufbruchsstimmung zu erinnern. Was ist passiert?
Zwei Veränderungen sind dafür verantwortlich, dass Klimaschutz, Nachhaltigkeit und der European Green Deal erneut in schweres Fahrwasser geraten sind: Erstens befinden sich unsere Gesellschaften nun mitten in der Transformation, insbesondere des Energiesystems, die ihre eigenen Gegendynamiken und Herausforderungen schafft. Die Geschwindigkeit des Wandels, beispielsweise in der Energiewirtschaft, ist hoch. Auch wird der Wandel für viele Menschen unmittelbar spürbar und damit konkret, sie erleben tiefgreifenden und anspruchsvollen Veränderungsdruck, sei es in den Mobilitäts- oder auch in den Ernährungssystemen. Immer deutlicher wird dabei, dass die Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft ein Marathonlauf ist, der bis etwa Mitte des Jahrhunderts andauern dürfte.
Auf den Aufbruchsmoment folgen Verunsicherung, Sorge und Veränderungsresistenz. Der Einstieg in die beschleunigte Transformation weckt Skepsis: Kann dieser Prozess gelingen, wer trägt die Kosten des Wandels? Zugleich wehren sich die potentiellen Verlierer der Transformation, etwa die Gas- und Kohleindustrie oder die Hersteller von Verbrennermotoren, gegen die Klimaneutralität. Letztlich kollidiert der auf die Zukunft gerichtete Veränderungsschwung mit ökonomischen Gegenwartsinteressen und pfadabhängigen gesellschaftlichen Haltungen – und wird ausgebremst.
Zweitens ziehen andere massive Krisen Aufmerksamkeit und Ressourcen auf sich: Der Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat Kriegsängste geschürt, und die sich daran anschließende Gas- und Energiekrise führte zu Inflation und ökonomischen Turbulenzen. Zudem sieht sich der Westen mit Demokratiekrisen konfrontiert: Die multilaterale Kooperation, eine Voraussetzung für globalen Klimaschutz bis Mitte des 21. Jahrhunderts, wird durch Spannungen zwischen autoritären und offenen Gesellschaften – und die interne Gefährdung letzterer durch rechtspopulistische Kräfte – unterminiert. Auch der Krieg im Nahen Osten lenkt die Aufmerksamkeit auf sicherheitspolitische Fragen.
Angesichts dessen können wir die Transformationsagenda nicht auf die gleiche Weise verwirklichen wie 2021 geplant. In den vergangenen zwei Jahrzehnten setzten die Vorreiterinnen und Vorreiter der Transformation aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft darauf, Pionierallianzen zu entwickeln, um den Wandel an möglichst vielen Punkten in Gesellschaft und Wirtschaft zu verankern. Die „Häufigkeitsverdichtungen“[2] von 2020/21 zeigen, dass dieser Ansatz zunächst wirkungsvoll war. Doch um nun die notwendigen massiven Veränderungen trotz multipler Krisen voranzutreiben, bedarf es eines nächsten Schrittes: Es gilt, von den etablierten und gewachsenen Pionierallianzen hin zu gesellschaftlichen Mehrheiten zu kommen. Eine große Wirkung hätte es, wenn sich die demokratischen Kräfte auf einen ambitionierten Entwicklungspfad zur Nachhaltigkeit verständigen könnten. Doch einen solchen Konsens gibt es derzeit nicht (mehr). Das zeigt sich daran, dass der EGD – Symbol und Kernbaustein der Transformation – mit den neuen Mehrheiten in der EU an vielen Stellen verwässert zu werden droht.
Bisher wurden drei Ansätze verfolgt, um Mehrheiten für die Transformation zu gewinnen. Alle drei sind gescheitert: Das gilt, erstens, für die „technokratische Illusion“, man müsse wissenschaftlich gut begründete Umbaufahrpläne einfach nur umsetzen, wenn man dafür eine Regierungsmehrheit besitzt. In der Tat braucht es Fahrpläne, die den angestrebten technologischen Wandel skizzieren sowie Anreizstrukturen und Politikinstrumente aufzeigen. Sie allein genügen aber nicht, um erfolgreiche Veränderungsprozesse einzuleiten, weil sie unterschätzen – oder ganz ausblenden –, wie Dynamiken gesellschaftlichen Wandels verlaufen, wie schwer normative Neuorientierungen sind und wie widersprüchlich und behäbig institutionelle und gesellschaftliche Transformationen verlaufen. Dagegen hilft nur klare Kommunikation und Überzeugungskraft zum individuellen und gesellschaftlichen Nutzen der Umbauprozesse.
Zweitens sind etatistische Annahmen ins Leere gelaufen, die suggerieren, dass ein „kluger Staat“ die Transformation quasi hinter dem Rücken der Bürgerinnen und Bürger geräuschlos zum Erfolg führen könnte. Dies überschätzt die Steuerungsfähigkeiten des Staates und unterschätzt, welche Veränderungsanforderungen an Gesellschaft und Wirtschaft ein tiefgreifender Wandel zur Klimaneutralität stellt. Zudem vermittelt eine solche Politik den Eindruck, sie nehme Anliegen, vielleicht auch Nöte, nicht ernst.
Mehrheiten für Veränderungen gewinnen
Drittens stößt jede Kommunikationsstrategie auf Ablehnung, wenn sie als eine „Politik des moralischen Zeigefingers“ wahrgenommen wird, und das, obwohl die Unterstützung für Klimaneutralität in der Gesellschaft weiterhin groß ist.[3] Dabei gibt es einen schmalen Grat zwischen wichtiger Aufklärung zu Klima- und Erdsystemrisiken und gut begründeten Plädoyers für notwendige Transformationsprozesse auf der einen Seite und Äußerungen, die als „Besserwisserei“ oder „Bevormundung“ interpretiert werden, auf der anderen. Es gilt also, sprachliche Brücken zwischen denen zu bauen, deren Geduld überstrapaziert wird, weil sie seit Jahrzehnten und auf Grundlage überwältigender wissenschaftlicher Erkenntnisse dafür werben, die Realitäten der Klimakrise anzuerkennen und angemessen zu handeln – und jenen, die die Aufrufe der Mahner und Warner als „Belehrung“ empfinden. Aus der Psychologie ist bekannt, dass Gesellschaften Zeit und überzeugende Vorbilder brauchen, um von Verdrängung („wird schon nicht so schlimm mit der Klimakrise“) zu Lernprozessen („wir müssen und können handeln“) zu kommen.
Um vor diesem Hintergrund eine erneuerte Transformationsperspektive zu entwickeln, kommt es zunächst auf die „Pioniere des Wandels“ an. Sie müssen mit anderen und möglichst vielfältigen Akteuren Mehrheiten für die anstehenden Veränderungen gewinnen – und zwar ohne ihre Ambitionen aufzugeben. Die Wissenschaft hat vielfach darauf hingewiesen, wie knapp bemessen die Zeit ist, um Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels zu finden, und wie tief der notwendige Umbau ausfallen muss. Das wird nur gelingen, wenn Entscheidungsträger „Führung“ übernehmen und für Veränderung kämpfen. Vorbild könnten Konrad Adenauers Durchsetzung der Westbindung der Bundesrepublik oder die Ostpolitik Willy Brandts sein – beide Weichenstellungen waren zu ihrer Zeit hochumstritten.
Die Politik sollte sich dabei nicht auf die Detailsteuerung konzentrieren, sondern den Gestaltungswillen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen mobilisieren. Anreizstrukturen für die Wirtschaft und Mitmachangebote für Bürger können hierzu beitragen. Auch dafür gibt es gute Beispiele. So ist der Europäische Emissionshandel ein erfolgreiches Anreizsystem, das Marktkräfte für den Klimaschutz mobilisiert und eine kleinteilige Regulierung vermeidet. Und der vom Bundestag eingesetzte „Bürgerrat für Ernährung im Wandel“ hat 2024 erstaunlich weitreichende Reformen vorgeschlagen, die so gar nicht zur allgemeinen Veränderungsmüdigkeit passen.
Zudem haben der ambitionierte European Green Deal und anspruchsvolle Klimaschutzpläne wie das deutsche Klimaneutralitätsziel 2045 eine Reihe von Herausforderungen zweiter Ordnung hervorgebracht, die aus den Transformationsfahrplänen und deren Implementierung resultieren. Zentral für das Gelingen der Transformation[4] ist es, die vielfältigen sozialen Implikationen zu berücksichtigen, die der durch den EGD angestoßene Umbau der Wirtschaft mit sich bringt. Diese wurden von vielen „Architekten der Transformation“ unterschätzt. Auch in der 2011 vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen publizierten Studie zur „Großen Transformation“ – an der der Autor maßgeblich beteiligt war –, finden sich nur wenige Hinweise darauf, dass einzig eine sozial ausgestaltete, auch verletzliche Gruppen berücksichtigende Klima- und Umweltpolitik eine Chance hat, mehrheitsfähig zu werden.[5] Gleichzeitig gilt aber: Der Wandel muss schnell erfolgen, um die Klima- und Ökosystemziele erreichen zu können. Es bedarf also einer grundlegenden Modernisierung des Staates und einer Steigerung seiner Leistungsfähigkeit, um den EGD und die Transformation generell zum Erfolg zu führen. Die Umwelt- und Klimaforschung muss zeigen, wie beschleunigte Implementierung, weniger Bürokratieaufwand und verbesserte politische Wirksamkeit möglich sind, ohne Umweltziele und Standards abzusenken. Digitalisierung und klug eingesetzte Künstliche Intelligenz werden dabei eine zentrale Rolle spielen.[6] Die Veränderungsmüdigkeit der Gesellschaft ist auch eine Reaktion auf die komplexen Herausforderungen und Nebenwirkungen der Transformation. Aber sie darf nicht dazu führen, die Reformambitionen zu reduzieren. Doch genau das ist derzeit der Fall, wie das Beispiel der Landwirtschaftspolitik zeigt, die nach den Bauerndemonstrationen[7] Anfang des Jahres hinter bereits 2021 erreichte, klima- und umweltpolitische Kompromisse der Zukunftskommission Landwirtschaft zurückfiel. Doch ohne Veränderungsbereitschaft kann ein anspruchsvoller EGD nicht gelingen – und ohne sie steuern wir auf die Kipppunkte im Erdsystem zu.
Um die Veränderungsbereitschaft der Menschen zu stärken, braucht es soziale Sicherheit und attraktive Zukunftsentwürfe, die mit der Klima- und Umweltpolitik verknüpft sind. Es bedarf ferner Angebote zur Mitgestaltung und eines starken Konsenses der demokratischen Parteien und der Wirtschaft über die zentralen Leitlinien der Transformation. Aber ein solcher lässt sich schwieriger herstellen, als es bei der Verabschiedung des EGD schien. Das liegt auch daran, dass mit dem Green Deal lange tabuisierte Themen auf die Tagesordnung kommen. Dadurch entstehen Konflikte zwischen den Protagonisten des Wandels, wenn es beispielsweise um negative Emissionen und die Bedeutung von CCS geht.[8] Dazu zählen aber auch Konflikte zwischen Klima- und Naturschutz und die Risikoabwägung beim Geoengineering.
Zudem wurde zuweilen übersehen, dass die ökologische Transformation nicht der einzige fundamentale Veränderungsprozess ist, der unsere Gesellschaften beschäftigt: Digitalisierung und KI oder auch massive Machtverschiebungen im internationalen System haben ähnlich weitreichende Auswirkungen. Kurz gesagt zeigen diese Probleme zweiter Ordnung: Es reicht nicht aus, technisch gut durchdachte Transformationsfahrpläne zu entwickeln, denn ihre Umsetzung kann an nicht intendierten und vernachlässigten Nebenwirkungen scheitern.
Legitimationsgrundlagen stärken
Offene Gesellschaften sind nach Kant nicht etwa Gemeinwesen, in denen ausschließlich die jeweiligen Individualinteressen der Bürger verfolgt werden sollten, sondern solche, in denen „aus guten Gründen gehandelt wird“, um die normative Ordnung zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Verantwortungsvolles Handeln in einer Bürgergesellschaft setzt „gute Gründe“ für Entscheidungen voraus, die sich nicht auf persönliche Präferenzen reduzieren lassen. Das gilt auch für die Transformation zur Nachhaltigkeit.
Weitreichende Veränderungen bedürfen einer starken gesellschaftlichen Legitimation. Die aktuelle Umweltbewusstseinsstudie des Umweltbundesamtes[9] zeigt, dass sich die deutsche Gesellschaft in einer 90-40-70-Konstellation befindet: 90 Prozent der Bürgerinnen und Bürger halten eine anspruchsvolle Klimapolitik für angemessen, trotz eines insgesamt krisengeprägten Umfeldes. Das liefert zunächst Rückenwind für alle jene, die Klimaschutz betreiben. Doch zugleich sind 40 Prozent der Menschen davon überzeugt, dass die Transformation ihren sozialen und ökonomischen Status unterminiere. Viel wird also davon abhängen, die soziale Ausgestaltung des Wandels ernst zu nehmen. Da geht es um die Kosten für Energie und Heizungssanierung, um die Preise für Mobilität und Ernährung, um die CO2-Preisgetriebene Inflation oder um ein aus dem Emissionshandel finanziertes Klimageld. 70 Prozent der Deutschen geben zudem an, sie würden die Vielzahl von klimabezogenen Reformen, Instrumenten und Initiativen nicht mehr überblicken und verstehen. Dies führt zu Verunsicherung und Politikfrust, vor allem wenn sie von einer regelrechten Kakophonie an zuweilen wenig seriösen Äußerungen zur Klimapolitik begleitet wird, maßgeblich betrieben von der AfD, aber auch von demokratischen Parteien, innerhalb und außerhalb der Regierung. Gelingt es den demokratischen Parteien nicht, den „Häufigkeitsverdichtungsmoment“ zu erneuern, der 2020/21 die Realitäten der Erdsystemkrise und die Richtung des nötigen Wandels wie unter einem Brennglas sichtbar machte, dann können die Klimaziele weder auf deutscher noch auf europäischer Ebene erreicht werden.
Um eine solche Deutungshoheit für die Transformation zurückzugewinnen, muss eine Diskursverschiebung korrigiert werden, die in den Debatten vor der Europawahl und den Landtagswahlen in Ostdeutschland prägend war. Drei Behauptungen rückten dabei in den Vordergrund. Erstens: Klimaschutz müsse in der Wirtschaftskrise weniger ambitioniert ausfallen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu schützen und zu stärken. Zweitens: Sicherheit vor Russland und Investitionen ins Militär müssten Priorität vor öffentlichen Investitionen in den Klimaschutz haben. Drittens: Klimaschutzauflagen würden die Bürgerinnen und Bürger bevormunden und ihre Freiheit einengen.
Diese simplizifierenden Gegenüberstellungen zwischen Klimaschutz auf der einen und Wohlstandsicherung, Sicherheit und Freiheit auf der anderen Seite fallen in einer veränderungserschöpften Gesellschaft auf fruchtbaren Boden. Umso wichtiger ist es, diesem rückwärtsgewandten Diskurs eine Zukunftsperspektive entgegenzuhalten, die im Einklang mit den Befunden der breiten Wissenschaft steht.
Klimaschutz muss den wirtschaftlichen Strukturwandel, neue militärische Sicherheitsbedrohungen und aggressive Staaten sowie die Attacken auf Freiheit und Demokratie berücksichtigen. Doch umgekehrt gilt auch: Ohne Klimaschutz und die Vermeidung von Erdsysteminstabilitäten ist Wohlstandssicherung unmöglich. Denn eine weiter ansteigende globale Erwärmung wird viele Gesellschaften und Staaten überfordern, manche Regionen unbewohnbar machen und daher Wohlstandsgrundlagen unterminieren sowie Räume der Unsicherheit im internationalen System schaffen, die sich auch in entsprechenden Migrationsbewegungen ausdrücken werden.
Scheitert der Klimaschutz und lassen sich Demokratie und Wohlstand nicht in den planetaren Grenzen organisieren, dann werden die Gestaltungsspielräume und Freiheiten künftiger Generationen deutlich kleiner sein. Wenn es dagegen gelingt, diese Grundprämissen zu „guten Gründen des Handelns“ zu machen, kann die Tür zu attraktiven Visionen für eine nachhaltige Gesellschaft wieder aufgedrückt werden. Für demokratischen Streit um die jeweils besten, wirksamsten, gerechtesten Instrumente des Wandels bleibt dann immer noch genügend Raum.
[1] Veronika Grimm, Joachim Lang, Dirk Messner, Dirk Meyer, Lutz Meyer, Sigrid Nikutta und Stefan Schaible (Hg.), Deutschlands Neue Agenda. Die Transformation von Wirtschaft und Staat in eine klimaneutrale und digitale Gesellschaft, München 2021.
[2] Vgl. Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, München 2009. Dort stellt der Historiker fest, dass sich Epochenschwellen durch „Häufigkeitsverdichtungen von Veränderungen“ auszeichnen.
[3] Umweltbewusstsein in Deutschland 2022, umweltbundesamt.de.
[4] Ambitionierter Klimaschutz: Fallstricke und Bedingungen des Gelingens, umweltbundesamt.de, Januar 2023.
[5] Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, wbgu.de, 17.3.2011.
[6] Für einen grünen und gerechten Wandel in Europa. Empfehlungen für die Umwelt- und Klimapolitik der EU in den kommenden Jahren, umweltbundesamt.de, 12.6.2024.
[7] Vgl. Thomas Fickel und Gesine Langlotz, Die Wut der Bauern, in: „Blätter“, 8/2024, S. 109-116.
[8] Lila Warszawski et al., All options, not silver bullets, needed to limit global warming to 1.5 °C: a scenario appraisal, in „Environmental Research Letters“, 6/2021.
[9] Umweltbewusstsein in Deutschland 2022, umweltbundesamt.de, September 2023.











