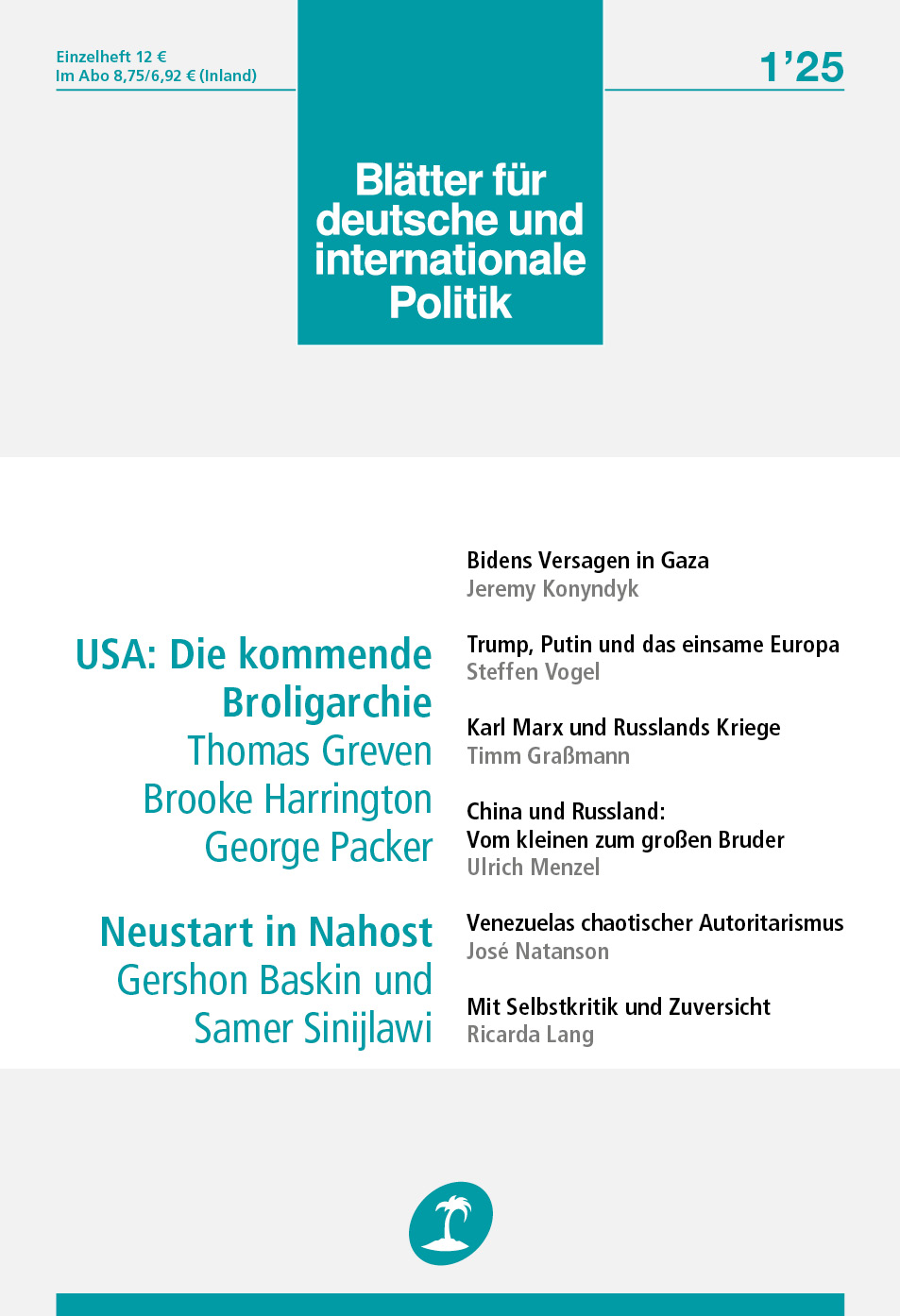Bild: Ein Zivildienstleistender im Altenheim des Johanniter Krankenhauses in Rheinhausen, 3.6.2011 (IMAGO / Funke Foto Services / Hayrettin Özcan)
Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, schlägt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine „soziale Pflichtzeit“ vor. Der Journalist Wolfgang Kessler plädiert dafür, die Debatte zu weiten – und jungen Menschen im Gegenzug für ein Gesellschaftsjahr ein Grunderbe in Aussicht zu stellen – als Schritt in eine solidarische Gesellschaft, die sich resilient gegenüber den kommenden Krisen zeigt.
Um den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es schlecht bestellt. Immer stärker zerfällt sie in verschiedene Szenen und Kulturen, die sich gegenseitig zunehmend weniger zu sagen haben. Auch die Konflikte zwischen den Generationen nehmen zu.
In dieser gesellschaftlichen Krise wird es Zeit für unkonventionelle Ideen. Dazu zählt die Forderung nach einem verpflichtenden Gesellschaftsjahr für alle jungen Menschen ab 18 Jahren. Wird darüber immerhin debattiert, so wird ein anderer Vorschlag kaum wahrgenommen: Nämlich der, allen jungen Menschen ein Grund-erbe auszuzahlen, also einen Anteil an dem riesigen Vermögen von rund 400 Mrd. Euro, das jährlich vererbt wird, aber an jener Hälfte der jüngeren Generation vorbeigeht, deren Eltern wenig besitzen.[1] Gesellschaftsjahr und Grunderbe, was wäre, wenn man beides zusammendenkt? Dann könnte daraus eine Vision von solidarischer Gesellschaft entstehen, die ihre Resilienz in Krisen stärkt. Es wäre eine gesellschaftliche Zeitenwende.
Aber der Reihe nach. Was die Dienstpflicht angeht, so hat die Diskussion begonnen. Allerdings konzentrieren sich die meisten Stimmen auf einen mehr oder weniger freiwilligen Wehrdienst, um damit die zunehmenden Personalprobleme bei der Bundeswehr zu entspannen. Doch manche Äußerungen reichen auch tiefer. Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) forderte ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle jungen Menschen. Bei der CDU steht das Konzept im Programm. Und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plädiert schon länger dafür.
Andererseits stößt die Forderung nach einem sozialen Pflichtjahr auf viel Widerstand. Es muss wohl an dem Wort „Pflicht“ liegen. Das Konzept widerspricht dem Begriff von individueller Freiheit und Freiwilligkeit, der das Denken in weiten Teilen von Politik und Gesellschaft prägt. So geißelt FDP-Chef Christian Lindner soziale Pflichtjahre „als Freiheitsentzug und Verschwendung von Lebenszeit“. Viele Linke und Grüne, die Jungsozialisten und die Grüne Jugend – in anderen Fragen sehr kritisch gegenüber dem Freiheitsbegriff der Liberalen – würden ihm da zustimmen. Auch Rainer Hub, Referent für freiwilliges soziales Engagement und Freiwilligendienste bei der Diakonie, findet „soziales Engagement vor allem gut, wenn es auf freiwilliger Basis betrieben und nicht fremdbestimmt wird“. Kein Zweifel, individuelle Freiheit und Freiwilligkeit sind wichtige Grundsätze in einer demokratischen Gesellschaft. Sie alleine können aber den notwendigen Zusammenhalt derselben nicht sicherstellen. Beispielsweise entscheiden sich für die bisherigen Freiwilligendienste nur sieben Prozent jedes Jahrgangs.
»In den Schulen kommen fast nur Kinder aus demselben Herkunftsmilieu zusammen.«
Gerade ein Blick auf die Lage und Befindlichkeit junger Menschen zeigt, wie notwendig ein größerer gesellschaftlicher Zusammenhalt wäre. Mehr als drei Millionen Kinder und Jugendliche wachsen laut Paritätischem Wohlfahrtsverband in prekären Verhältnissen auf, manche schon in zweiter oder dritter Generation. Durch die starke Spreizung von Einkommen und Vermögen sind die Lebenschancen von jungen Menschen von Anfang an sehr unterschiedlich verteilt. Die frühe Selektion an den Schulen verstärkt die Spaltung. An Gymnasien und an vielen Realschulen sind die Kinder in erster Linie mit jenen zusammen, die aus ihrem Herkunftsmilieu kommen. Im Studium findet sich dann nur noch eine kleine Minderheit von Studierenden aus sozial benachteiligten Familien.
Obwohl im Netz immer mehr kommuniziert wird, bewegen sich junge Menschen in völlig unterschiedlichen Lebenswelten. Über die eigene Szene hinaus begegnen sie sich immer seltener – im Netz ebenso wie in der Realität. Die Isolation nimmt zu. „Wie einsam sind junge Menschen im Jahr 2024?“ Unter diesem fragenden Titel kommt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zu einem bedrohlichen Ergebnis: Ganz im Gegensatz zum hektischen Getriebe im Internet registriert sie bei 16- bis 30-Jährigen ein wachsendes Gefühl der Einsamkeit.
„In unserem Land mangelt es an Begegnung und Austausch zwischen den Verschiedenen“, sagte Bundespräsident Steinmeier, „zwischen Jungen und Alten, Armen und Reichen, Ost- und Westdeutschen, zwischen Städtern und Landbewohnern, zwischen hier Geborenen und Zugewanderten.“ Das gilt auch zwischen den Religionsgemeinschaften.
Dass sich Christen, Muslime und Juden gerne in ihren Gemeinden treffen, ist verständlich. Schwierig wird es jedoch, wenn sich Christen, Muslime und Juden nur noch in ihren Gemeinden treffen – oder nicht einmal mehr dort: „Früher gab es für all dies Gewerkschaften, Kirchen, den Zivil- und den Wehrdienst – da hat man automatisch ganz andere Leute getroffen als die, die man im familiären und beruflichen Umfeld kannte. Daran mangelt es heute“, bestätigt die Soziologin Jutta Allmendinger.
So wächst denn in der Gesellschaft die Spaltung zwischen verschiedenen Kulturen, Gruppierungen, Szenen oder etwa zwischen Stadt- und Landbewohnern. Es zeigt sich eine zunehmende soziale, kommunikative und kulturelle Separierung, die durch die anonymisierenden digitalen Techniken wesentlich verstärkt wird. „Unter diesen Bedingungen degeneriert der gemeinsame Raum des Politischen zum Kampfplatz konkurrierender Öffentlichkeiten“, schreibt der Philosoph Jürgen Habermas in seinem Buch „Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (2022). Dies ist eine große Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft – und für die Demokratie.
Das Auseinanderdriften der Gesellschaft spiegelt aber auch die kapitalistische Konkurrenz, in der den Menschen, auch und gerade den jüngeren, vorgegaukelt wird, sie allein seien ihres Glückes Schmied. Doch die Chancen, das eigene Glück zu schmieden, entscheiden sich auch daran, ob jemand in die Gewinner- oder in die Verliererseite hineingeboren wird. Unter den Verlierern wächst dann die Frustration. Zudem bleiben bei diesem Kampf um das persönliche Glück allzu oft die gesellschaftliche Verantwortung und das Bewusstsein für die Folgen dieser Konkurrenz auf der Strecke.
»Das Gesellschaftsjahr darf nicht zu einer billigen Ersatzlösung werden, um den Arbeitskräftemangel in der Pflege zu kaschieren.«
Was könnte ein Gesellschaftsjahr da-ran ändern? Zugegeben, es ist kein Patentrezept. Es bietet aber große Chancen, für junge Erwachsene und für die Gesellschaft insgesamt. Wenn es gelänge, alle jungen Menschen, die nicht schwer beeinträchtigt sind, für ein Jahr auf ein gesellschaftliches Engagement zu verpflichten und ihnen danach ein Startkapital für ihr Leben zu gewähren, das von der älteren Generation finanziert wird – dann wäre dies ein starker Beitrag zu einer gerechteren und solidarischeren Gesellschaft.
Wie sollte das Gesellschaftsjahr aussehen? Alle Beteiligten sollten frei darüber entscheiden können, wo sie es ableisten: bei der Bundeswehr, in sozialen Institutionen, in Sportvereinen, im Umweltbereich, im Entwicklungs- oder Friedensdienst, bei der Feuerwehr, im Katastrophenschutz. Sie erhalten dafür nur einen bescheidenen Lohn wie ehedem für Wehr- und Zivildienst. Für ein Jahr eröffnen sich viele sinnvolle Tätigkeiten. In Kitas, in Krankenhäusern, in der häuslichen Pflege und in Heimen – überall wäre Unterstützung wichtig. Aber nicht nur dort: Wer hilft, kommunale Gärten, Parks naturgerecht anzulegen oder gegebenenfalls Wälder aufzuforsten? Wer verstärkt die Feuerwehr, wer unterstützt die unzähligen Vereine, wer den Sport? Wer fördert Schülerinnen und Schüler bei ihren Hausaufgaben, wer die digitale Bildung älterer Menschen? Nicht zu vergessen sind auch Friedensdienste, die Entwicklungshilfe und der Wehrdienst.
Allerdings darf das Gesellschaftsjahr nicht zu einer billigen Ersatzlösung werden, um den Arbeitskräftemangel in der Pflege, in Kitas, in Schulen, im Umweltschutz und in anderen Bereichen zu kaschieren. Stattdessen soll es allen jungen Menschen ermöglichen, ihren Horizont über das gewohnte soziale und familiäre Umfeld hinaus zu erweitern und in neuer Umgebung ihre soziale Kompetenz und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.
»Unabhängig vom Konkurrenzkampf um Karrierechancen könnte das Gesellschaftsjahr einen Perspektivwechsel ermöglichen.«
Es wäre keine verlorene Zeit – im Gegenteil. Unabhängig von der gewohnten Umgebung und vom Konkurrenzkampf um Karrierechancen könnte es jungen Leuten einen Perspektivwechsel eröffnen. Alle müssten sich dann mit den Lebenswelten der anderen auseinandersetzen und mit denen ihrer – oft älteren – Kolleginnen und Kollegen. Dann träfen junge Frauen und Männer aus Gymnasien auf Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Christen arbeiteten mit Muslimen und Juden zusammen. Sie alle lernten sich endlich kennen – persönlich und nicht nur im Netz. Das könnte die Grundlage für mehr Solidarität schaffen.
Natürlich kann dies auch zu Frustration führen und Konflikte auslösen. Eine wichtige Voraussetzung für ein Gelingen des Konzepts wären deshalb Mentoren, die die jungen Menschen in diesem Jahr begleiten. Nicht selten würden auf diese Weise Basisqualifikationen für das Leben vermittelt, die Schulen nicht lehren (können): Eigenverantwortung, Initiativkraft oder auch Improvisationsvermögen.
Im Idealfall könnten die jungen Leute bei einer sinnstiftenden Arbeit Selbstwirksamkeit erfahren. Deshalb sollte dieses Gesellschaftsjahr auch für ältere Menschen geöffnet werden, die einen Perspektivwechsel anstreben. Das Erleben von Selbstwirksamkeit ist in persönlichen und gesellschaftlichen Krisensituationen besonders wichtig, um nicht von Ohnmachtsgefühlen überwältigt zu werden und in Resignation, Depression oder Aggression abzugleiten.
»Auch die Älteren müssen ihren Beitrag leisten.«
Aber das Gesellschaftsjahr ist nur die eine Seite der Medaille. Wenn die ältere Generation die Jüngeren in die Pflicht nimmt, muss nach dem Beitrag der Älteren gefragt werden. Und da kommt das Konzept „Erbe für alle“ ins Spiel. Nach einem Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin sollen „alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren ein Grunderbe von 20 000 Euro erhalten“, so der Ökonom Stefan Bach. Damit will das DIW alle jungen Menschen an dem Erbvermögen von jährlich 400 Mrd. Euro beteiligen. Finanziert werden sollen die Kosten von rund 15 Mrd. Euro „durch die Abschaffung von Privilegien in der Erbschaftssteuer, einem höheren Spitzensteuersatz oder einer Besteuerung hoher Vermögen“.
Auf diese Weise will Bach verhindern, dass das reichste Prozent der Gesellschaft, das bereits heute „466 Mal so viel besitzt wie die ärmere Hälfte der Bundesbürger“, in Zukunft noch mehr Reichtum auf sich konzentriert. „Mit einem jährlichen Erbe für alle jungen Erwachsenen ab 18 Jahren würde sich“, so Bach, „die Konzentration des Reichtums in den Händen des reichsten Prozents der Bevölkerung in 30 Jahren halbieren, während der Anteil der unteren Hälfte der Bevölkerung am Gesamtvermögen langsam steigt.“ Wie wäre es also mit einer Art von doppelter Solidarität: Alle jungen Menschen leisten ein Gesellschaftsjahr für das Gemeinwohl und erhalten danach einen Anteil am Erbvermögen in Höhe von 20 000 Euro – als Startkapital für ihr Leben.
»Gesellschaftsjahr und Grunderbe wären eine Investition in die Resilienz unserer Gesellschaft.«
Noch ist dies Zukunftsmusik. Aller Voraussicht nach erfordert die Einführung eines Pflichtjahres eine Änderung der Verfassung und es müssten internationale Rechtsfragen geklärt werden. Dennoch wäre es den Versuch wert, wenn sich die Anhänger dieses Vorschlags aus verschiedenen Parteien zusammenschlössen, um parteiübergreifend dafür zu werben.
Natürlich kostet er Geld – dazu müssten höhere Steuern auf sehr hohe Einkommen und Erbschaften durchgesetzt werden. Bedenkt man jedoch, welche Umwälzungen auf die Menschen als Folge der Krisen in den kommenden Jahren zukommen, dann wird die Resilienz der Gesellschaft darüber entscheiden, ob diese Veränderungen demokratisch bewältigt werden oder ob die Gesellschaft autoritär abdriftet, weil der Nährboden für Extreme und Radikale ständig neu gedüngt wird.
In dem Augenblick, in dem der Zusammenhalt stärker und die Gesellschaft gerechter wird, wächst auch die Akzeptanz für Veränderungen. Ein Gesellschaftsjahr, gekoppelt mit einem Erbe für alle, wäre eine Investition in die Resilienz dieser Gesellschaft und damit eine große Chance für einen friedlichen Weg in die Zukunft.
[1] Vgl. Yannik Haan, Für mehr Gleichheit: Grunderbe für alle!, in: „Blätter“ 1/2024, S. 115-123.