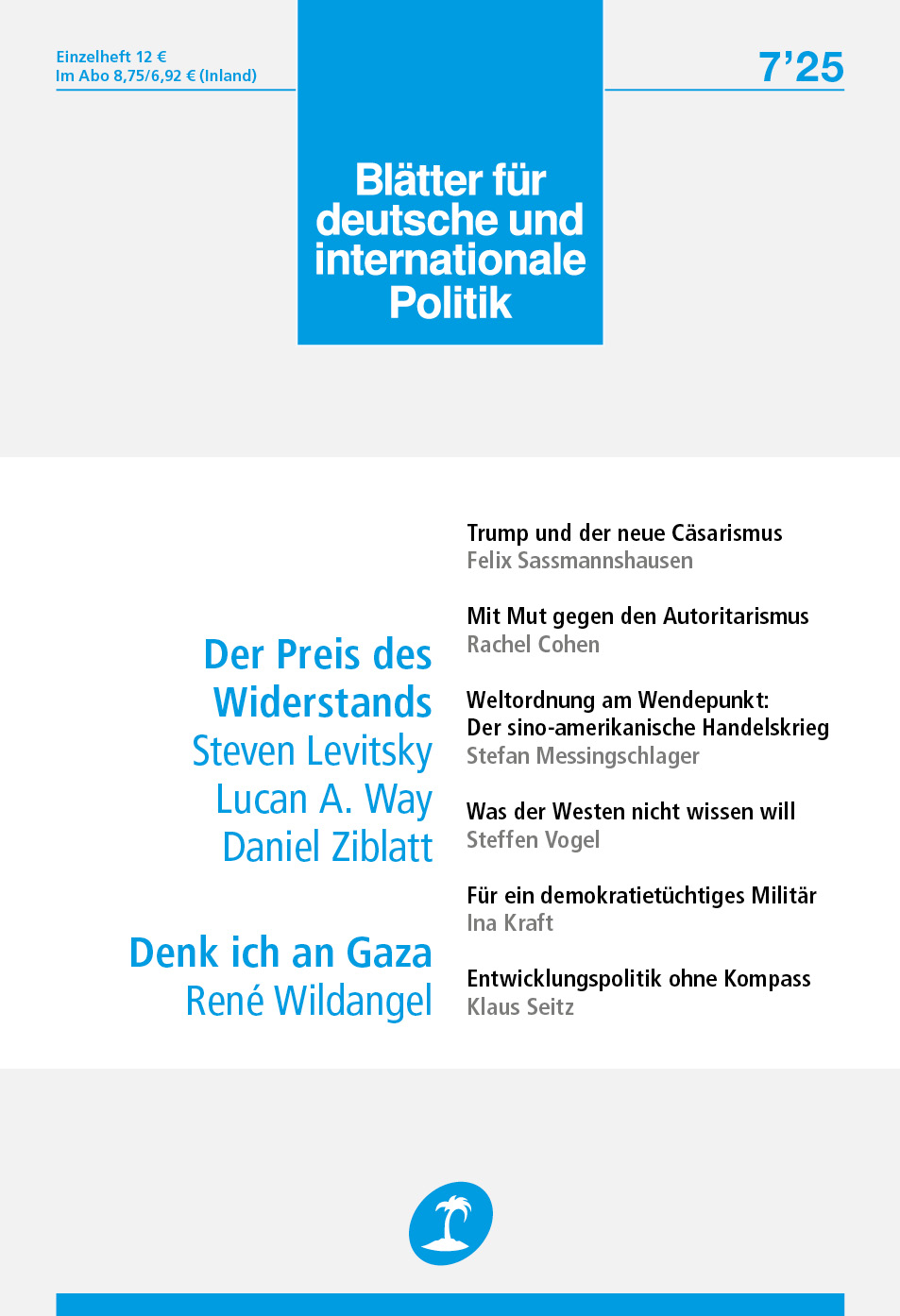Zur Lage der Groko-SPD und ihren Perspektiven

Bild: Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler, auf der Regierungsbank, 5.6.2025 (IMAGO / Political-Moments)
Spätestens seit Ralf Dahrendorfs berühmt gewordener These vom „Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“ gehören SPD-Niedergangsprognosen zu den Klassikern der parteibezogenen Publizistik. Die Partei hat diese Prognose bisher um 42 Jahre überlebt. Aber das konstituiert keine Ewigkeitsgarantie, wie sich an sozialdemokratischen Parteien in anderen europäischen Ländern sehen lässt. Tatsächlich war die Lage lange nicht mehr so dramatisch wie in diesen Tagen. Die SPD ist in einer umfassenden Defensive. Das bedeutet nicht nur, dass sie Wahlen verliert. Das tut sie auch, aber ihr Problem ist größer als das. Das Wahlergebnis der Partei bei der Bundestagswahl 2025 ist dabei nur ein Indikator. Mit 16,4 Prozent war das Abschneiden der SPD so schlecht wie seit 1887 nicht mehr. Sieht man von der Europawahl 2024 ab, hat bei keiner deutschlandweiten Wahl ein geringerer Anteil der Wahlberechtigten für die SPD gestimmt.
Viel schwerer zu quantifizieren, aber mindestens ebenso gravierend: Auch die Diskursmacht und die programmatische Strahlkraft der SPD haben erheblich gelitten. Mit welchen Themen sie in der öffentlichen Debatte präsent ist, wie und wo sie Menschen erreicht, ist unklar. Und das ist auch kein Wunder, denn wofür die SPD im Kern steht, an wessen Seite sie kämpft und welche Ziele sie dabei verfolgt, das scheint ihr selbst nicht mehr klar zu sein.
Was aber sind die zentralen Aufgabenfelder, die die SPD bearbeiten muss, um in Gesellschaft und Politik wieder eine prägendere Rolle zu spielen? Welche und wessen Interessen sollte die SPD vertreten, welche Bedeutung haben dabei programmatische Klärungen – und wie kann sie all das in eine stimmige Erzählung übersetzen? Bei der Beantwortung dieser zentralen Fragen versuchen wir im Folgenden, eine praxisorientierte Perspektive mit den Erkenntnissen der Parteien- und Demokratieforschung zu verbinden.
Die Lage der SPD ist dadurch gekennzeichnet, dass sie einerseits an der Regierung beteiligt ist und den Vizekanzler stellt, aber andererseits unklar ist, wen sie dabei im Blick hat. So richtig und notwendig eine Regierungsbeteiligung der SPD auch ist, sie wird die Partei nicht aus ihrem Abwärtstrend befreien. Die Unklarheit darüber, für was und für wen die SPD eigentlich steht, wird nicht allein durch Regierungshandeln überwunden. Das ist ihr nicht einmal gelungen, als sie den Kanzler gestellt hat, und es wird ihr noch weniger gelingen, wenn sie Juniorpartner in einer Regierung Merz ist. Im Gegenteil: Die vereinnahmende Regierungsarbeit birgt immer die Gefahr, dass die handlungspraktischen und intellektuellen Kapazitäten der Parteispitze voll darauf konzentriert sind und die grundsätzlichen und tiefgreifenden Fragen zur Erneuerung der SPD bestenfalls nachgelagert bearbeitet werden. Dabei muss die SPD den Mut haben, sich grundsätzlichen Fragen zu stellen und sie in einem genuin sozialdemokratischen Sinne zu beantworten. Nicht gegen die Regierung, sondern als deren funktionaler Teil, aber mit genügend Freiheit von der Regierungslogik. Da es hierbei weniger um tagespolitische Fragen als vielmehr um grundsätzliche mit einem weit über die Legislaturperiode hinausgehenden Zeithorizont geht, ist das möglich – vorausgesetzt, die Sozialdemokrat:innen in der Regierung sind bereit, gewisse Spannungen auszuhalten.
»Wann wir schreiten Seit‘ an Seit‘« – aber für was, für wen und mit wem?
Die SPD muss sich die Frage stellen, für was und für wen sie steht. Dabei kann die Analyse nicht mit demoskopischen Erkenntnissen beginnen. Ein Schielen auf Zielgruppen im „Wählermarkt” würde den Prozess der inhaltlichen Entleerung noch befördern. Es muss vielmehr um Alleinstellungsmerkmale der Sozialdemokratie gehen, um einen Identitätskern, der glaubwürdig mit der Partei verbunden ist und auf dem ihre Politik künftig aufbaut. Um diesen Identitätskern zu definieren, muss die SPD sich ihre 162-jährige Geschichte vergegenwärtigen, muss sie herausarbeiten, was sie in dieser Zeit ausgemacht hat, und dies dann in die heutige Zeit übersetzen.
Da ist zunächst die Arbeiterpartei, die sie in den Anfängen auch im Namen trug. Zwar haben sich die Arbeiterschaft und ihre Lebenslagen immer wieder stark verändert, aber dennoch verdient auch heute der Großteil der Bevölkerung seinen Lebensunterhalt mit Erwerbsarbeit oder dem damit erarbeiteten Ruhestand. Die SPD als Partei der Arbeitenden zu betrachten, ist daher weiterhin richtig, auch wenn sich die Arbeitswelt und die Lebenswelten der Arbeitenden ausdifferenziert haben. Denn es gibt weiterhin gemeinsame Interessen der Arbeitenden. Gleichzeitig muss die Partei bei trennenden, häufig „kulturell“ konnotierten Unterschieden Brücken bauen, auch zwischen Arbeitenden und jenen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht arbeiten können.
So ist für die einen vielleicht die Bezahlbarkeit von Wohnraum besonders wichtig, für die anderen die Notwendigkeit und der Wunsch, auch in Zukunft ein eigenes Auto zu besitzen. Aber beiden werden ihre jeweiligen Prioritäten durch Klimaschutzmaßnahmen – die im Grundsatz breit unterstützt werden –, erschwert oder zumindest verteuert. Eine sozialdemokratische Politik, die einerseits durch gute Tarifverträge die Einkommenssituation abhängig Beschäftigter verbessert und andererseits Klimaschutzmaßnahmen bei Wohnen und Verkehr finanziell fördert, kann hier beide Gruppen erreichen, solange die Politik die Wahl des Verkehrsmittels nicht zu einer Frage des moralisch Falschen oder Richtigen macht.
Ein zweiter Kern der Sozialdemokratie ist selbstverständlich das „Soziale“. Aber, und das ist einigen Sozialdemokrat:innen in Debatten über „most vulnerable groups“ vielleicht abhandengekommen, es wurde nie karitativ verstanden, sondern ursprünglich als Solidarsystem der und für die Arbeitenden. Es ging und geht also nicht primär darum, einer äußeren Gruppe etwas Gutes zu tun, aber eben auch nicht um eine Abwertung solcher Gruppen, sondern vielmehr darum, Risiken kollektiv abzusichern, die jeden treffen können. Und es geht nicht zuletzt um eine gerechtere Verteilung zwischen Kapital und Arbeit, die ebenfalls nur kollektiv zu erkämpfen ist. Dies schließt nicht aus, in der heutigen Welt Solidarität über die eigene „Klasse“ und auch die eigenen Grenzen hinaus zu erweitern und Gerechtigkeit in einem umfassenderen Sinn einzufordern. Schon das Eisenacher Programm von 1869 brachte es wie folgt auf den Punkt: „Der Kampf für die Befreiung der arbeitenden Klassen ist nicht ein Kampf für Klassenprivilegien und Vorrechte, sondern für gleiche Rechte und Pflichten und für die Abschaffung aller Klassenherrschaft.“
Schließlich zählt drittens die Demokratie zum Wesenskern der Sozialdemokratie. Keine andere Partei in der deutschen Geschichte hat sich so sehr für die Demokratie eingesetzt und sie so vehement verteidigt. Dabei ging es ihr sowohl um die Demokratie als politisches System als auch um die Demokratisierung von Wirtschaft und Arbeit – weil die Arbeitenden sich emanzipieren und selbst auf die politischen Verhältnisse einwirken wollen, aber dies nur in einer – hier politischen – Solidargemeinschaft Aussicht auf Erfolg hat.
Das sozialdemokratische Verständnis der Trias Demokratie, Solidarität und Gerechtigkeit ist also von Beginn an eng mit ihrem Eintreten für alle Arbeitenden verbunden. Dies müsste auch der Kern ihrer zukünftigen Ausrichtung sein, der sie von anderen Parteien unterscheidet. Sie begreift damit Demokratie nicht nur als Prinzip von Mehrheitsentscheidungen, sondern als ein umfassendes Set von Regeln und Verhaltensmustern, das sich auf alle Bereiche des menschlichen Zusammenlebens erstreckt. Wenn in dieser Richtung definiert wird, wofür und für wen die SPD eintritt, dann wird damit auch die Frage beantwortet, gegen wen sich ihre Politik richten muss. Nicht im Sinne von kompromissloser Gegnerschaft, sondern im kompromissorientierten Wissen um die Interessen, die man vertritt. Einen guten Kompromiss kann nur erreichen, wer die eigenen Forderungen klar definiert. Wenn die SPD wieder die Partei der Arbeitenden sein will, muss sie gerade in Zeiten sich verschärfender Verteilungsfragen konfliktfähig gegenüber Unternehmen und Vermögenden sein. Denn es gibt weiterhin gemeinsame Interessen der Arbeitenden: bessere Bezahlung, mehr Rechte am Arbeitsplatz, eine gerechtere Vermögensverteilung und öffentliche Ausgaben, etwa für einen sozial ausbuchstabierten Klimaschutz. All diese Anliegen werden aber nicht ohne Verteilungskonflikte zu erreichen sein. Doch genau daran krankt es. Völlig zu Recht konstatieren Wolfgang Schroeder und Richard Meng „seit langem eine Umsetzungsschwäche im Zentrum progressiver Politikkonzepte“.[1] Um alle Arbeitenden, also alle, die auf abhängige Beschäftigung angewiesen sind, in all ihrer Vielfalt anzusprechen und zu repräsentieren, bedarf es einer glaubwürdigen politischen Erzählung. Der jüngste Bundestagswahlkampf und speziell die „Duelle“ zwischen dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz haben eindrucksvoll gezeigt, welche Bedeutung Narrative in der Politik haben – und wie fatal das Fehlen einer eigenen Erzählung ist.
Beim Bürgergeldbezug plädierte der Kanzler für „harte Sanktionen“ für Leistungsempfänger, die vorsätzlich bezahlte Arbeit verweigern würden. Er schlug in diesem Zusammenhang auch vor, diese in „öffentlich geförderte Jobs“ zu schicken, nicht zuletzt um nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um Verweigerer handelt, wenn sie diese Jobs nicht anträten – und sie dann sanktionieren zu können. Scholz griff damit ein narratives Versatzstück aus dem angelsächsischen Liberalismus auf. Als die sozialen Verwerfungen der Industrialisierung im England des 19. Jahrhunderts deutlich wurden, entwickelte sich dort ein ausgeprägtes philanthropisches Engagement. Kernelement dieser Tradition informaler, nichtstaatlicher Wohlfahrtsstrukturen war die Differenzierung nach deserving sowie undeserving poor – die einen „verdienen“ Unterstützung, die anderen nicht.[2]
Die Arbeiterbewegung setzte dieser paternalistischen Armenfürsorge ein Verständnis von Wohlfahrtsstaatlichkeit entgegen, das auf die soziale und politische Integration aller durch solidarische Absicherung abzielt. Dieses universalistische Verständnis ist auch emotional aufgeladen, denn es beinhaltet ein reziprok gedachtes Versprechen: „Ich helfe denen, die es gerade nötig haben, auch weil ich mich darauf verlassen kann, dass mir geholfen wird, wenn ich es brauche.“
Auch in einem solchen solidarischen Ansatz haben Sanktionen durchaus eine Funktion: Wer die Solidarität missbraucht, wird zu Recht sanktioniert, denn die Leistungen werden ja – gerade in unserem Steuersystem – überwiegend von Erwerbstätigen finanziert. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass die nicht individuell verschuldete Notlage als der – moralisch unproblematische – Normalfall angesehen wird und der Missbrauch als die Ausnahme. Diese Auffassung entspricht auch der Realität, wie die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit belegen.[3] Mit dem Bürgergeld in Ablösung von „Hartz IV“ hat die SPD versucht, dies klarzustellen. Allerdings schoss die Rhetorik teilweise übers Ziel hinaus. Und mit der Forderung nach „Abschaffung aller Sanktionen“, fast im Sinne eines „bedingungslosen Grundeinkommens“, wurde der eigentlich angestrebte Solidargedanke sofort wieder infrage gestellt. Mit der ironischen Folge, dass die SPD wieder nicht zu einer konsistenten Sozialstaatserzählung gefunden hat, sondern im Wahlkampf 2025 auf die Erzählung der „Neuen Mitte“ der Schröder-Jahre zurückgefallen ist, einschließlich der Vermutung, dass Bürgergeldempfänger:innen an ihrer Lage überwiegend selbst schuld seien.
Hinsichtlich der Migration war der Wahlkampf insgesamt von den Narrativen der extremen Rechten geprägt. Diese hat auch in Deutschland erfolgreich die Erzählung aufgebaut, dass Zuwanderung das zentrale Problem sei und die deutsche Identität, den Wohlstand und die Sicherheit gefährde. Horst Seehofers fataler Satz „Migration ist die Mutter aller Probleme“ bedeutete faktisch die Kapitulation der CSU vor diesem Narrativ.
Auch wenn die SPD sich diese Aussage nie zu eigen gemacht hat, erweckte doch der Fokus auf Abschiebungen den Eindruck, Migration sei gleichzusetzen mit „illegaler Migration“. Nicht zuletzt der Kanzler präsentierte sich als derjenige, der besonders entschlossen Abschiebungen forcierte. Bereits seit dem „Spiegel“-Titel aus dem Oktober 2023 „Wir müssen endlich in großem Stil abschieben“ war diese Selbststilisierung Teil seiner Rhetorik, während der Schutz vor Verfolgung kaum Erwähnung fand.
Dabei ist ein sozialdemokratisches Narrativ in der Fluchtfrage auf Grundlage des Solidargedankens durchaus möglich: „Wir sind solidarisch mit Schutzsuchenden und unterstützen sie in einer Form, die unsere Gesellschaft leisten kann. Aber auch hier gilt: Wer das solidarische System missbraucht, verliert seine Unterstützung.“
Die Reduktion aller Problemlagen auf Migration ist dagegen nur ein Geschenk für die extreme Rechte. Eine eigenständige Positionierung ist dann, das hat der jüngste Wahlkampf gezeigt, kaum mehr möglich.
Es braucht ein taugliches sozialdemokratisches Narrativ
Angesichts dieser Wirkmächtigkeit von (rechten) Narrativen wird deutlich, dass sich die SPD der Mühe unterziehen muss, ein eigenes Narrativ zu den Fragen unserer Zeit zu entwickeln – basierend auf der Festlegung, wofür und für wen sie steht. Sie braucht eine Erzählung, die die Gegenwart deutet und ihre Herausforderungen erklärt.
Ein taugliches Narrativ weist über den Tag hinaus. In ihm drückt sich die Identität einer politischen Bewegung aus. Es muss auf den eigenen Wertvorstellungen basieren, daraus Ziele und Maßnahmen ableiten – und diese in Gegensatz zur Politik anderer Akteure stellen. Dadurch wird es breit innerhalb und außerhalb einer politischen Bewegung geteilt.
Ein Narrativ knüpft an die Lebensrealität der Menschen an, muss emotional aufgeladen und dadurch mobilisierend sein. Johannes Hillje hat zu Recht unter anderem in dieser Zeitschrift darauf hingewiesen, dass politische Prozesse nicht nur sachrational, sondern auch und weit stärker emotional geprägt sind, denn Affekte vermitteln sich schneller und eindrucksvoller als Argumente.[4]
Die neoliberale Vorstellung, dass in Gesellschaften alles in Form von Märkten organisiert werden muss, die angstprovozierende Erzählung, dass Migration das Problem sei, die faktenfreie Erzählung, dass das beste Politikmodell in nationaler Abschottung und der Aufkündigung internationaler Kooperation liege – all diese Narrative haben in erheblichem Umfang die politischen Kräfteverhältnisse verschoben. Wenn es der Sozialdemokratie nicht gelingt, ein eigenes, klar mit ihr verbundenes Narrativ zu entwickeln, es zu emotionalisieren und auch in schwierigen tagespolitischen Debatten durchzuhalten, wird es ihr auch nicht gelingen, die Kräfteverhältnisse wieder zu ihren Gunsten zu verändern.
Genuin sozialdemokratisch
Wer aber in diesen Zeiten aufgeladener und einflussreicher Narrative nach einer genuin sozialdemokratischen Erzählung sucht, muss weit zurückgreifen.[5] Bis in die 1980er Jahre hinein gab es noch eine starke und für das Leben von vielen Menschen sehr folgenreiche Erzählung. Sie war im Kern sehr schlicht: Alle Menschen haben ein Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben und die dafür notwendigen, auch materiellen, Grundlagen. Ein Leben ohne Angst und Zwang war das Versprechen, mit gesichertem Wohlstand und der Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, für das gesellschaftlich die wesentlichen Gelingensbedingungen geschaffen werden müssen. Die Sozialdemokratie stellte damals auch die zur Finanzierung notwendigen Verteilungsfragen und forderte deshalb beispielsweise progressive Steuern und Vermögensabgaben. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts finden sich Variationen dieses Kerngedankens in allen programmatischen Dokumenten der Sozialdemokratie.[6] Und auch der erfolgreiche Scholz-Wahlkampf der SPD 2021 knüpfte an diesen Gedanken an mit dem zentralen Motiv des „Respekts“, der jedem und jeder gleichermaßen zustehe.
Wie aber könnte nun eine künftige Erzählung der SPD aussehen? Ein solches Narrativ zu entwickeln, kann auch dieser Artikel nicht leisten, aber drei zentrale Bausteine wollen wir an dieser Stelle liefern.
Erstens: In verteilungspolitischer Hinsicht geht es um eine zugespitzte Interessenvertretung. Diese beginnt mit dem Benennen von gegebenen Interessengegensätzen. Mieter und Eigentümer von Mietwohnungen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind nur zwei Beispiele für unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Interessen vertreten. In vergangenen Jahrzehnten hatten solche Interessengegensätze identitätsstiftende Wirkung und haben ganze Parteienlandschaften geprägt. Und auch heute wird die Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland – das belegen alle Umfragen zum Thema – als hochgradig ungerecht wahrgenommen. Zugleich ist diese politische Arena jedoch massiv entpolitisiert in dem Sinne, dass viele Menschen schlicht nicht (mehr) daran glauben, dass Politik bzw. kollektive Interessenvertretung einen Unterschied machen könne. Vom einstigen „Kampf der Klassen“ sei so die bloße „Konkurrenz der Individuen“ geblieben.[7] Hier liegt ein erhebliches Mobilisierungspotential der SPD brach. Wenn sie mit klarer Sprache Ungerechtigkeiten benennt und Handlungsinstrumente aufzeigt und dort, wo sie in Verantwortung ist, auch anwendet, kann sie neue Glaubwürdigkeit in den sich zuspitzenden Verteilungskonflikten gewinnen. Dabei geht es um die Steigerung von Erwerbseinkommen (auch im Gegensatz zu Kapitalbezügen), aber vor allem um die Erneuerung des Aufstiegsversprechens, das ohne erhebliche öffentliche Ausgaben und deren gerechtere Finanzierung nicht zu gewährleisten sein wird.
Zweitens: In sozialpolitischer Hinsicht gelingt es der extremen und neoliberalen Rechten in der aktuellen Diskurslandschaft, die Interessen innerhalb einzelner Gruppen gegeneinander auszuspielen. Sie bedient sich dabei einer Abwertungsrhetorik, die die „hart arbeitenden Menschen“ gegenüber den angeblich Faulen implizit aufwertet, aber zugleich den Gedanken von gemeinsamen Interessen gegenüber den Reichen und Vermögenden völlig unterminiert.[8] Dabei könnte die Idee solidarischer Organisation gerade in Zeiten tiefsitzender Verunsicherung und Polykrisen ganz neue Kraft und Attraktivität entfalten. Wohlfahrtsstaatlichkeit schützt in diesem Sinne alle, weil sie nicht als Almosen für selbstverschuldetes Unvermögen verstanden wird, sondern als kollektive Absicherung, die jeden schützt, der darauf angewiesen ist. Damit kann der Erzählung des von außen, durch Migration erlittenen Kontrollverlustes, die immer wieder von der extremen Rechten bemüht wird, die selbstwirksame Kraft solidarischer Organisation entgegengesetzt werden.
Drittens: In gesellschaftspolitischer Hinsicht steht die SPD für eine freie Gesellschaft, in der unterschiedliche Lebensentwürfe und Identitäten ihren Raum finden. Historisch waren Fragen der gerechten Verteilung gesellschaftlicher Ressourcen immer mit Fragen von Anerkennung unterschiedlicher Identitäten verbunden. Das vielleicht prominenteste Beispiel dafür ist das Einfordern der Gleichberechtigung der Geschlechter. Auch damals gab es schon eine Debatte, ob es „Haupt- und Nebenwidersprüche im Kapitalismus“ gebe. Und auch heute ist der Blick auf sehr spezifische Diskriminierungsformen zwar analytisch sinnvoll, trägt aber auch zur Auflösung kollektiver Ansätze der Emanzipation bei. Eine moderne Sozialdemokratie muss daher so etwas wie „Kollektive der Vielfalt“ schaffen, die Verbindendes wie die Erwerbsabhängigkeit, aber auch das Recht auf universale Diskriminierungsfreiheit für den Zusammenhalt nutzen und auf dieser Grundlage spezifische Identitäten zulassen, ohne dass dies zu Spaltungen führt. So kann die Sozialdemokratie einen selbstbewusst-gelassenen Platz in den Kulturkämpfen unserer Zeit finden. Im Vordergrund muss dabei stets das Betonen von Gemeinsamkeiten und das Brückenbauen stehen, nicht die Polarisierung und das Spiel mit Wut und Abwertung.
Damit sind drei erste inhaltliche Eckpunkte benannt, die an die programmatische Tradition einer solidarischen Partei der Arbeit anschließen und diese auf eine neue Zeit beziehen. Natürlich bedarf es einer weiteren Ausarbeitung dieses Fundaments eines Narrativs, insbesondere hinsichtlich der Entwicklung erreichbarer und emotionalisierbarer Visionen einer sozialdemokratischen Zukunft. Einem neuen Grundsatzprogramm kann dabei eine wichtige identitätsstiftende Bedeutung zukommen.
Unmittelbar am Tag nach der verlorenen Bundestagswahl hat der SPD-Parteivorstand selbst eine „grundsatzpolitische Erneuerung“ beschlossen. So berechtigt diese Zielsetzung ist, muss sie, um die Partei nach vorne zu bringen, doch unbedingt mehr sein als eine intellektuelle Fingerübung. Es geht um nicht weniger als eine Neubestimmung, welche Rolle die SPD im Parteiensystem und in der Gesellschaft zukünftig spielen soll.
Dabei kann, richtig umgesetzt, eine Grundsatzprogrammdebatte als Instrument genutzt werden, um nach innen zu integrieren und nach außen das Profil zu schärfen und die eigene Anziehungskraft zu erhöhen. Die Debatte selbst und die damit verbundenen Klärungsprozesse sind dabei mindestens so wichtig wie das finale Papier. Neben den oben beschriebenen Fragen – für was und für wen steht die SPD? – muss es dabei auch darum gehen, welche Politikangebote in Zeiten der Polykrisen neue Sicherheit und Zuversicht vermitteln können. Wie kann ein universeller Anspruch auf individuelle Würde und Anteil am Wohlstand behauptet werden in einer Welt, in der die liberale Weltordnung mit ihren regelbasierten Institutionen wegbricht? Und wie können demokratische Öffentlichkeiten gegen demokratiefeindliche Kräfte unter dem Einfluss von Social Media geschützt werden?
Allein diese wenigen Stichworte machen deutlich, dass die Reformulierung einer Sozialdemokratie für das 21. Jahrhundert das Bohren dicker Bretter im Weberschen Sinne bedeutet. Sie benötigt Zeit, die glaubwürdige Aufmerksamkeit der Partei und ihrer Führung und eine breite Debatte, die dann in das gesamte progressive Lager ausstrahlen kann.[9] Mit den skizzierten Ansätzen würde sich die SPD aus eigener Stärke im Parteiensystem positionieren – in Abgrenzung zum autoritären Rechtspopulismus und -extremismus, aber auch von marktliberalen Narrativen. Sie würde auch ihre Rolle im progressiven Lager des Parteiensystems definieren, indem sie eine klare, auch auf die Primärverteilung abzielende Verteilungspolitik vertritt, beim Klimaschutz die soziale Dimension betont und bei kulturellen Fragen brückenbauend und selbstbewusst-gelassen auftritt. Auf diese Weise könnte sie die Hegemonie der rechten Diskurse herausfordern, Arbeitende als Wähler:innen zurückgewinnen und damit dazu beitragen, dass das progressive Lager wieder eine Machtperspektive erlangt. Gewiss keine kleine Aufgabe. Aber auch nicht hoffnungslos.
[1] Richard Meng und Wolfgang Schroeder, Nichts ist entschieden. Strategiefragen, die Progressive nicht wegschieben dürfen, in: „NGFH“, 6/2025, S. 8.
[2] Vgl. Christian Krell, Großbritannien. Nachzügler oder Vorreiter? In: Thomas Meyer (Hg.), Praxis der Sozialen Demokratie, Wiesbaden 2006, S. 135.
[3] Im Jahr 2023 wurden nur 2,6 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit mindestens einer Leistungsminderung belegt, Meldeversäumnisse machen dabei 84,5 Prozent aller Leistungsminderungen aus; siehe BfA, Presseinfo Nr. 15, arbeitsagentur.de, 10.4.2024.
[4] Vgl. Johannes Hille, Mit Emotionen gegen Populismus, in: „Blätter“, 4/2025, S. 119-124, sowie ders., Mehr Emotionen wagen: Wie wir Angst, Hoffnung und Wut nicht dem Populismus überlassen, München 2025.
[5] Hierzu auch: Gerhard Mielke und Fedor Rose, Absturz mit Ansage. Die SPD und die Bundestagswahl 2025, in: „Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit“, 2/2025, S. 102 ff.
[6] Christian Krell und Meik Woyke, Die Grundwerte der Sozialdemokratie. Historischer Ursprung und politische Bedeutung, in: Christian Krell und Tobias Mörschel (Hg.), Werte und Politik, Wiesbaden 2015, S. 93-139.
[7] Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser, Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft, Berlin 2024, S. 113.
[8] Interview mit Linus Westheuser, „Die SPD muss bereit sein, sich mit den ökonomischen Eliten anzulegen“, zeit.de, 23.5.2025.
[9] Hierzu Albrecht von Lucke, Groko ohne Alternative. Das Dilemma der Progressiven, in: „Blätter“, 6/2025, S. 5-8.