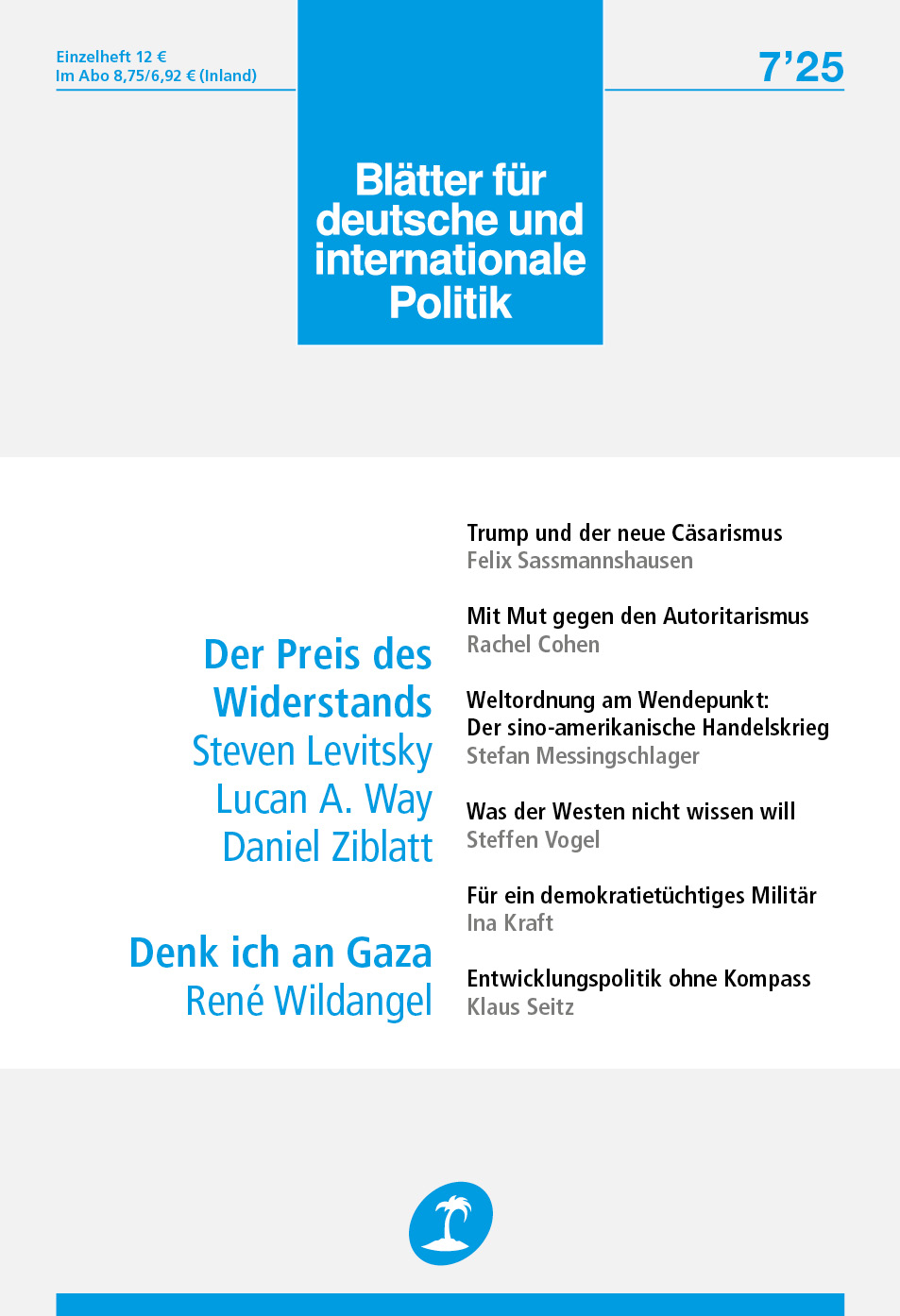Trump und der sino-amerikanische Handelskrieg

Bild: Ein Containerschiff läuft aus dem Hafen im chinesischen Qingdao aus. Er gehört zu den zehn verkehrsreichsten Häfen der Welt und spielt eine zentrale Rolle im internationalen Handel, 9.3.2025 (IMAGO / Avalon.red)
Als Donald Trump am 2. April überraschend den „Liberation Day“ ausrief und drastische Strafzölle gegen China sowie zahlreiche weitere Handelspartner verhängte, traten die sino-amerikanischen Beziehungen in eine gefährliche Eskalationsspirale ein. Begleitet von martialischer Rhetorik und einer bewussten Missachtung multilateraler Institutionen und Regeln, markierte Trumps Schritt den neuen Kulminationspunkt jener erratischen, transaktionalen Außenpolitik, die bereits seine erste Amtszeit geprägt hatte.[1] Umso bemerkenswerter erschien die abrupte diplomatische Kehrtwende wenige Wochen später, als Unterhändler beider Seiten am 12. Mai in Genf überraschend eine substanzielle Reduktion der zuvor verhängten Strafzölle vereinbarten. Diese Episode lediglich als Ausdruck des vielzitierten „Neuen Kalten Krieges“[2] zu interpretieren, würde jedoch ihre eigentliche Tragweite verfehlen: Es handelt sich um eine Zäsur. Zielführender erscheint es daher, den Handelskrieg von 2025 als Kristallisationspunkt zu begreifen, dessen Hintergründe, Dynamik und Konsequenzen instruktive Rückschlüsse sowohl auf Gegenwart und Zukunft der sino-amerikanischen Beziehungen als auch der regelbasierten internationalen Ordnung ermöglichen.
Zölle und Gegenzölle
Nachdem Donald Trump zu Jahresbeginn zunächst versöhnliche Signale in Richtung Peking ausgesandt hatte, sorgte er am 2. April unerwartet für einen politischen Paukenschlag: Am von ihm proklamierten „Liberation Day“, dem Tag der „Befreiung“ von der angeblichen Ausbeutung der USA durch ihre Handelspartner, kündigte der US-Präsident zunächst umfassende Strafzölle auf zahlreiche chinesische Importgüter an – darunter Elektronikkomponenten, Halbleiter sowie industrielle Vorprodukte. Innerhalb weniger Tage erhöhte Washington diese Zölle schrittweise auf ein Niveau von bis zu 145 Prozent; begleitet wurde die sukzessive Eskalation vom Vorwurf „unfairer Handelspraktiken“. Ziel der Trump-Regierung war es, Chinas Führung wirtschaftlich massiv unter Druck zu setzen, um langfristig insbesondere eine Verringerung des bilateralen Handelsdefizits sowie den Abbau chinesischer Subventionen zu erzwingen.[3]
Pekings Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Ebenfalls binnen weniger Tage konterte China mit zielgenauen Gegenzöllen auf strategisch bedeutsame US-Exportprodukte wie Sojabohnen, Flüssiggas und Flugzeugkomponenten – Güter, deren Produktion insbesondere in den Schlüsselstaaten des amerikanischen Mittleren Westens konzentriert ist, wodurch gezielt politischer Druck auf Washington erzeugt wurde.[4] Noch folgenreicher aber war die Entscheidung der chinesischen Regierung, den Export kritischer Rohstoffe – allen voran sogenannter Seltener Erden – drastisch einzuschränken.[5] Da US-Hightechkonzerne sowie Unternehmen des Verteidigungssektors rund 80 Prozent ihres Bedarfs an diesen für die Halbleiterproduktion essenziellen Materialien aus chinesischen Quellen beziehen, kam es binnen kurzer Zeit zu gravierenden Produktionsengpässen. Betroffen waren dabei nicht nur prominente Branchenführer wie Intel oder Lockheed Martin, sondern nahezu die gesamte US-Technologie- und Elektronikindustrie, die durch Lieferstopps und Produktionsunterbrechungen empfindlich getroffen wurde. Eindrucksvoll wurde damit offengelegt, wie fragil und abhängig die technologische Basis der US-Volkswirtschaft trotz jahrelanger Bemühungen um eine strategische Entkopplung weiterhin ist.
Flankierend zu diesen wirtschaftlichen Vergeltungsmaßnahmen initiierte die chinesische Führung eine intensive Mobilisierung: Staatliche Medien inszenierten die Konfrontation mit den Vereinigten Staaten als existenziellen Kampf gegen ausländische Aggression, wobei Präsident Xi Jinping die US-amerikanischen Strafzölle öffentlich als „Mobbing“ brandmarkte. In den chinesischen sozialen Netzwerken kursierten nationalistische Parolen sowie satirische Darstellungen von Trump, die die Entschlossenheit Pekings sowie den Stolz und die Widerstandskraft der Nation betonten. Diese gezielte Propaganda diente dabei nicht allein der Mobilisierung und Stärkung öffentlicher Unterstützung, sondern lenkte zugleich effektiv von den wirtschaftlichen Belastungen ab, die der Handelskrieg unweigerlich mit sich brachte.
Die globale Dimension des Konflikts zeigte sich unmittelbar in massiven Störungen der transpazifischen Lieferketten sowie dramatischen Kursverlusten von bis zu 15 Prozent an den Börsen in New York und Shanghai. Führende US-Wirtschaftsverbände, darunter die U.S. Chamber of Commerce und die National Association of Manufacturers, appellierten eindringlich an das Weiße Haus, die Eskalationsspirale zu stoppen, und warnten öffentlich vor einer drohenden Rezession mit weitreichenden Folgen für die US-Mittelschicht. Vor diesem Hintergrund kam es am 12. Mai in Genf überraschend zu einer improvisiert einberufenen Krisenkonferenz, die sich als Wendepunkt im Handelskonflikt herausstellten sollte. Nach schwierigen Verhandlungen einigten sich die Delegationen schließlich auf eine vorläufige beidseitige Aussetzung der verhängten Zölle für zunächst 90 Tage.[6] Trump bemühte sich zwar anschließend, diese rasche Deeskalation als außenpolitischen Erfolg darzustellen, doch faktisch trat in Genf das Scheitern seiner Strategie maximalen wirtschaftlichen Drucks offen zutage: Keine der ursprünglichen Kernforderungen Washingtons – weder die deutliche Reduktion des chinesischen Handelsüberschusses noch das Ende staatlicher Subventionen – wurde erfüllt.
Die Grenzen des Trumpschen Transaktionalismus
Die vorläufig gestoppte Eskalation im sino-amerikanischen Handelskonflikt verdeutlicht eindrucksvoll die Grenzen von Trumps transaktionaler Außenpolitik. Darunter ist seine charakteristische Methode zu verstehen, internationale Beziehungen primär nach kurzfristigen Kosten-Nutzen-Kalkülen auszurichten. Im Mittelpunkt stehen bilaterale „Deals“, bei denen unmittelbare Gegenleistungen und öffentlichkeitswirksame Erfolge stärker gewichtet werden als langfristige strategische Ziele, universelle Normen oder verbindliche multilaterale Vereinbarungen.[7] Genau diese kurzfristig orientierte Strategie – China durch maximalen wirtschaftlichen Druck zum (handels-)politischen Einlenken zu zwingen – scheiterte im Frühjahr 2025 an der komplexen Realität der sino-amerikanischen Wirtschaftsverflechtungen. So erzwangen eindringliche Warnungen republikanischer Senatoren sowie der US-Wirtschaft innerhalb weniger Wochen eine strategische Kehrtwende des Weißen Hauses. Neben den Auswirkungen der US-Importzölle, die insbesondere bei Konsumgütern zu erheblichen Preisanstiegen führten, waren es vor allem Pekings gezielte Exportbeschränkungen bei Seltenen Erden, die die Trump-Administration handelspolitisch in die Knie zwangen.[8] Sie machten die strukturelle Abhängigkeit und Verwundbarkeit der US-Technologie- und Verteidigungsindustrie unübersehbar deutlich.
Diese Maßnahmen Pekings waren kein spontaner Schachzug, sondern Ergebnis einer konsequenten und langfristigen wirtschaftspolitischen Planung, die insbesondere seit 2019 unter dem Schlagwort „Dual Circulation Strategy“ verfolgt wurde.[9] Chinas Ziel, Abhängigkeiten von westlichen Märkten abzubauen, strategische Monopole zu etablieren und wirtschaftliche Alternativen in Südostasien, Afrika und Zentralasien zu erschließen, erwies sich in dieser Krise als äußerst vorausschauend. Die Ereignisse des Frühjahrs 2025 dürften von Peking als Bestätigung des eingeschlagenen Kurses interpretiert worden sein.
Gleichwohl entfaltet die tiefe ökonomische Interdependenz zwischen beiden Staaten kurzfristig weiterhin eine stabilisierende und deeskalierende Wirkung. Beide Seiten sahen sich gezwungen, rasch an den Verhandlungstisch zurückzukehren – eine Erfahrung, die langfristig allerdings die Einsicht verstärken dürfte, bestehende gegenseitige Abhängigkeiten noch entschiedener zu reduzieren. Mittelfristig wird dies voraussichtlich zu einer beschleunigten Entkopplung in strategisch sensiblen Sektoren führen. Washington intensiviert bereits Maßnahmen wie Exportrestriktionen gegenüber chinesischen Technologiekonzernen wie Huawei und ZTE sowie verschärfte Investitionsprüfungen durch das Committee on Foreign Investment in the United States. Parallel dazu verstärkt es seine industriepolitische Unterstützung für kritische Sektoren wie Halbleiterproduktion, Künstliche Intelligenz und Rohstoffmanagement, um strategische Autonomie zu erreichen.[10]
Für China wiederum dürfte die vorläufig erfolgreiche Bewältigung der aktuellen Krise als entscheidender Lackmustest gedient haben, inwieweit es geoökonomischem Druck standhalten kann. Die dadurch gewonnene Selbstsicherheit könnte die chinesische Führung unter Xi Jinping dazu verleiten, künftig risikoreichere geopolitische Eskalationen ernsthaft in Erwägung zu ziehen – einschließlich hybrider oder gar militärischer Operationen rund um Taiwan.[11] Schließlich betrachtet Peking die staatliche Integration Taiwans als erklärtes „Kerninteresse“. Hinzu kommt, dass Xi Jinping im Jahr 2027 zum 100. Jubiläum der Gründung der Volksbefreiungsarmee vor der innenpolitischen Herausforderung stehen wird, sichtbare Erfolge präsentieren zu müssen. Taiwan böte dafür ein symbolträchtiges und prestigereiches Ziel.[12]
Verstärkend wirkt in diesem Kontext die spezifische politische Logik Donald Trumps: Gerade dessen transaktionaler Ansatz könnte Xi Jinping zu der Überlegung verleiten, dass Trump ökonomische Konzessionen vonseiten Chinas – etwa deutliche Maßnahmen zur Reduktion des amerikanischen Handelsdefizits – möglicherweise gegen eine faktische Anerkennung des chinesischen Anspruchs auf Taiwan eintauschen würde. Dieses Szenario einer Akzeptanz der chinesischen Integration Taiwans im Rahmen eines bilateralen „Deals“ könnte aus Pekings Sicht ausgesprochen verführerisch erscheinen. Für die Trump-Administration würde ein solcher „Deal“ jedoch enorme geopolitische Risiken bergen. Sollte Trump tatsächlich erwägen, im Rahmen eines „Deals“ eine faktische Integration Taiwans durch China zu akzeptieren, hätte dies weitreichende Konsequenzen für das gesamte US-amerikanische Bündnissystem in Ostasien, allen voran für die Beziehungen zu Japan, Südkorea und Australien. Die geopolitischen Spannungen im Indopazifik würden dramatisch ansteigen, und Trump könnte innen- wie außenpolitisch massiv unter Druck geraten, was letztlich die Stabilität der gesamten Region bedrohen würde.
Auf dem Weg zu einem neuen Jalta?
Der sino-amerikanische Handelskrieg dieses Frühjahrs offenbart vor diesem Hintergrund nicht nur die wachsenden bilateralen Spannungen zwischen den beiden Großmächten und das Scheitern von Trumps transaktionaler Außenpolitik. Er kündigt vielmehr auch eine erheblich volatilere geopolitische Realität an – mit weitreichenden und unkalkulierbaren Konsequenzen, die weit über die sino-amerikanischen Beziehungen hinausreichen. Die demonstrative Nonchalance, mit der die Trump-Regierung diesen Konflikt eskalierte, erscheint dabei symptomatisch für eine bereits fortgeschrittene Erosion der regelbasierten Weltordnung.
Die transaktionale Logik Trumps erweist sich in diesem Kontext als Ausdruck einer tiefer liegenden Entwicklung: Die multilaterale Ordnung wurde schon vor seinem Amtsantritt zunehmend durch eine machtpolitische Praxis ersetzt, die kurzfristige bilaterale Abkommen universellen Normen vorzieht. Insofern sind Trumps spektakuläre Inszenierung des „Liberation Day“ und seine bewusste Missachtung fundamentaler WTO-Regeln keine isolierte Episode. Vielmehr markieren sie eine strategische Verschiebung, deren Ursprünge schon in Trumps erster Amtszeit zu erkennen waren. Bereits damals begann Washington, zentrale Funktionen der WTO gezielt lahmzulegen, was einer tief verwurzelten Skepsis gegenüber universellen Regeln und einer Präferenz für bilaterale Vereinbarungen entsprach.[13]
China verfolgt hingegen eine subtilere, doch nicht minder problematische Strategie: Zwar bekennt sich Peking stets öffentlich zu Multilateralismus und internationaler Kooperation, nutzt internationale Organisationen jedoch zunehmend gezielt zur Durchsetzung eigener ökonomischer und geopolitischer Interessen. Besonders deutlich zeigt sich dies in Initiativen wie der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) oder der Belt-and-Road-Initiative (BRI), auch bekannt als Neue Seidenstraße: Während die AIIB offen als Alternative zu etablierten Institutionen wie der Weltbank oder dem Internationalem Währungsfonds (IWF) fungiert, schafft die BRI durch Kredite und Infrastrukturprojekte Abhängigkeitsverhältnisse und alternative Governancestrukturen, die etablierte Standards bezüglich Transparenz, Nachhaltigkeit und finanzieller Verantwortung schleichend unterwandern.[14]
Die doppelte Erosion multilateraler Institutionen durch die USA und China sowie die parallele Stärkung alternativer Strukturen verdeutlichen damit einen weiter reichenden geopolitischen Trend: Die internationalen Beziehungen fragmentieren sich zunehmend, universelle Normen treten zugunsten informeller Einflusssphären und machtpolitischer Interessen in den Hintergrund. Bereits heute zeichnet sich dieser Prozess in wichtigen geopolitischen Konfliktfeldern klar ab: Ob in Washingtons zunehmend machtbasierter Haltung gegenüber Russland oder Pekings expansiver Territorialpolitik im Südchinesischen Meer – machtpolitische Interessen verdrängen mehr und mehr etablierte völkerrechtliche Grundsätze, Mechanismen und Institutionen.[15]
Die Folgen dieser Erosion könnten langfristig gravierend sein. Ein neues geopolitisches Ordnungsprinzip nach dem Muster eines „Jalta 2.0“, geprägt durch Einflusssphären und informelle Großmachtabsprachen, würde insbesondere kleinere und mittlere Staaten existenziell treffen.[16] Diese Staaten drohen zu bloßen Verhandlungsobjekten zu werden, deren politische Autonomie und Handlungsfreiheit geopfert werden könnten, um Stabilität innerhalb der Einflusszonen sicherzustellen. Zugleich würde ein solches Szenario die internationale Handlungsfähigkeit bei der Bewältigung globaler Herausforderungen – seien es Klimawandel, Pandemien oder nukleare Proliferation – erheblich beeinträchtigen, da notwendige Kooperation zwischen rivalisierenden Machtblöcken erschwert oder gar unmöglich würde.
Vor diesem Hintergrund steht Europa vor einer grundlegenden Weichenstellung. Als traditioneller Verfechter regelbasierter Kooperation gerät die EU angesichts des US-amerikanischen Unilateralismus und des chinesischen strategischen Revisionismus zunehmend unter Druck. Die Krise von 2025 macht deutlich, dass es nicht ausreichen wird, sich bloß defensiv auf die Bewahrung des bestehenden multilateralen Rahmens zu konzentrieren. Vielmehr muss die EU konsequent ihre strategische Autonomie stärken und zugleich aktiver und selbstbewusster an der Verteidigung und Weiterentwicklung multilateraler Strukturen mitwirken. Sollte dies nicht gelingen, droht Europa zwischen den konkurrierenden geopolitischen Machtzentren USA und China dauerhaft marginalisiert und handlungsunfähig zu werden.[17]
Der sino-amerikanische Handelskrieg dieses Jahres war und ist weit mehr als nur eine temporäre ökonomische Krise oder ein weiteres Kapitel in der konfliktreichen Beziehung zwischen den USA und China. Er fungiert vielmehr als ein Kristallisationspunkt jener strukturellen Spannungen und strategischen Risiken, die die gegenwärtige geopolitische Dynamik prägen und langfristig vertiefen könnten. Dabei hat die Krise mehrere entscheidende Einsichten offengelegt: Erstens offenbart der Handelskonflikt dramatisch die Grenzen und Gefahren der Trumpschen transaktionalen Außenpolitik. Die Annahme, handelspolitische Konflikte oder gar geopolitische Rivalitäten durch massiven wirtschaftlichen Druck lösen zu können, erwies sich als strategische Fehleinschätzung, die letztlich sogar gegenteilige Effekte erzielte. Statt Chinas politische Positionen aufzubrechen, führte Trumps Eskalation rasch zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden für die USA und zwang Washington zu einer abrupten diplomatischen Umkehr.
Zweitens zeigt die Krise eindrucksvoll Chinas in den vergangenen Jahren erarbeitete strategische Resilienz. Pekings orchestrierte Reaktion, insbesondere die gezielte Exportbeschränkung bei kritischen Rohstoffen, war kein Ausdruck spontaner Notmaßnahmen, sondern Resultat langfristiger strategischer Planung und konsequenter wirtschaftlicher Diversifikation. Chinas Führung wird Lehren daraus ziehen, was sich mittelfristig auch auf ihre geopolitische Risikobereitschaft auswirken dürfte – mit potenziell weitreichenden Konsequenzen, insbesondere in der hochbrisanten Taiwan-Frage.
Drittens zeichnet sich mit dem Handelskrieg eine neue Phase in der sino-amerikanischen Beziehung ab: Die wirtschaftliche und technologische Entkopplung dürfte nun deutlich beschleunigt werden. Doch entgegen ursprünglichen Hoffnungen auf mehr strategische Stabilität erhöht dieser Prozess paradoxerweise auch das Risiko künftiger geopolitischer Spannungen. Während die kurzfristig stabilisierende Wirkung der ökonomischen Interdependenz zwischen beiden Mächten zunehmend schwindet, entsteht langfristig eine prekäre Sicherheitslage, in der strategische Fehlkalkulationen wahrscheinlicher werden und Konflikte schneller eskalieren könnten.
Der Handelskrieg als Vorbote einer neuen Ordnung
Schließlich – und hierin liegt die vielleicht gravierendste Implikation – hat die aktuelle Krise die Erosion der multilateralen Ordnung beschleunigt. Sowohl Washingtons bewusste Unterminierung der Welthandelsorganisation als auch Pekings subtile Errichtung alternativer Institutionen und Einflussstrukturen signalisieren eine gefährliche Verschiebung hin zu einer geopolitischen Realität, in der universal gültige Regeln zunehmend durch informelle Einflusszonen ersetzt werden. Ein solches Szenario – oft als „Jalta 2.0“ bezeichnet – würde insbesondere kleinere und mittlere Staaten dramatisch in ihrer politischen Handlungsfähigkeit beschneiden und die globale Kooperation zur Bewältigung drängender Herausforderungen wie Klimawandel, Gesundheitskrisen oder nuklearer Sicherheit massiv erschweren.
Der Handelskrieg des Frühjahrs 2025 sollte somit nicht als isoliertes Ereignis oder gar als zufälliges Aufflammen sino-amerikanischer Spannungen fehlinterpretiert werden. Vielmehr markiert er den endgültigen Beleg dafür, dass sich die Weltordnung an einem strategischen Wendepunkt befindet. Sollten die Großmächte diesen Weg weiterverfolgen, droht eine langfristige Fragmentierung der internationalen Beziehungen und eine grundlegende Umformung geopolitischer Strukturen. Die kommenden Jahre werden deshalb entscheidend sein, um entweder den Trend zur Erosion multilateraler Normen aufzuhalten oder aber einer neuen, deutlich fragileren Weltordnung den Weg zu bereiten – mit allen Risiken, die eine solche geopolitische Neuordnung zwangsläufig mit sich bringen würde.
[1] Vgl. Ville Sinkonnen, Contextualizing the „Trump Doctrine“: Realism, Transactionalism and the Civilizational Agenda, in: FIIA Analysis, November 2018.
[2] Zur These des „Neuen Kalten Kriegs“: John J. Mearsheimer, The Inevitable Rivalry: America, China, and the Tragedy of Great-Power Politics, in: „Foreign Affairs“, November/ Dezember 2021; einführend zum sino-amerikanischen Hegemonialkonflikt u.a.: Barbara Lippert und Volker Perthes (Hg.), Strategische Rivalität zwischen USA und China, SWP-Studie 2020/S 01, Februar 2020.
[3] Zur Entwicklung des sino-amerikanischen Handelskonflikts von 2018 bis heute vgl. Chad P. Brown, US-China Trade War Tariffs: An Up-to-Date Chart, Peterson Institute for International Economics, 14.5.2025.
[4] Vgl. dazu auch das online abrufbare Weißbuch Chinas zum Handelskonflikt mit den USA vom 9.4.2025: 关于中美经贸关系若干问题的中方立场.
[5] Vgl. China Halts Critical Exports as Trade War Intensifies, in: „The New York Times“, 13.4.2025.
[6] Zur Vereinbarung im Detail: Andrea Shalal, Emma Farge, Olivia Le Poidevin und Lisa Baertlein, Global stocks rally after US, China pause tariff war, but uncertainty remains, Reuters, 13.5.2025.
[7] Vgl. Ravi Agrawal, Trump Is Ushering In a More Transactional World, in: „Foreign Policy“, 7.1.2025.
[8] Gracelin Baskaran und Meredith Schwartz vom Center for Strategic & International Studies liefern eine erste Einschätzung zu den Folgen des Exportstopps Seltener Erden für die US-Rüstungsproduktion: Center for Strategic & International Studies (CSIS), The Consequences of China’s New Rare Earths Export Restrictions (CSIS Brief), 14.4.2025.
[9] Vgl. Alexander Brown, Jacob Gunter und Max J. Zenglein, Course Correction: China’s Shifting Approach to economic globalization, MERICS China Monitor, 19.10.2021.
[10] Vgl. Una Galani, US-China decoupling is crossing a Rubicon, Reuters, 16.4.2025.
[11] Darauf verweisen auch Rick Waters und Sheena Chestnut Greitens, China Is Determined to Hold Firm Against Trump’s Pressure, Carnegie Endowment, 28.4.2025.
[12] Jüngst dazu u.a. die beunruhigende Analyse von Bonny Lin, John Culver und Brian Hart, The Risk of War in the Taiwan Strait Is Hig – and Getting Higher, in: „Foreign Affairs“, 15.5.2025.
[13] Jennifer Hillman, A Reset of the World Trade Organization’s Appellate Body, Council on Foreign Relations (Policy Innovation Memorandum), Januar 2020.
[14] Vgl. Council on Foreign Relations, China’s Approach to Global Governance, 24.6.2020; Françoise Nicolas, The China-led AIIB, a geopolitical tool?, Institut français des relations internationales, Reconnect China, Policy Brief 21, März 2025.
[15] Vgl. dazu die weitsichtige Analyse von Josef Braml, die auch heute noch Gültigkeit hat: Josef Braml, Trumps transaktionaler Transatlantizismus, in: „Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik“ (ZFAS), 4/2018, S. 439-448.
[16] Vgl. Graham Allison, The New Spheres of Influence: Sharing the Globe With Other Great Powers, in: „Foreign Affairs“, März/April 2020.
[17] Vgl. dazu mein Plädoyer im SOAS University of London China Institute Blog: Europe‘s China Challenge: Why Unity Is the Only Way Forward, 22.4.2025; für eine vertiefte Bestandsaufnahme vgl. Laura von Daniels und Stefan Mair (Hg.), Trumps Rückkehr und Europas außenpolitische Herausforderungen, SWP-Studie 2025/S 03, Februar 2025.