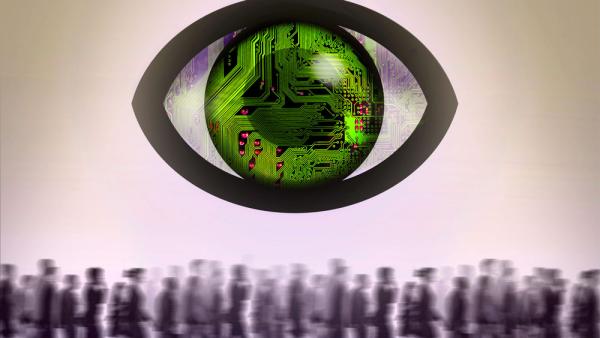Bild: imago images / ZUMA Wire
In Zeiten, in denen die planetarischen Grenzen immer deutlicher erkennbar werden, liegt der Griff zu den Sternen nahe. Allen voran die Unternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk und Amazon-Chef Jeff Bezos, SpaceX und Blue Origins, wollen nicht nur den Raumfahrttourismus ankurbeln, sondern in naher Zukunft auch die Ressourcen von Asteroiden ausbeuten.[1] Beide Unternehmen begreifen sich – neben zahlreichen weiteren Start-ups und Forschungseinrichtungen weltweit – als Teil der „New Space“-Bewegung. Diese verfolgt das Ziel einer aus ihrer Sicht längst überfälligen kommerziellen „Demokratisierung“ des bislang staatszentrierten Weltraumsektors.[2]
Doch auch die Staaten haben den Weltraum nach wie vor im Visier – und zwar buchstäblich. Im vergangenen Dezember erklärte die Nato das All zu ihrem fünften Operationsgebiet. Fast zeitgleich riefen die Vereinigten Staaten die United States Space Force als sechste, unabhängige Teilstreitkraft ihres Militärs ins Leben. Gemeinsam mit dem US-Space Command soll sie die bislang von der amerikanischen Luftwaffe durchgeführten militärischen Raumfahrtmissionen übernehmen.[3] Die politische Leitlinie dafür legte im vergangenen April US-Präsident Donald Trump in einem Dekret fest: „Der Weltraum ist eine rechtlich und physisch einzigartige Domäne menschlicher Aktivität, und die Vereinigten Staaten betrachten ihn nicht als globale Allmende.”[4] Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass China, Russland und Indien in den vergangenen Monaten ihre Anti-Satelliten-Tests ausweiteten, in denen sie den gezielten Abschuss von Raumfahrzeugen wie veralteten Wettersatelliten, aber auch Spionagesatelliten erproben.
Der sich derart zuspitzende kommerzielle und militärische Wettstreit ums All steht jedoch nicht nur einer friedlichen und kooperativen Nutzung des Weltraums entgegen, zu der sich nahezu alle dort aktiven Staaten im 1967 unterzeichneten Outer Space Treaty verpflichtet haben. Sondern er verhindert obendrein, dass Länder des globalen Südens von jenen weltraumgestützten Innovationen profitieren, die gerade sie dringend benötigen.
Milliardenschwerer Weltraummarkt
Im Fokus der Unternehmen wie auch der Großmächte stehen sowohl das sogenannte Upstream- als auch das Downstream-Segment. Im Upstream-Bereich werden Objekte auf der Erde produziert und in den Weltraum entsendet; komplementär dazu verteilt das Downstream-Segment die im Weltraum gewonnenen Ressourcen bzw. Services aus dem Weltraum auf die Erdoberfläche, beispielsweise im Bereich der Telekommunikation.
Im Upstream-Segment verschärft sich derzeit zunehmend der Wettbewerb. SpaceX allein hat bereits zehntausende eigene Satelliten in die Umlaufbahn befördert.[5] Blue Origins schoss bereits knapp 2700 Satelliten in den Orbit, weitere 3000 sollen bald folgen. Beide Unternehmen betrachten die zahlenmäßige Dominanz durch eigene Satelliten als Voraussetzung dafür, eine bestmögliche digitale Kommunikation zu ermöglichen. Der Kommunikationsmarkt gilt derzeit als die lukrativste Investitionsmöglichkeit, Weltraumtourismus hingegen als Zukunftsmusik und wenig profitabel. Die Ausbeutung von Ressourcen könnte hingegen bereits in naher Zukunft zu einem gewinnträchtigen Markt werden.
Zunehmend wagen aber auch kleinere Unternehmen den Schritt ins All. Der Grund sind die rapide sinkenden Kosten, um die immer kleiner werdenden Satelliten mit Hilfe wiederverwendbarer Raketen in die Umlaufbahn zu bringen: Sie verringerten sich in den vergangenen Jahren von rund 200 Mio. US-Dollar auf derzeit rund 60 Mio. Dollar; Schätzungen zufolge könnten sie in naher Zukunft sogar auf rund 5 Mio. Dollar sinken. Auch die Herstellungskosten der Satelliten verringern sich spürbar: Verschlang deren Produktion einst bis zu 500 Mio. Dollar pro Stück, sind es heute „nur“ noch 500 000 Dollar – gerade einmal ein Tausendstel der ursprünglichen Summe.[6] Dies hat zur Folge, dass der sogenannte Low Orbit, in dem die meisten Satelliten um die Erde kreisen, inzwischen massiv überfüllt und zugleich umkämpft ist. Ansammlungen zerstörter oder ausrangierter inaktiver Satelliten formen zudem ganze Schrottgürtel; sie stellen ein wachsendes Sicherheitsrisiko für aktive Satelliten und anstehende Weltraummissionen dar.[7]
Im sogenannten Downstream-Segment ging es in den vergangenen Jahrzehnten vor allem um die Verwertung von Daten aus dem Weltraum. Längst aber wachsen die Ambitionen verschiedener Staaten, im All auch Bergbau zu betreiben. Konkret geht es dabei um Platinoide, Nickel-Eisen-Legierungen, Silikate oder Gold. Aber auch Wassereis auf dem Mond, das als Kraftstoff für Reisen zum Mars verwendet werden könnte, gerät dabei in den Fokus, ebenso wie das Isotop Helium-3, das mittels Kernfusion in Energie umgewandelt werden kann, ohne radioaktive Strahlung zu verursachen. Obwohl es sich bei alledem um überaus kostspielige technologische Vorhaben handelt, sind auch hier die Profitversprechen gigantisch: Laut Goldman Sachs könnte ein einzelner Asteroid Platin im Wert von 50 Mrd. US-Dollar enthalten.[8]
Freier Zugang zum Weltraum?
Für derartige Projekte bedarf es jedoch des freien Zugangs zum All und einer rechtlichen Legitimation, die dortigen Ressourcen ausbeuten zu dürfen.[9] Derzeit zeichnet sich jedoch ein Flickenteppich konkurrierender Regelungen ab.
Das Fundament legte in den USA bereits im Jahr 2015 der Commercial Space Launch Competitiveness Act. Das Gesetz räumt amerikanischen Unternehmen Besitzrechte für Ressourcen ein, die sie aus Himmelskörpern extrahieren. In Europa verabschiedete Luxemburg zwei Jahre darauf den konkurrierenden Luxembourg Space Resource Act, der das Eigentum an Weltraum-Ressourcen für die in dem europäischen Land angesiedelten Unternehmen regelt.
Zuletzt schuf die US-Raumfahrtbehörde Nasa im Mai dieses Jahres mit den Artemis Accords ein Regelwerk, das eigenmächtig festlegt, wie die Extraktion von Ressourcen auf dem Mond und dem Mars erfolgen soll – unter anderem durch die Errichtung sogenannter Sicherheitszonen, in die andere Akteure keinen Zugang erhalten. Die Artemis-Vereinbarungen betrachtet die US-Regierung als Ergänzung zum multilateralen Outer Space Treaty (OST) aus dem Jahr 1967. Er gilt bis heute als Grundlage des internationalen Weltraumrechts, um die Inanspruchnahme des Weltraums durch einzelne Akteure zu verhindern. Tatsächlich aber stehen die Artemis Accords im Widerspruch zum OST, da sie den freien Zugang aller Staaten zum All explizit beschränkt. Unter dem Vorwand, ungehindert Forschung betreiben zu können, dienen die neuen Regeln vielmehr dazu, dem amerikanischen Privatsektor gezielt Investitionsmöglichkeiten im Weltraum zu verschaffen.
Die Militarisierung des Space Race
Das Vorgehen der US-Administration zeigt, dass sie das neue Space Race vor allem als geopolitisches Wettrennen begreift. Vor allem das US-Militär rüstet unter dem Vorwand auf, dass feindliche Staaten technologisch aufholen und damit ein kooperatives Miteinander im Weltraum gefährden könnten. Auch die Nato weitete wegen einer vermeintlich wachsenden Bedrohung durch Russland und China ihr Operationsgebiet auf den Weltraum aus.
Tatsächlich aber verfügen weltweit bislang allein die USA über eine eigenständige Streitkraft für das All. Der russische, einst eigenständige Arm des Militärs wurde 2011 aus Kostengründen wieder den Luft -und Raumfahrtkräften zugeordnet. Gleichzeitig arbeitet die russische Weltraumorganisation Roskosmos, ungeachtet der Kritik Moskaus an den Artemis Accords, derzeit gemeinsam mit den Vereinigten Staaten am Lunar Gateway Project, dessen Ziel die Errichtung einer gemeinsamen Mondbasis der ISS-Partner ist.[10]
China ist bei dieser Kooperation außen vor, da der Nasa gemäß dem Wolf Amendment aus dem Jahr 2011 eine Zusammenarbeit mit der Nationalen Raumfahrtbehörde Chinas (CNSA) aus Sorge vor Spionage untersagt ist.[11] Aus diesem Grund bemüht sich China derzeit um eine eigene Infrastruktur im Weltraum. Schon jetzt verfügt Peking über ein eigenes satellitengestütztes Navigationssystem namens Beidou, das als Ersatz für das US-amerikanische GPS dienen soll. Zudem verfolgt das Land Pläne für eine chinesische Solarstation im Weltall, die allerdings nicht mit der weitaus größer angelegten Northrop Grumman Space Solar Power Initiative der USA mithalten kann, die 2015 an den Start ging. Bis 2035 will China das erste weltraumgestützte Sonnenkraftwerk mit einer Leistung von 200 Tonnen Megawatt in die Erdumlaufbahn bringen. Es soll Energie von der Sonne einfangen und in Form von Mikrowellen an die Empfangsstationen auf der Erde senden, wo diese dann in Elektrizität umgewandelt wird.[12]
Auch bei der Anzahl eigener Satelliten liegt China weit abgeschlagen hinter den Vereinigten Staaten. Mit etwas mehr als 350 Satelliten verfügt Peking gerade einmal über ein Drittel der insgesamt 1300 Satelliten der USA – die damit über mehr Satelliten verfügen als alle anderen Staaten weltweit zusammen.[13] Dessen ungeachtet treibt die US-Regierung die Sorge um, dass ihre Macht nicht nur auf der Erde, sondern auch im Orbit schwindet. Ihre derzeitige Überlegenheit im All verteidigt sie daher äußerst aggressiv – zu Lasten eines friedlichen Miteinanders der Staaten und entgegen internationaler Vereinbarungen.
Der globale Süden hebt ab
Dies geht auch auf Kosten der Entwicklungs- und Schwellenländer, die ebenfalls an der Eroberung des Weltraums teilhaben wollen. Vor allem afrikanische Staaten streben derzeit ins All. Im vergangenen Jahr schickten erstmals Äthiopien, Ruanda, Kenia und der Sudan jeweils einen eigenen Satelliten in die Erdumlaufbahn – mit finanzieller Unterstützung Chinas. Und Nigeria will noch höher hinaus: In den kommenden zehn Jahren will das westafrikanische Land, ebenfalls mit Chinas Hilfe, zum ersten Mal einen Astronauten ins All schicken.
Mit seiner Unterstützung für afrikanische Staaten erhofft sich Peking nicht nur geopolitischen Einfluss, sondern auch eine ordentliche Rendite: Derzeit fließen die Weltrauminvestitionen vor allem in Kommunikationstechnologie, um mittels Satelliten beispielsweise Breitbandverbindungen auf dem afrikanischen Kontinent anbieten zu können. Dank solcher Angebote soll der afrikanische Weltraumsektor mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von gut 7,3 Prozent bis zum Jahr 2024 auf ein Gesamtvolumen von mehr als 10 Mrd. US-Dollar anwachsen.
Die Staaten im globalen Süden erhoffen sich hingegen noch in anderer Hinsicht mehr: So setzt etwa Ruanda weltraumgestützte Technologien ein, um in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels die landwirtschaftliche Nutzung von Agrarflächen zu optimieren. Nigeria und Südafrika verwenden ihre Satelliten für das lokale Management des knapper werdenden Wassers. Und südasiatische Staaten nutzen die Beobachtungs- und Lokalisierungssysteme im All derzeit auch dazu, um die Corona-Pandemie einzudämmen.
Sollte das Rennen der Großmächte – angeführt von den USA – weiter an Geschwindigkeit zunehmen, drohen diese zukunftsweisenden und mitunter lebensrettenden Möglichkeiten des Weltraums unter die Räder zu geraten. Aus diesem Grund verabschiedete die UN-Generalversammlung auf Initiative Chinas und Russlands sowie verschiedener Staaten des globalen Südens im November vergangenen Jahres vier Resolutionen, die nicht zuletzt eine weitere Militarisierung des Weltraums verhindern sollen. Die Resolutionen wurden mit übergroßer Mehrheit angenommen – allein die USA und Israel stimmten dagegen.
Allerdings sind die Resolutionen nicht bindend. Damit ist zu befürchten, dass sich im Weltraum fortsetzt, was wir aus der Erdgeschichte bereits zur Genüge kennen: ein aggressiver Wettstreit zwischen Unternehmen und Staaten um full-spectrum dominance – eine Überlegenheit auf allen Ebenen –, mit dem Ziel, ökonomische Vormacht durch Deregulierung und strategische Dominanz durch Exklusion zu erlangen.[14] Die innovativen Potentiale, die der Weltraum bietet, drohen dadurch im Keim erstickt zu werden – obwohl wir diese heute mehr denn je benötigen.
[1] Vgl. dazu auch Torben David, Die Kolonialisierung des Weltalls, in: „Blätter“, 11/2017.
[2] Vgl. Dylan Taylor, Democratizing space exploration with new technologies, in: „The Space Review”, 17.2.2020, www.thespacereview.com.
[3] Vgl. www.spaceforce.mil und www.spacecom.mil.
[4] Donald Trump, Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources, www.whitehouse.gov, 6.4.2020.
[5] Vgl. Anasuya Datta, How many satellites orbit Earth and why space traffic management is crucial, www.geospatialworld.net, 23.8.2020.
[6] Wharton University of Pennsylvania, Why Big Business Is Making a Giant Leap into Space, https://knowledge.wharton.upenn.edu, 4.6.2019.
[7] Mark Harris, Megakonstellationen: Bedrohung für die Raumfahrt, www.heise.de, 11.4.2019.
[8] Jim Edwards, Goldman Sachs: space-mining for platinum is ‚more realistic than perceived‘, www.businessinsider.com, 6.4.2017.
[9] Laut Artikel 6 des Outer Space Treaty dürfen Unternehmen nur unter staatlicher Aufsicht und der Genehmigung von staatlichen Behörden im All agieren.
[10] Die Internationale Raumstation (ISS) wird gemeinsam von der US-amerikanischen Nasa, der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, der europäischen Raumfahrtagentur ESA sowie den Raumfahrtagenturen Kanadas CSA und Japans JAXA betrieben.
[11] Makena Young, Bad Idea: The Wolf Amendment (Limiting Collaboration with China in Space), https://defense360.csis.org, 4.12.2019.
[12] Vgl. dazu David Cyranoski, China sets sights on first solar power stations in space, www.nature.com, 20.2.2019.
[13] Katharina Buchholz, The Countries with the Most Satellites in Space, www.statista.com, 14.7.2020.
[14] Vgl. Joint Vision 2020, Juli 2014, www.pipr.co.uk.