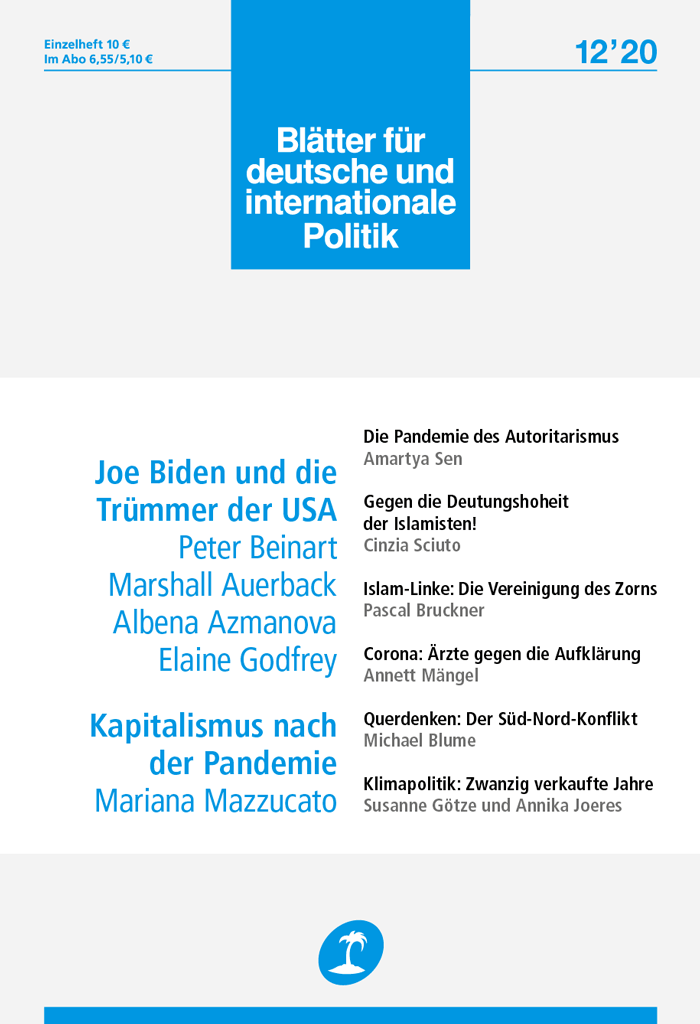Bild: imago images / photothek
Kann man gleichzeitig vorwärts und rückwärts gehen? Kann man die Herausforderungen der Zukunft in den Blick nehmen, das Lenkrad zur Kehrtwende einschlagen – und gleichzeitig mit Vollgas geradeaus weiterfahren? Genau das macht gerade die Europäische Union. Kurz nach ihrem Amtsantritt als neue Präsidentin der EU-Kommission hatte Ursula von der Leyen im Dezember 2019 den Europäischen Green Deal vorgestellt: Klimaneutralität in 2050, eine Wachstumsstrategie, die nicht länger auf Kosten der natürlichen Ressourcen geht – das waren die großen Ziele, das sollte „Europas Mann-auf-dem-Mond-Moment“ sein. Unzählige Europäerinnen hatten auf diese klare Ansage gewartet und nun war sie endlich da: Europa macht Ernst mit dem Klimaschutz, dafür soll kein Stein auf dem anderen bleiben, kein Gesetz unüberprüft.
Vor allem Natur- und Umweltschützer, die seit Jahrzehnten an der Unreformierbarkeit der umstrittenen Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik gelitten hatten, waren euphorisch. Denn Ursula von der Leyen legte sogar noch nach: eine Biodiversitätsstrategie, die biologische Vielfalt aus der Nische des Naturschutzes ins Zentrum der Politik rückt, als „Schlüssel für unser Wohlergehen“, und eine Farm-to-Fork-Strategie, die die überkommenen sektoralen Grenzen überwindet, die Ernährung, Landwirtschaft und Ökosysteme ganzheitlich in den Blick nimmt und unser Lebensmittelsystem reformieren will. Und zudem klare Vorgaben macht: 50 Prozent weniger Pestizide und Antibiotika in der Tierhaltung, 20 Prozent weniger Dünger, 25 Prozent Ökolandbau.
Der Europäische Green Deal – Ursula von der Leyens „Mondlandung des 21. Jahrhunderts“ – fordert viel von dem, was wir unbedingt bräuchten, um die katastrophalen Folgen der Klima- und Biodiversitätskrise noch halbwegs abwenden zu können: eine umfassende Transformation unserer Art zu wirtschaften und zu konsumieren, aber auch unserer Ernährungssysteme. Der Green Deal ist damit der längst fällige Wegweiser zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
Doch das Europäische Parlament und der Rat der europäischen Agrarminister haben diesen Pfad ausgeschlagen, als sie Ende Oktober ihre Positionen zur Reform der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) aushandelten. Stattdessen haben sie über einen Vorschlag beraten, der noch aus der Zeit der Vorgänger-Kommission unter Jean-Claude Juncker stammt – und die Strategien der neuen Kommission weitestgehend ignoriert. Diese wiederum hat es versäumt, auf der Behandlung ihres Vorschlags zu beharren.
Geld für bloße Fläche
Insgesamt 387 Mrd. Euro hat die EU für ihre Agrarausgaben eingeplant – ein Drittel des gesamten EU-Haushalts von 2021 bis 2027 in Höhe von 1074,3 Mrd. Euro. Für den größten Teil dieses Agrar-Budgets wollen sowohl der Rat als auch das Parlament am umstrittenen Fördersystem der Direktzahlungen festhalten, das Landwirten eine Prämie pro Hektar gewährt, in Deutschland etwa 300 Euro – und zwar ganz gleich, ob sie auf dieser Fläche Brutplätze für Rote-Liste-Arten bieten oder Hochleistungssorten für den Weltmarkt anbauen. Ganz egal ist auch, wie groß der Betrieb ist oder wie profitabel. Einzige Bedingung: Die Betriebe müssen die geltenden Gesetze einhalten wie auch die minimalen Anforderungen des sogenannten Greenings, das bei viel bürokratischem Aufwand so gut wie keine ökologische Wirkung gezeigt hat.[1]
Diese Geldausschüttung folgt damit nur einem, mit guten Argumenten gar nicht begründbaren Prinzip: Wer viel hat, bekommt viel. Großgrundbesitzer und außerlandwirtschaftliche Investoren streichen Millionen ein, während immer mehr kleine und mittlere Betriebe überall in Europa aus existenzieller wirtschaftlicher Not aufgeben müssen. Der Europäische Rechnungshof aber hat scharf kritisiert, dass dieses System der Fördermittelvergabe die Biodiversität auf landwirtschaftlichen Nutzflächen gefährdet, statt sie zu schützen.
Der weitaus größte Teil der 387 Mrd. Euro fließt in die erste Säule der GAP, aus der die Flächenprämien bezahlt werden. EU-Parlament und Europäischer Rat streiten nun nur noch darum, ob 20 bis 30 Prozent dieser Ausgaben für die Einhaltung neuer, noch nicht genau definierter Umweltauflagen reserviert bleiben sollen – sogenannte Eco-Schemes, die jedes Mitgliedsland selbst ausgestalten kann. Nach dem Vorschlag, der jetzt im Trilog zwischen Rat, Parlament und Kommission debattiert wird, steht damit fest, dass 70 bis 80 Prozent der Milliarden aus der ersten Säule auch in den nächsten sieben Jahren für Flächenprämien ohne weiterreichende Umweltauflagen aufgewendet werden.
Nun leben wir in einem klimatischen Ausnahmezustand, an dem kein Tag vergeht ohne neue Studien zum Ausmaß der absehbaren ökologischen Katastrophe, in die wir uns katapultiert haben – zuletzt warnten Forscher der Universität Oxford, dass ohne umfassendes Umsteuern allein die Nahrungsmittelproduktion das 1,5-Grad-Ziel sprengen könnte.[2] Und gleichzeitig beschließt die Europäische Union, ein Drittel ihres Budgets für business as usual auszugeben – obwohl sie den Green Deal als Reaktion auf den Klima- und Biodiversitätsnotstand angekündigt hat.
Nein, ein echter Green Deal sähe völlig anders aus; und von einem „Meilenstein“ oder gar „Systemwechsel“, den Bundesagrarministerin Julia Klöckner beschwört, die als Präsidentin des Agrarministerrats die GAP-Verhandlungen leitete, kann keine Rede sein. Das Gegenteil ist der Fall: Wieder einmal erweist sich die GAP mit ihrem milliardenschweren Budget als ein starres, quasi unreformierbares Korsett, das sich weder an dringende neue Erfordernisse – von Klimaschutz und Artensterben über Tierschutz bis hin zum Höfesterben – anpassen lässt, noch den Riss zwischen Stadt und Land zu kitten vermag, sondern diesen im Gegenteil noch erheblich verstärkt.
Nun argumentiert Ursula von der Leyen, dass sie zwar den Vorschlag der Vorgänger-Kommission im Rahmen der institutionellen Kontinuität übernommen habe, dass die Ziele des europäischen Green Deal dennoch im endgültigen Gesetzestext berücksichtigt werden müssten. Nur ist völlig unklar, wie das vonstatten gehen kann, wenn sich sowohl der Rat als auch das Parlament gegen eine umfassende Transformation ausgesprochen haben.
Warum die Beharrungskräfte so groß sind, dafür gibt es viele Gründe: Im Rat der europäischen Agrarminister dominieren nationale Interessen, sie werden daran gemessen, wie viele Milliarden sie für die Landwirtschaft ihres Landes ausgehandelt haben, und das geht am sichersten mit Direktzahlungen. Auch für die Landwirtinnen und Landwirte bedeuten die Flächenprämien sicheres Geld in unsicheren Zeiten, das sie dringend brauchen, um ihre oft hohen Kredite für Stallneubauten oder Geräte abzahlen zu können. Dabei sind es weniger die landwirtschaftlichen Familienbetriebe als vielmehr die großen Konzerne des Agrobusiness und der Ernährungsindustrie, die vom bisherigen System der weltmarktorientierten Agrarpolitik profitieren. Niedrige Erzeugerpreise sind gut für den Export, nicht aber für die Landwirte.
Der große Anteil der Flächenprämien ist aber auch das Ergebnis hoch professionellen Lobbyings. Immer wieder konstatieren Beobachter, wie gut abgestimmt die Lobbyisten der Agrar- und Ernährungsindustrie in Brüssel agieren, während genau das den vielen Umwelt- und Tierschutzverbänden Europas nicht gelingt.
Über Jahrzehnte wurde über die europäische Agrarpolitik trotz ihres gigantischen Budgets ohne große öffentliche Aufmerksamkeit verhandelt. Viel zu lange wurde die GAP mit ihrem komplizierten Fachjargon als sektorale Einzelpolitik für Agrarier betrachtet – und eben nicht als Schlüsselpolitik für alle Europäerinnen und Europäer. Dabei hat die Frage, wie die fast 400 Mrd. Euro verteilt werden, enormen Einfluss auf die natürlichen Ressourcen, auf unsere Landschaft und unsere Gesundheit. Sie kann das agrarkulturelle Erbe der historischen europäischen Kulturlandschaften in Europa bewahren oder zerstören. Sie kann einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Rettung der Biodiversität leisten – oder eben das Gegenteil bewirken. Deswegen ist die Festlegung der GAP eine der wichtigsten politischen Entscheidungen – und das gleich für die nächsten sieben Jahre. In der medialen Berichterstattung wird das jedoch noch immer nicht hinreichend gewürdigt.
Neuer Akteur Fridays for Future
Doch immerhin hat sich in dieser Reformrunde einiges geändert: Kurz vor dem Ende der Verhandlungen mischte sich Fridays for Future mit einer klaren Forderung in die Diskussion ein: Der GAP-Vorschlag diene nicht dem Klimaschutz und müsse deshalb komplett zurückgezogen werden. In den sozialen Medien ging der Schlachtruf #WithdrawtheCAP viral. Und außer dem Deutschen Bauernverband und der Bundesagrarministerin verteidigte beinahe niemand Julia Klöckners „Meilenstein“. Nein, nicht nur von den Umweltverbänden hagelte es Kritik, sondern auch in den Kommentaren der großen Tageszeitungen. Darauf folgte ein Schlagabtausch zwischen Gegnern und Befürwortern des Vorschlags: Der agrarpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Friedrich Ostendorff, sprach von Etikettenschwindel. Das Bundeslandwirtschaftsministerium verteidigte seinen „Systemwechsel“ damit, dass es künftig keine Leistungen mehr ohne Gegenleistungen geben solle. Daraufhin stellte der agrarpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion des EU-Parlaments, Martin Häusling, klar: Das sei auch heute schon so, das Greening der aktuellen Förderperiode verlange längst höhere Standards als die jetzt vorgesehenen. Beides aber reiche bei weitem nicht aus, um Biodiversität und Klima zu schützen.[3]
Inzwischen hat sich auch der EU-Vizepräsident und Kommissar für Klimaschutz, Frans Timmermans, in die Debatte eingeschaltet – mit einer „Kampfansage an die EU-Agrarminister“, wie die „Tagesschau“ es nannte. Er sei enttäuscht, dass Rat und Parlament nicht mehr Ambitionen zum Klimaschutz gezeigt hätten. Um tatsächlich Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, müsse sich die Landwirtschaft entscheidend ändern.
Das letzte verbleibende Zeitfenster
Für die Kommission steht dabei einiges auf dem Spiel: Ursula von der Leyen muss sich nun an ihren großen Worten von der ökologischen „Mondlandung“ messen lassen. Unterläuft bereits ihre erste große Entscheidung über den EU-Haushalt und damit über die GAP diese Messlatte, verliert sie massiv an Glaubwürdigkeit.
Was in den nächsten Monaten im Trilog verhandelt wird und anschließend auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, die die GAP konkret umsetzen müssen, hat also allergrößte Bedeutung: für das Schicksal der Bauernfamilien überall in Europa, für den globalen Klimaschutz, für die Biodiversität sowieso – aber auch für die Europäische Union als politische Institution.
Die anhaltende Unreformierbarkeit der GAP hat das Vertrauen in die europäischen Institutionen unterhöhlt – keine gute Entwicklung in unruhigen Zeiten. Unter der gestiegenen Aufmerksamkeit einer politisierten jungen Generation kann die EU es sich nicht länger leisten, die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Kritik des eigenen Rechnungshofs und die Bedürfnisse ihrer Bürgerinnen und Bürger zu ignorieren. Die Kommission muss sich an ihren eigenen Zielen messen lassen und endlich das gut geölte Gefüge der Agrarlobbyisten aufbrechen. Nur so kann es gelingen, eine zukunftsfähige Agrar- und Ernährungspolitik zu gestalten, die Lebensmittelproduktion, Klima- und Umweltschutz und die Entwicklung der ländlichen Räume ausbalanciert.
Um die Pariser Klimaziele zu erreichen und die Anforderungen der Biodiversitätsstrategie zu erfüllen, braucht es europaweit gültige hohe Standards für die landwirtschaftliche Produktion. Diese Standards müssen – das ist entscheidend – auch für importierte Lebensmittel gelten. Das würde weitgehende Auswirkungen auf die Handelspolitik haben, doch davor darf die Kommission nicht zurückschrecken. Auf diese Weise könnte die EU auch die Landwirte europaweit für ihre Transformation gewinnen – mit einer konsequenten Ausrichtung auf eine ökologischere Landwirtschaft, die nicht durch Importe aus Ländern mit niedrigeren Standards unterlaufen wird, sondern hohe Wertschöpfung für die Erzeuger garantiert. Dadurch würden die Bauern von ausgebeuteten Rohstofflieferanten zu Klimaschützern und Vorreitern des Green Deal. Demonstrierende Wut-Bauern könnten sich in stolze Zukunfts- und Klimawirte verwandeln, die auf ihren Feldern Kohlenstoff im Boden speichern, wiedervernässte Moore mit Paludi-Kulturen klimafreundlich bewirtschaften oder in Agroforstsystemen gleichzeitig Lebensmittel und biologische Vielfalt produzieren. Fast 400 Mrd. Euro stehen dafür – noch – zur Verfügung.
Wenn das jedoch nicht gelingt, sondern alles beim Alten bleibt, dann könnte sich gerade das als ein Pyrrhussieg für die etablierte Agrarlobby erweisen. Wenn sich die GAP nämlich nicht wesentlich ändert, wird auch der Zorn der in ihrer Existenz schon heute bedrohten Bauern weiter wachsen, ebenso wie der Protest der Klimaaktivisten – während zugleich die Temperaturen auf der Erde weiter steigen und die Ökosysteme kollabieren, was wiederum massive negative Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erträge nach sich ziehen würde. Die Folge dürfte dann eine Anpassung by disaster sein und nicht mehr by design. Diese Agrarreform ist daher vermutlich das letzte verbleibende Zeitfenster, um die dringend erforderliche Transformation doch noch zu gestalten.
[1] Umweltbundesamt (Hg.), Evaluierung der GAP-Reform aus Sicht des Umweltschutzes – GAPE. Abschlussbericht, Texte 58/2019, www.umweltbundesamt.de.
[2] Michael A. Clark u.a., Global food system emissions could preclude achieving the 1.5° and 2°C climate change targets, https://science.sciencemag.org, 6.11.2020.
[3] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Cross-Compliance, www.bmel.de, 4.7.2019.