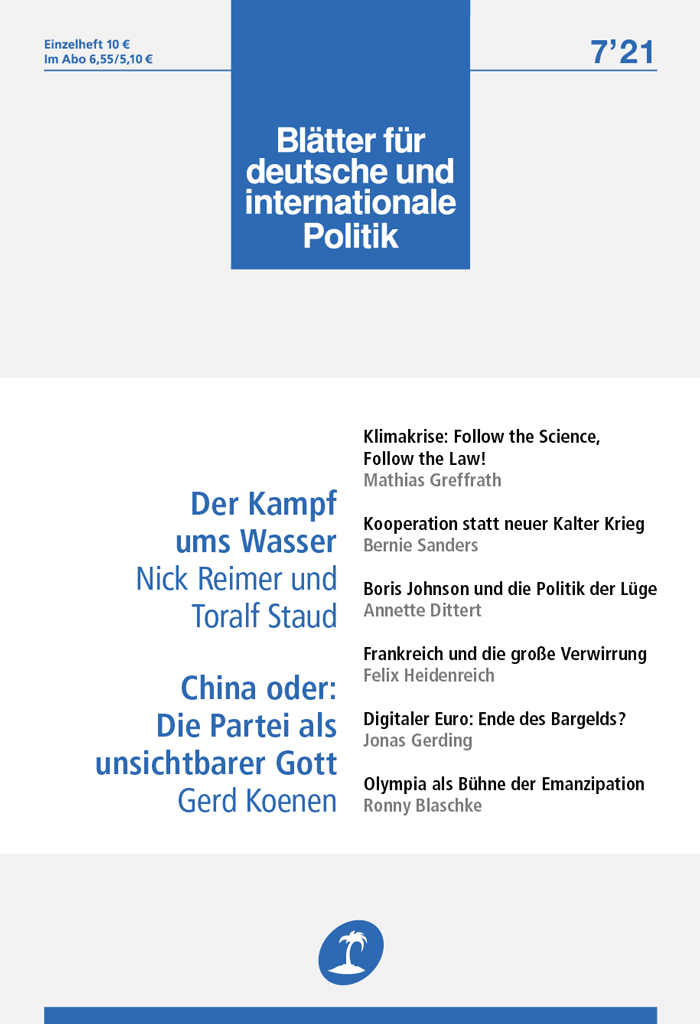Bild: Annalena Baerbock, Co-Bundesvorsitzende der Grünen, auf dem digitalen Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin, 12.06.2021 (IMAGO / photothek)
Der Bundestagswahlkampf, der über die deutsche Politik in der ersten Hälfte dieser in ökologischer Hinsicht so existenziellen 2020er Jahre entscheidet, nimmt zunehmend tragisch-skandalöse Züge an. Auf der einen Seite erlebt die grüne Spitzenkandidatin Annalena Baerbock aufgrund einer schlecht kommunizierten Benzinpreiserhöhung, des schwachen Abschneidens bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und ihres aufgehübschten Lebenslaufs einen Absturz in den Umfragewerten, der an das Schulz-Phänomen von 2017 erinnert. Auf der anderen Seite machen die Gegner der Grünen in Medien und Wirtschaft mit aller Brutalität gegen Baerbock Front – und bringen damit zugleich zum Ausdruck, wie sehr sie eine grüne Kanzlerin fürchten.
Zunächst stellte die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“ (INSM) die Grüne mit großen Anzeigen in diversen Tageszeitungen an den Pranger. Durch die Darstellung der Kandidatin in Moses-Pose inklusive Steintafeln mit den „zehn Verboten“ soll das Bild der ewigen grünen Verbotspartei evoziert werden. In Verbindung mit der Überschrift („Wir brauchen keine Staatsreligion“) behauptet die Anzeige im Ergebnis, die Grünen seien genauso autoritär und „schlimm wie die Juden in ihrer starren Vorschriftenreligion“.[1] Für diese Anleihe aus dem „Fundus des kulturellen Antisemitismus“[2] erntete die INSM massive Kritik. Dennoch legte mit dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall einer der Hauptsponsoren der INSM umgehend nach: „Das Grünen-Wahlprogramm ist Sozialismus pur“, verkündete Stefan Wolf, im „Nebenberuf“ Vorstandsvorsitzender des Automobilzulieferers Elring-Klinger AG.[3] „Ein großer Teil der Grünen ist sozialistisch geprägt“, so Wolf weiter, „sozialistisch regierte Länder sind wirtschaftlich aber noch nie erfolgreich gewesen. Die Bürger müssen sich zudem fragen, ob sie in einem Land leben wollen, in dem der Staat eine immer größere Rolle beansprucht und das Leben bestimmt wird durch Regelungen und Verbote, die die Freiheit immer weiter einschränken. Das ist die Gretchenfrage, um die es bei dieser Bundestagswahl geht.“
Sieht man einmal von der absurden Dämonisierung der Generation Baerbock ab, die eher hyper-pragmatisch und alles andere als sozialistisch geprägt ist, liegt hier in der Tat die politische Kardinalfrage: Wer schützt wie die Freiheit? Und was genau haben wir heute unter Freiheit zu verstehen?
Die Antwort des Gesamtmetallchefs ist denkbar schlicht: Freiheit bedeutet vor allem die Freiheit des Marktes. „Die Unternehmen brauchen Freiheit und finanziellen Handlungsspielraum. Sie dürfen keinesfalls mit Steuererhöhung oder noch mehr Regulierungen und Verboten geschwächt werden.“ Das unterschlägt völlig, dass speziell die Automobilindustrie es über Jahrzehnte nicht geschafft hat, auf dem Weg der bloß postulierten Selbstverpflichtung die erforderlichen ökologischen Innovationen hervorzubringen, sondern im Gegenteil mit allen, auch illegalen Mitteln an der veralteten Diesel-Technologie festhielt. Nicht zuletzt deshalb ist die wichtigste deutsche Exportbranche gegenüber anderen Nationen beim E-Antrieb massiv ins Hintertreffen geraten.
Was die Baerbock-Habeck-Grünen dagegen vorschlagen, ist von Radikalismus weit entfernt. Ihnen schwebt ausweislich ihres Wahlprogramms und des soeben erschienenen Buches von Baerbock gerade nicht harte Konfrontation mit der fossilistischen Ökonomie im Stile eines Jürgen Trittin vor, sondern vielmehr eine „kooperative Wirtschaftspolitik“.[4] Zu diesem Zweck plädiert Baerbock für einen „Pakt mit der Wirtschaft“.[5] Demzufolge werden den Unternehmen Kosten ausgeglichen, die diese zusätzlich erbringen müssen, um klimaneutral zu werden. Dafür schließt der Staat mit den Unternehmen langfristige Verträge mit Laufzeiten bis zu 20 Jahren ab, in denen er die Übernahme aller Mehrkosten beim ökologischen Umbau garantiert. Auf diese Weise soll ein Anreiz zur Umstellung der Produktion auch für jene Unternehmen geschaffen werden, bei denen die Transformationskosten deutlich über den Einsparungen durch CO2-Reduktion liegen. Für diesen Pakt würde der Staat tief in die Tasche greifen müssen – nicht zuletzt zugunsten der Metallbranche, die jetzt so massiv gegen Baerbock schießt.
Die Grünen sitzen in diesem Wahlkampf zwischen allen Stühlen und können es Keinem recht machen.
Für ihre eher wirtschaftsfreundliche Position erntete die Partei-Spitze Vorwürfe auf dem grünen Wahlprogrammparteitag, insbesondere seitens der jungen Parteimitglieder, die zugleich Fridays for Future nahestehen. Sie attackierten scharf, wenn auch im Ergebnis erfolglos, den von der Grünen-Spitze festgelegten Preis von 60 Euro für eine Tonne CO2, mit dem durchaus richtigen Argument, dass auch dieser nicht die erforderliche Begrenzung der Klimaerwärmung auf 1,5 Grad garantiert. Und natürlich durfte auch der Protest aus der grünen Gründungsgeneration nicht fehlen: „Der Kapitalismus, wenn er ungestört fortbestehen will, braucht die Grünen“, polemisiert in gewohnter Manier die Grüne der ersten Stunde und spätere ÖkoLinX-Gründerin Jutta Ditfurth und erklärt die Baerbock-Grünen prompt zum „größeren Übel“.[6]
Die Grünen sitzen in diesem Wahlkampf damit zwischen allen Stühlen und können es Keinem recht machen: Den einen sind sie viel zu harmlos, den anderen bereits zu radikal, wie das Ergebnis in Sachsen-Anhalt gezeigt hat.
Hier aber liegt das grüne Kardinalproblem: Es besteht in der Illusion, in der Mehrheitsgesellschaft gäbe es einen tatsächlichen Wunsch nach fundamentaler „Erneuerung“, so Baerbocks Kernbotschaft. Doch nach bald eineinhalb Jahren Coronakrise sehnt sich die Mehrheit nicht nach sozial-ökologischer Transformation, sondern nach Stabilität – und nach der Rückkehr zur ressourcenverschlingenden Vor-Corona-Zeit. Von echtem Veränderungswillen kann keine Rede sein, die herrschende Stimmung lautet vielmehr „Keine Experimente“ und spielt damit einem Status-Quo-Politiker wie Armin Laschet in die Hände.
Das ist das grüne Dilemma: In der Theorie bejahen viele eine konsequente Klimapolitik. Kommt es dagegen zum Schwur und müssen die Leute erkennen, dass ihnen ökologische Politik wirklich etwas abverlangt – nämlich 16 Cent mehr pro Liter Benzin – ist die Unterstützung ganz schnell am Ende. Dabei hatten sich auch Union und SPD auf eine Erhöhung um 15,5 Cent geeinigt, aber, anders als die ehrlichen Grünen, den konkreten Betrag einfach nicht an die große Glocke gehängt.
Die große Verdrängung
In diesem Wunsch nach unbedingter Besitzstandswahrung steckt eine gewaltige Verdrängung der fatalen ökologischen Lage. Und dennoch kann auch progressive Politik diese strukturkonservative Grundstimmung im Lande nicht ignorieren – auf die Gefahr hin, ansonsten immer mehr an Zuspruch zu verspielen. Jede Aufforderung zur Veränderung muss daher zugleich mit einer sozialen Stabilitätsgarantie einhergehen. Das gilt besonders für eine führungsunerfahrene Partei wie die Grünen, der die Wählerinnen und Wähler ohnehin erhebliches Misstrauen entgegenbringen, was die Kanzlerinnenschaft anbelangt.
Diese Lehre haben die Grünen nicht zuletzt aus der Niederlage von Sachsen-Anhalt ziehen müssen. Deswegen betonen sie jetzt bei jeder Gelegenheit fast panisch ihr „Energiegeld“, mit dem die CO2-Verteuerung insbesondere zugunsten der sozial Schwachen kompensiert werden soll. An die eigentliche Gretchenfrage trauen sich aber auch die Grünen mit ihrem Green New Deal nicht wirklich heran. Sie lautet: Welche Grenzen müssen wir unserer gegenwärtigen Konsum-Freiheit ziehen, um die Freiheit der künftigen Generationen zu garantieren?
Hieß es früher auf Baustellen und Kindergärten, Eltern haften für ihre Kinder, müsste es heute, was die Umweltzerstörung angeht, heißen: Kinder haften für ihre Eltern.
Dabei haben alle ökologisch Engagierten seit jüngstem einen starken Alliierten, nämlich die deutsche Justiz, genauer: das Bundesverfassungsgericht. Sein Urteil vom 29. April, mit dem es das schwarz-rote Klimagesetz kippte, steht für einen echten Paradigmenwechsel im grundgesetzlichen Freiheitsverständnis. Das oberste deutsche Gericht leitet aus der Unantastbarkeit der Menschenwürde in Artikel 1 Grundgesetz, aber auch aus der Staatszielbestimmung des Klimaschutzes, Artikel 20 a GG, eine temporale, man könnte sogar sagen, eine überzeitliche Dimension der Freiheitsrechte ab. Das Grundgesetz schützt demnach nicht nur die Freiheiten der jetzt, sondern auch die der zukünftig Lebenden.
Damit manifestiert sich auch rechtlich ein ganz neuer, objektiver Generationenkonflikt. Das Konsumverhalten der älteren Generation geht zu Lasten der jüngeren. Hieß es früher auf Baustellen und Kindergärten, Eltern haften für ihre Kinder, müsste es heute, was die Umweltzerstörung angeht, heißen: Kinder haften für ihre Eltern, denn sie müssen die Taten ihrer Vorfahren ausbaden – ein moralisch, aber auch rechtlich unhaltbarer Zustand.
Und weil die Maßnahmen der Bundesregierung bisher nicht den völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechen, denen sich Deutschland 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen unterworfen hat, ist die Botschaft aus Karlsruhe glasklar: Um noch weit härtere, freiheitseinschränkende Maßnahmen ab 2030 zu vermeiden, muss sich die Politik jetzt ökologisch deutlich stärker anstrengen. Anders ausgedrückt: Wenn wir jetzt nicht auf gewisse Konsum-Freiheiten verzichten, werden künftige Generationen gar keine Möglichkeit mehr haben, eine freiheitliche Position beim Klimaschutz einzunehmen, sondern ab 2030 eine „Vollbremsung“ hinlegen müssen, das heißt mit dann in der Tat hoch autoritären Methoden zu agieren haben.
Deshalb sind der Sozialismus-Vorwurf und die diffamierende Moses-Kampagne der INSM gegen die Grünen anti-aufklärerisch und hoch demagogisch: Sie suggerieren, dass aktive Klimapolitik in der Gegenwart diktatorische Qualität besitzt. Karlsruhe hat aber genau das Gegenteil festgestellt – dass nur durch eine sofortige konsequente Klimapolitik künftigen Generationen der Spielraum erhalten bleibt, damit diese nicht später mit autoritären Maßnahmen die dann erforderlichen maximalen CO2-Reduktionen in kürzester Zeit leisten müssen.
Nach der klaren Positionierung fast der gesamten Wissenschaft hat damit auch das oberste deutsche Gericht ausgesprochen, dass nicht nur die naturwissenschaftlichen Fakten, sondern auch das geltende Recht einen weit stärkeren Klimaschutz verlangt.[7] Das zentrale Problem der Grünen besteht allerdings darin, dass dies in weiten Teilen der Bevölkerung noch gar nicht angekommen ist oder eben bereitwillig verdrängt wird. Und dass daher die entscheidende dritte Komponente noch aussteht: nämlich die Umsetzung von wissenschaftlicher und juristischer Erkenntnis in Politik.
Eine Mehrheit der Bevölkerung lebt im Jahr 2021 noch immer weit stärker in den Konsumansprüchen der Gegenwart als im Bewusstsein der ökologischen Probleme.
Genau darum geht es in diesem Wahlkampf, aber auch über den 26. September hinaus – um einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen der heutigen und der zukünftigen Generationen. Das grüne Dilemma: Eine Mehrheit der Bevölkerung lebt im Jahr 2021 noch immer weit stärker in den Konsumansprüchen der Gegenwart als im Bewusstsein der ökologischen Probleme. Man kann fast von einer Schizophrenie sprechen: Obwohl wir im neuerlichen Hitze-Sommer die Auswirkungen der Klimakrise dramatisch erleben,[8] sträubt sich die Mehrheit konsequent dagegen, die notwendigen Veränderungen auch nur zu realisieren. Und die Laschet-Union bedient genau diese Schizophrenie, wenn sie einerseits wirksamen Klimaschutz verspricht, aber andererseits auch weiteres Wirtschaftswachstum und ein Festhalten an der schwarzen Null. Laschets „Klimawohlstand“ in seinem nebulösen „Modernisierungsjahrzehnt“ bedeutet: Allen wohl und niemand weh – und Klimaschutz darf nichts kosten. Fest steht: Mit dieser Art der „Entfesselung der Wirtschaft“ rückt das Erreichen der Klimaneutralität in weite Ferne.
Aufgrund dieser, für die personell schwächeren jüngeren Generationen fatalen, aber für die älteren verlockenden Verheißung spricht viel dafür, dass es am 26. September für die Grünen nicht für Platz eins reichen wird – und auch nicht für das Kanzleramt. Denn eine Ampelkoalition scheint, den Annäherungen mancher Grüner und FDPler zum Trotz, insbesondere steuerpolitisch ziemlich ausgeschlossen.[9]
Allerdings haben die Grünen für diesen Fall bereits eine Rückfalloption. „Wir treten an, um dieses Land an führender Stelle in die Zukunft zu führen“, hatte Baerbocks zentraler Satz bei der Ausrufung ihrer Kandidatur am 19. April gelautet.[10] „An führender Stelle“ heißt nicht zwangsläufig Kanzleramt, eine mögliche, auch früh absehbare Niederlage im Kampf um Platz 1 war damit von Anfang an mitbedacht. Dafür greift nun die Ausfallstrategie: „Die Grünen machen in Koalitionen den Unterschied“.[11] Das heißt, es kommt für die Partei auf ein möglichst starkes Ergebnis an. Und wenn sie am Ende tatsächlich über 20 Prozent erreichen sollte, wäre das immer noch mehr als die Verdopplung ihrer 8,9 Prozent von 2017 und zweifellos ein großer Erfolg.
Und vor allem würde es eines bedeuten: dass die Grünen nicht mit der FDP regieren müssen, insbesondere nicht in einer Jamaika-Koalition. Denn das wäre vermutlich der klimapolitische Worst Case, die Wiederauflage des bereits 2017 Missglückten – allerdings nun mit einem finanz- und wirtschaftspolitischen Sperrriegel aus Christian Lindner und Friedrich Merz. Unter diesen Vorzeichen wäre konsequente Klimapolitik vermutlich schon im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
[1] Vgl. Thomas Assheuer, Micha Brumlik u.a., die die „Verschmelzung der Moses-Figur mit dem Griff nach politischer Macht als Urszene des antisozialistischen Antisemitismus“ dechiffrieren, www.zeit.de, 15.6.2021.
[2] Ebd.
[3] Im Interview mit der „Welt“, 18.6.2021.
[4] Annalena Baerbock, Jetzt. Wie wir unser Land erneuern, Berlin 2021, S. 111.
[5] Helene Bubrowski und Hendrik Kafsack, Baerbocks Pakt mit der Wirtschaft, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ), 18.6.2021.
[6] Jutta Ditfurth, Das größere Übel, in: „konkret“, 6/2021, S. 10-12.
[7] Vgl. den Beitrag von Mathias Greffrath.
[8] Vgl. den Beitrag von Nick Reimer und Toralf Staud.
[9] Vgl. Kevin Hagen u.a., Viel zu verzeihen, in: „Der Spiegel“, 19.6.2021; und Karina Mössbauer, Nein zur grünen Ampel. Lindner will Baerbock nicht zur Kanzlerin wählen, www.bild.de, 21.6.2021.
[10] Cerstin Gammelin, „Wir schaffen das nur miteinander“, www.sueddeutsche.de, 19.4.2021.
[11] So bereits Robert Habeck im Interview mit Markus Söder, in: „Der Spiegel“, 12.12.2020.