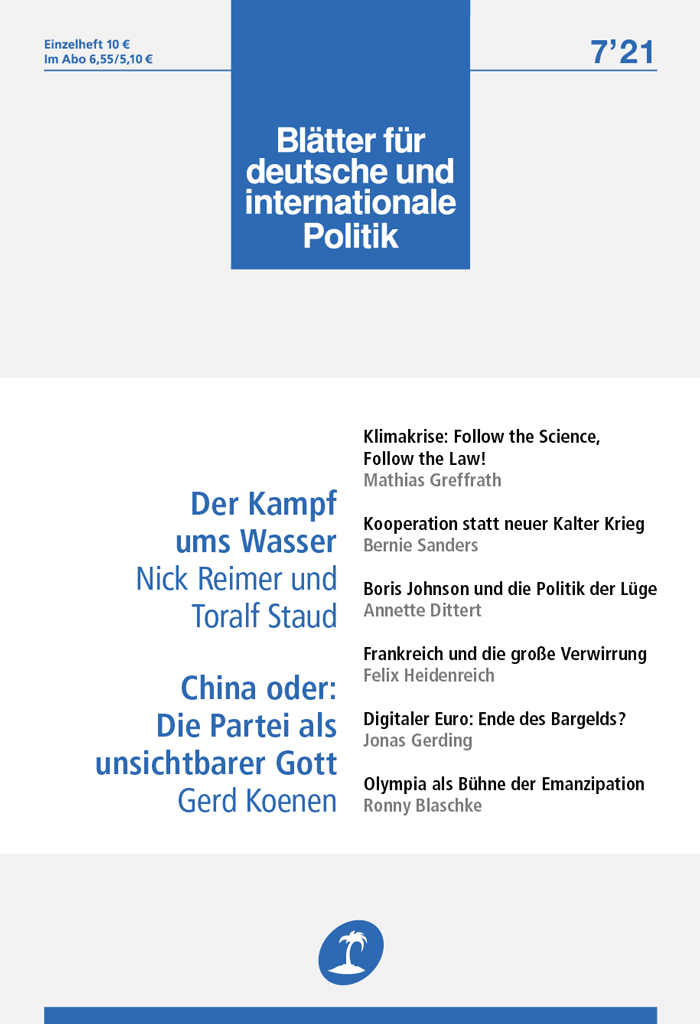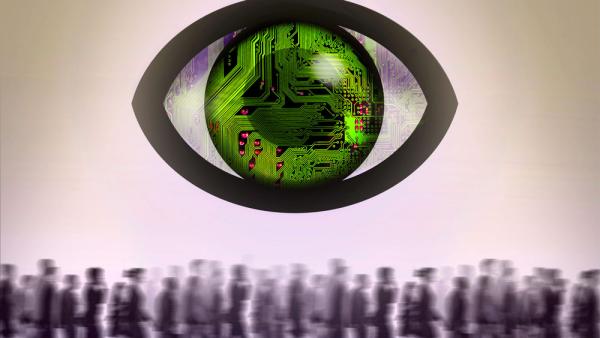Bild: Bundesinnenminister Horst Seehofer und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts fuer Verfassungsschutz, bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2020 in Berlin, 15.06.2021 (IMAGO / photothek)
Als Bundesinnenminister Horst Seehofer jüngst den Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) für 2020 vorstellte, nannte er als größte Bedrohungen Rechtsextremismus und Antisemitismus.[1] „Wir haben einen Alarmzustand“, urteilte er auf der Pressekonferenz. Hat der CSU-Politiker, dessen Amtszeit demnächst mit der Bundestagswahl endet, also doch verstanden? Nein. Davon kann keine Rede sein.
Der neue Verfassungsschutzbericht beinhalte „Neuigkeiten von vorvorgestern“, kritisierte etwa Ronen Steinke die 420 Seiten starke Publikation in der „Süddeutschen Zeitung“ scharf.[2] „Nur nichts überstürzen. Nur nicht zu früh Alarm schlagen! Das ist das Prinzip des Berichts.“ Steinke weiter: „Wenn der Verfassungsschutz für die Bewertung von Viren zuständig wäre, dann würde er wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024 bekanntgeben, dass das Coronavirus nach vorläufiger erster Einschätzung als Verdachtsfall auf Krankheitserregung eingestuft wird.“
Und die Linken-Politikerin Martina Renner twitterte: „Mehr als 20 Jahre nach Gründung des Instituts für Staatspolitik (IfS) hat auch das BfV dessen Rolle für extreme Rechte erkannt.“ Sie kritisierte: „Wenn so die von Haldenwang betonte ,Wellenbrecherfunktion‘ des BfV aussieht, dann wundere ich mich nicht über den anhaltenden Aufschwung von Rechtsaußen.“ Anders gesagt: Dafür, dass die Behörde ein „Frühwarnsystem“ der Demokratie sein möchte, ist der Verfassungsschutz oft erstaunlich spät dran. Mehr noch: Viele brisante und für die Demokratie äußerst bedrohliche Erkenntnisse werden der Öffentlichkeit vom Geheimdienst nur in Mini-Portionen verabreicht. Oder ganz unterschlagen.
Immerhin hat die „Neue Rechte“ im neuen Verfassungsschutzbericht erstmals ein eigenes Unterkapitel bekommen. BfV-Präsident Thomas Haldenwang spricht von „geistigen Brandstiftern“ in dieser Szene, erwähnt Götz Kubitscheks Institut für Staatspolitik, den Verein „Ein Prozent“, die Identitäre Bewegung, das „Compact“-Magazin des einstigen linken Revolutionärs Jürgen Elsässer. Der Präsident des Inlandsgeheimdienstes sieht ein informelles Netzwerk am Werk, in dem nach seinen Worten „rechtsextremistische bis rechtskonservative Kräfte“ zusammenwirken. Auch der Antaios-Verlag wurde unter Beobachtung gestellt. Haldenwang bestätigte damit Informationen von „Zeit Online“. Im Bericht selbst wird der Verlag nicht explizit genannt.
Detailliert skizziert hingegen der Autor Andreas Speit in seinem jüngst erschienenen Buch die sich seit Jahren entwickelnden Vernetzungen zwischen den Akteuren – und wie sie sich mit der Querdenken-Szene und der Corona-Leugnungsbewegung vereint haben.[3] Das aber haben das Bundesamt und auch die Landesämter für Verfassungsschutz nicht ausreichend im Blick, wie auch das von der Amadeu-Antonio-Stiftung verantwortete Portal „Belltower News“ am Beispiel der Coronaleugner*innen-Szene belegt.[4]
Zwar beobachtet der Verfassungsschutz, dass die Reichsbürger-Szene im Vergleich zum Vorjahr etwas Zulauf bekommen hat. Die Behörde führt diesen Anstieg vor allem auf die Proteste gegen die staatlichen Coronamaßnahmen zurück. „Die getroffenen Maßnahmen haben zu einer erhöhten Dynamik und Aktivität in Teilen der ,Reichsbürger‘- und ,Selbstverwalter‘-Szene geführt“, heißt es in Haldenwangs Bericht. „Die Ideologie der meisten Szeneangehörigen ist an die verschiedensten Verschwörungsideologien anschlussfähig.“
Neu und motivierend für die Szene sei, „dass andere Kritiker der Coronamaßnahmen die ,Reichsbürger‘ und ,Selbstverwalter‘ bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen nicht ausgrenzen, sondern gemeinsam mit ihnen protestieren.“
„Weit überwiegend“ aber sieht der Verfassungsschutz in den Demonstrationen gegen die Coronapolitik der Bundesregierung „demokratische Proteste“. „Querdenken“, obwohl doch angeblich im Visier des Verfassungsschutzes, wird im gesamten Bericht nur einmal erwähnt – im Zusammenhang mit dem Aufruf von Jürgen Elsässer zur Demonstration der Bewegung am 29. August 2020 in Berlin: „Jetzt gilt es! Jetzt ist die Chance da, das Merkel-Regime tatsächlich zu stürzen“, wird der Rechtsextremist zitiert. „Der Wind der Veränderung bläst gewaltig – so wie im Herbst 1989. Eine friedliche Revolution liegt in der Luft.“ Dass die Coronaleugner*innen-Szene generell versucht, die Revolution von 1989 zu vereinnahmen – beispielsweise finden viele Demonstrationen montags statt –, wird nicht weiter kontextualisiert.
Generell fehlt, so Nicholas Potter, „eine detaillierte Erfassung von den demokratiefeindlichen und zutiefst antisemitischen Protesten aus dem ,Querdenken‘-Spektrum und die genaue Rolle der extremen Rechten“. Bitter nötig wäre laut Amadeu-Antonio-Stiftung zudem eine statistische Analyse des Rechtsterrorismus im Online-Bereich. „Denn immer mehr Rechtsextreme organisieren sich international und weitgehend anonym in informellen Chatgruppen und Online-Foren – und stellen eine ernstzunehmende Gefahr dar, wie die Anschläge von Halle über Christchurch bis Utøya schmerzhaft zeigen.“[5]
Noch immer verharmlost: Rechtsextreme in Sicherheitsbehörden
Immerhin zu einem eineinhalb Seiten langen Unterkapitel haben es die „Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden“ gebracht. Im Sommer 2019 war der Autor dieses Textes Mitherausgeber des Sammelbandes „Extreme Sicherheit. Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz“ – im damals kurz zuvor erschienenen Verfassungsschutzbericht für 2018 wurde das Problem noch mit keiner Zeile erwähnt. Inzwischen sind eine ganze Reihe weiterer Bücher zu diesem Komplex erschienen, etwa von Dirk Laabs oder Aiko Kempen.[6]
Nun ist im Verfassungsschutzbericht für 2020 die Rede von „mehreren Fällen“ aus den vergangenen Jahren, „bei denen Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Einstellung von Mitarbeitern aus Sicherheitsbehörden vorlagen“. Von der „Vorbereitung auf den sogenannten Tag X“ ist die Rede, von „Drohnachrichten, unterschrieben mit ,NSU 2.0‘“ sowie „Chatgruppen unter Beteiligung von Polizisten“ – nichts, was nicht bereits in Buchform oder Zeitungsartikeln zu lesen war.
Immerhin warnt der Geheimdienst: „Ausgestattet mit teilweise speziellen Fähigkeiten, Zugang zu Waffen und mitunter sensiblen Informationen, können solche Personen eine erhebliche Gefahr für den Staat und die Gesellschaft darstellen.“ Zudem würden sie das Vertrauen der Bürger in staatliche Institutionen untergraben.
Verrutschte Maßstäbe
Trotz fast täglich neuer „Einzelfälle“ – Seehofers Begrifflichkeit ist fast zum geflügelten Wort geworden – scheint die Devise im Bundesinnenministerium und beim Verfassungsschutz noch immer zu sein, diese Bedrohung der Demokratie herunterzuspielen. Neuer Polizeiskandal in Hessen, Rechtsradikale bei der Bundestagspolizei, die Beteiligung eines Polizisten bei einem mutmaßlich fremdenfeindlichen Angriff in Freiburg, rassistische und sexistische Beleidigungen bei einer Bundeswehreinheit in Litauen – allein die Fälle aus den vergangenen Wochen müssten in Seehofers Behörde alle Alarmglocken schrillen lassen. In Wirklichkeit aber scheint ihm und seinen Beamt*innen die fundierte Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der „Sicherheitslage“ nicht geheuer zu sein: Das erwähnte Buch „Extreme Sicherheit“ wurde bereits Ende 2020 als Sonderausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gedruckt. Doch zu bestellen war die Edition auch ein halbes Jahr später, Mitte Juni diesen Jahres, noch nicht. Die zuständige Fachaufsicht im Bundesinnenministerium (BMI) hatte Bedenken gegen eine zeitnahe Veröffentlichung.
„Egal, wer die Wahl gewinnt: Im @BMI_Bund muss ganz dringend mal Inventur gemacht werden. Ganz, ganz dringend“, twitterte der Satiriker Jan Böhmermann anschließend. Vorausgegangen war ein weiterer Fall von Einflussnahme des Ministeriums auf die Arbeit der bpb. Im Zusammenspiel mit der „Bild“-Zeitung und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, hatte das BMI erreicht, dass das Onlinedossier der Bundeszentrale zu Linksextremismus verändert wurde. Die „taz“ geriet über das Informationsportal „Frag den Staat“ an den entsprechenden E-Mail-Wechsel und dokumentierte, wie ein von einem renommierten Wissenschaftler verfasster Satz gestrichen und durch eine unwissenschaftliche Definition des Verfassungsschutzes ersetzt wurde. „Man erkennt, wie maßgeblich die ,Bild‘ die Überarbeitung des Teasers im Linksextremismusdossier angestoßen hat“, heißt es im „taz“-Bericht.[7]
Um nicht falsch verstanden zu werden: Natürlich muss ein Verfassungsschutz, der seine Arbeit ernst nimmt, auch die extreme Linke in den Blick nehmen. Doch nicht selten erscheint es so, als ob gerade hier die Maßstäbe verrutschen. Dass etwa die gewiss radikal linke Zeitung „junge Welt“ im Verfassungsschutzbericht auftaucht, ist sehr fragwürdig, wie auch die „Süddeutsche Zeitung“ zu Recht analysierte. Unter der Überschrift „Der Klassenkrampf“ stellt Wolfgang Janich die Frage, ob das „konkrete Gefahrenpotential“ des laut eigenen Angaben „aktionsorientierten“ Blatts denn hinreichend belegt ist. Schließlich habe das Bundesverfassungsgericht schon 2005 beschlossen, dass die Nennung einer Zeitung im Verfassungsschutzbericht eine „mittelbar belastende negative Sanktion“ sei und damit ein klarer Eingriff in die Pressefreiheit.[8]
Auch jenseits des Totalversagens des Verfassungsschutzes im Umgang mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und anderen Rechtsterroristen, das bis heute parlamentarische Untersuchungsausschüsse beschäftigt, ist die Liste der Verfehlungen des Geheimdienstes lang. Zu nennen sind Schräglagen in der Bewertung, Bummelei, falsche Schwerpunktsetzung, politische Instrumentalisierung.
Das belegte jüngst ein Blick nach Sachsen: Anfang Juni wurde bekannt, dass der dortige Landesverfassungsschutz rechtswidrig Daten über zahlreiche Oppositionspolitiker in Sachsen von AfD bis Linkspartei sowie über den stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulig, den damaligen Landesvorsitzenden der SPD, gesammelt hatte. Von Letzterem wurde etwa die Aussage gespeichert, „dass auch die CDU eine Verantwortung dafür trägt, welche Zustände heute in Sachsen hinsichtlich Rechtsextremismus und Rassismus herrschen“. Dulig zeigte sich „fassungslos“ über die Datensammlung, sprach von einem „ungeheuerlichen Vorgang“: „Das alles ist der alte, furchtbare Geist, der beim Verfassungsschutz herrschte: Nur die CDU ist Staatspartei in Sachsen, und alles, was der CDU gegenübersteht, muss erfasst und beobachtet werden.“
Es ging um den gleichen Verfassungsschutz, der die rassistische Pegida-Bewegung erst mehr als sechs Jahre nach ihrer Gründung als „erwiesen extremistische Bewegung“ einstufte. Und dessen Präsident Dirk-Martin Christian erst dieser Tage in einem Interview diagnostizierte, dass es bei der Bevölkerung in Sachsen „eine Art politischer Indifferenz, vor allem gegenüber Rechtsextremisten“ gebe. Als ob das eine Neuigkeit sei.
Es spricht Bände, dass mit Hans-Georg Maaßen überdies jahrelang ein Mann Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz war, der in den Graubereich zwischen rechtem Rand der Unionsparteien und Rechtspopulisten abgedriftet ist, von der südthüringischen CDU jüngst aber dennoch als Kandidat für die Bundestagswahl aufgestellt wurde. Selbst der von Verfassungsschutzbeamten hochgehaltenen Hufeisentheorie, die von einer simplen Gleichsetzung der politischen Spektren links und rechts ausgeht und deshalb hochumstritten ist, [9] hat sich Maaßen längst entzogen: Er sieht das Land ganz besonders von links bedroht. Im Juli 2020 schrieb er in einem Beitrag für das „Kultur-Magazin“ des oberbayerischen Schlosses Rudolfshausen, es gehe der politischen Linken darum, mit „Kampfbegriffen wie Antifaschismus, Antirassismus, Antikapitalismus und Klimaschutz“ den „politischen Gegner (das ist das Bürgertum) moralisch zu diskreditieren, zu delegitimieren und zu schwächen“. Jener Maaßen, der 2018 und bis heute rassistischen Hass und Hetze in Chemnitz relativierte.
Als Seehofer bei der Pressekonferenz zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichts vom Journalisten Tilo Jung gefragt wurde,[10] ob Maaßen inzwischen zur Neuen Rechten gerechnet werden müsste, gab der Heimatminister eine Ehrenerklärung für den ehemaligen Behördenchef ab. „Ich habe mit Herrn Maaßen lange Zeit als Präsident des Bundesamtes sehr gut zusammengearbeitet. Aus meiner Sicht war er ein guter Präsident.“ Maaßen stehe „zweifelsfrei auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung“.
Würde sich der Bundesinnenminister an den zwölf Seiten zur Ideologieproduktion der Neuen Rechten im Bericht seines Hauses orientieren, hätte er wohl zu einem anderen Urteil kommen müssen. Denn dass HGM, wie er die persönlich von ihm verfassten Tweets kennzeichnet, daran maßgeblich mitwirkt, dürfte dem Verfassungsschutz, nähme er seinen Auftrag wirklich ernst, eigentlich nicht entgangen sein.
[1] Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Verfassungsschutzbericht 2020, www.verfassungsschutz.de.
[2] Ronen Steinke, Frühwarnsystem für Gemütliche, www.sueddeutsche.de, 15.6.2021.
[3] Andreas Speit, Verqueres Denken. Gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus, Berlin 2021.
[4] Vgl. Nicholas Potter, Rechtsextreme Gewalttaten und Brandstiftungen nehmen stark zu, www.belltower.news, 15.6.2021.
[5] Nicholas Potter, Rechtsextreme Gewalttaten, a.a.O..
[6] Dirk Laabs, Staatsfeinde in Uniform. Wie militante Rechte unsere Institutionen unterwandern, Berlin 2021; Aiko Kempen, Auf dem rechten Weg? Rassisten und Neonazis in der deutschen Polizei, München 2021.
[7] Volkan Agar, Seehofers Haus diktierte Definition, www.taz.de, 15.6.2021.
[8] Wolfgang Janisch, Der Klassenkrampf, www.sueddeutsche.de, 18.5.2021.
[9] Vgl. Christoph Kopke und Lars Rensmann, Die Extremismus-Formel. Zur politischen Karriere einer wissenschaftlichen Ideologie, in: „Blätter“, 12/2000, S. 1451-1462.