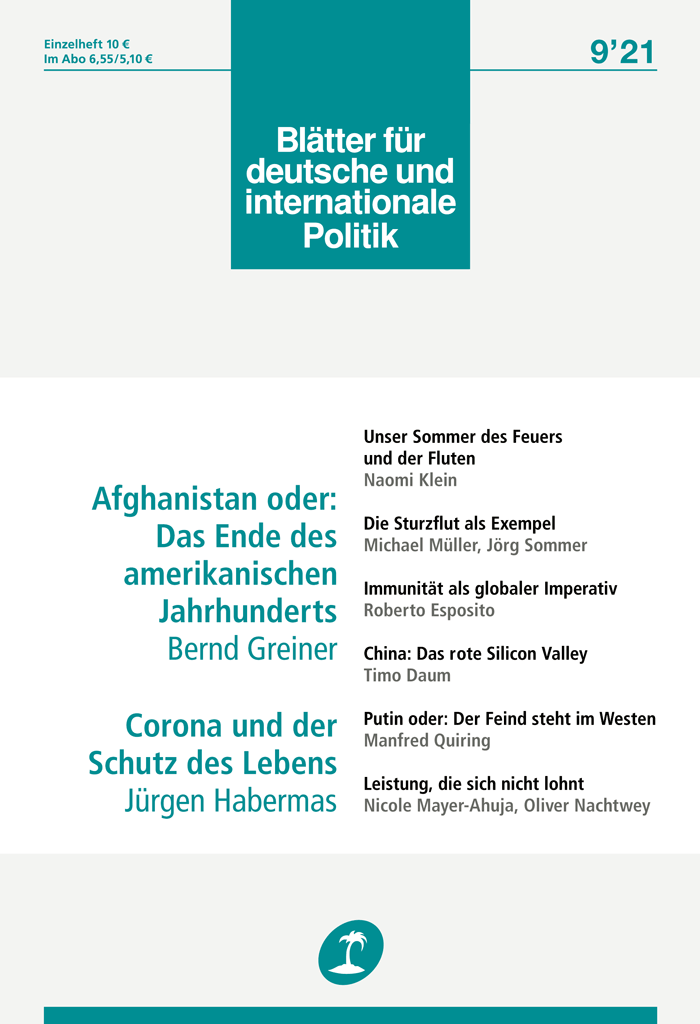Gegen die Propaganda von der technischen Beherrschbarkeit der Klimakrise (Teil II)
In Debatten über gezielte technische Eingriffe in das Klimasystem gegen die Erderwärmung – das sogenannte Geoengineering – wird heute vor allem eine Methode vorgeschlagen: die direkte Abscheidung von CO2 aus der Luft. Diese Methode ahmt nach, was Bäume auf natürliche Weise tun: Mittels Photosynthese fangen sie Kohlenstoff ein und lagern ihn in ihren Wurzeln, Stämmen, Ästen und Blättern ab. Warum sollte man sich also nicht einfach mit der massiven Pflanzung von Bäumen beschäftigen? Das bedeutet entweder eine groß angelegte Wiederaufforstung jener riesigen Regionen der Erde, in denen Wälder abgeholzt wurden, oder eine Aufforstung von Regionen, die zuvor kein Wald waren. Solche Bemühungen könnten durch eine Art der Landnutzung und landwirtschaftliche Praktiken ergänzt werden, die zusätzlich Kohlenstoff in Böden binden.
Verlockend an dieser Variante von negativen Emissionen ist, dass sie einen Weg nach vorne eröffnet, bei dem es nichts zu bereuen gibt. Schließlich können wir durch das Pflanzen von Bäumen besser funktionierende Ökosysteme bekommen, die Artenvielfalt erhalten und sogar steigern, die Qualität unserer Böden, der Luft und des Wassers erhöhen und uns besser vor den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels schützen. Können Anstrengungen, den Planeten zu „begrünen“, unsere CO2-Emissionen tatsächlich deutlich verringern oder sie sogar ganz unschädlich machen? Diese Idee hat sich auf jeden Fall für jene als bequem erwiesen, die „Baumpflanzungen“ als Lösung und als Beweis für mutige Maßnahmen zum Klimaschutz präsentieren, um die Aufmerksamkeit davon abzulenken, was die Verschmutzer tun sollten. Hat dieser Vorschlag aber tatsächlich einen Wert?
Werfen wir einen Blick auf die Aussichten für Aufforstungen und Wiederaufforstungen. Einer Studie zufolge stehen dafür etwa 0,9 Mrd. Hektar der Erdoberfläche zur Verfügung. Das entspricht Milliarden neuer Bäume, die in den nächsten Jahrzehnten zusammen etwas mehr als 200 Mrd. Tonnen CO2 binden könnten, und einer Kohlenstoffbindungsrate von etwa elf Mrd. Tonnen pro Jahr. Andere Wissenschaftler haben die Annahmen dieser Studie in Frage gestellt und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Potential der Kohlenstoffbindung viel geringer ist. Tatsächlich schätzt der IPCC-Bericht aus dem Jahr 2019, dass bis zum Ende des Jahrhunderts nur etwa 60 Mrd. Tonnen CO2 durch Wiederaufforstung gebunden werden könnten, was weniger als einer Mrd. Tonnen CO2 pro Jahr entspricht. Nehmen wir dennoch einmal an, dass die viel höhere Zahl von elf Mrd. zutreffend wäre.
Regenerative Landwirtschaft, die auf dem Recycling landwirtschaftlicher Abfälle und der Verwendung von Kompostmaterial auch aus anderen Quellen basiert, könnte in Kombination mit Landnutzungspraktiken, die die Kohlenstoffbindung im Boden verbessern, potentiell 3,5 bis elf Mrd. Tonnen an CO2-Emissionen pro Jahr im Boden fixieren. Auch hier nehmen wir die sehr optimistische Obergrenze von elf Mrd. Tonnen pro Jahr an.
In der Summe kommen wir so auf 22 Mrd. Tonnen CO2 pro Jahr. Das klingt nach einer ganzen Menge. Nur erzeugen wir derzeit das Äquivalent von etwa 55 Mrd. Tonnen CO2 pro Jahr durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und durch andere menschliche Aktivitäten. Das bedeutet: Selbst wenn wir von der obersten Grenze der Schätzungen ausgehen, könnte die kombinierte Wirkung von Wiederaufforstung, Landwirtschaft und Landnutzungspraktiken den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre um höchstens etwa 44 Prozent verlangsamen. Mit anderen Worten, die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre würde weiter steigen, wenn auch nur etwa halb so schnell.
Doch auch diese Einschätzung ist zu optimistisch. Denn wir können nicht einfach den massiven Bedarf an nutzbarem Land ignorieren – von heute 7,7 Milliarden Menschen, Tendenz steigend, die um Raum für Siedlungen, Landwirtschaft und Viehzucht konkurrieren. Unter Berücksichtigung realer wirtschaftlicher Zwänge liegt die tatsächlich für die Wiederaufforstung verfügbare Landfläche möglicherweise bei nur etwa 30 Prozent der in der jüngsten Studie angenommenen technisch verfügbaren Landfläche.
Darüber hinaus wird der Klimawandel sehr wahrscheinlich die Fähigkeit der Wälder verringern, Kohlenstoff zu binden. Die Buschbrände im Sommer 2019/2020 verdoppelten Australiens Emissionen im darauffolgenden Jahr und führten wahrscheinlich zu einem Anstieg der globalen CO2-Konzentration um ein bis zwei Prozent. Und Australien ist nicht der einzige Ort, an dem es brennt. Weitere Waldbrände, vom Amazonas über den Mittelmeerraum bis zur Arktis, setzen jährlich Mrd. Tonnen CO2 frei. Eine Studie, über die die Zeitschrift „Nature“ 2020 berichtete, zeigte, dass die maximale Aufnahme von CO2 durch die Tropenwälder in den 1990er Jahren erfolgte und seither infolge von Abholzung, Landwirtschaft und den Auswirkungen des Klimawandels zurückgeht. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass der Amazonas innerhalb des nächsten Jahrzehnts von einer Senke, also einem Nettoaufnehmer von CO2, zu einer Quelle, also einem Nettoproduzenten, werden könnte. Basierend auf den Prognosen aus früheren Klimamodellierungen war eine solche Entwicklung erst mehrere Jahrzehnte später erwartet worden.
Solche Erkenntnisse verdeutlichen eine der potentiellen Schwierigkeiten, wenn Aufforstung als primäres Mittel des Klimaschutzes oder als Grundlage für CO2-Ausgleichsberechnungen oder Gutschriften betrachtet wird. Jeglicher Kohlenstoff, der gebunden wird, könnte leicht und innerhalb kurzer Zeiträume durch Waldbrände wieder freigesetzt werden. Tragischerweise verschärft sich das Problem, wenn sich der Planet weiter erwärmt und die Bedingungen für massive Waldbrände günstiger werden. Darüber hinaus gibt es bei diesem Verfahren, so wie beim Geoengineering, mögliche unbeabsichtigte Folgen. Der Co-Autor eines kürzlich erschienenen Regierungsberichts über die Bindung von CO2 in Wäldern sagte der BBC: „Wir wären verrückt, wenn wir in so immensem Ausmaß aufforsten würden, ohne die weiteren Auswirkungen auf die Umwelt zu berücksichtigen.“ Der Bericht besagte, dass unbedachte Baumpflanzungen paradoxerweise gar zu einem erhöhten CO2-Ausstoß führen könnten. Wie die BBC anmerkte, „würde das Bepflanzen von Hochlandweiden mit Bäumen die Möglichkeiten der Fleischproduktion in Großbritannien verringern – was zu einem Anstieg der Importe aus Ländern führen könnte, die Regenwälder abholzen, um Rindfleisch zu produzieren“.
Wie sollen Negativemissionen erreicht werden?
Aber die Betrachtung der natürlichen CO2-Bindung ist nicht vollständig, ohne die Möglichkeiten der energetischen Nutzung von Biomasse mit anschließender Abscheidung und Bindung des entstehenden CO2 anzusprechen. Diese Technologie wird auch als „Bioenergie mit CO2-Abscheidung und -speicherung“ (Bio Energy with Carbon Capture an Sequestration, BECCS) bezeichnet. Der IPCC hat diese Technologie in seinen Szenarien zur Stabilisierung der CO2-Konzentration hervorgehoben. Dabei geht man davon aus, dass die effektiven Gesamtemissionen innerhalb weniger Jahrzehnte bei null liegen werden. Der IPCC nimmt dabei an, dass BECCS tatsächlich zu negativen CO2-Emissionen führen kann, die einen Teil der verbleibenden Verbrennung fossiler Brennstoffe und anderer CO2-erzeugender Praktiken ausgleichen würden, so dass unterm Strich die erforderlichen Netto-null-Emissionen erreicht würden.
Wie könnte das funktionieren? In seinem Film „Planet der Menschen“ behauptet der Regisseur Michael Moore fälschlicherweise, dass „Biomasse 50 Prozent mehr CO2 als Kohle und mehr als dreimal so viel wie Erdgas freisetzt“. In Wirklichkeit sind Biokraftstoffe, unter Vernachlässigung der fossilen Energieträger, die bei der Verarbeitung und beim Transport verwendet werden könnten, CO2-neutral, da sie als Pflanzen der Atmosphäre die gleiche Menge an CO2 entnommen hatten, wie nun bei ihrer Verbrennung freigesetzt wird. Sie sind daher weitaus CO2-freundlicher als fossile Brennstoffe und liefern Energie mit geringer oder keiner CO2-Belastung. Tatsächlich können sie – gewissermaßen – sogar als CO2-ärmer als die erneuerbaren Energien dargestellt werden, da sie Energie liefern und gleichzeitig CO2 aus der Atmosphäre entnehmen.
Dies könnte den Eindruck erzeugen, als würde das einem physikalischen Gesetz widersprechen, doch das ist nicht der Fall. Die Idee dahinter ist, Biokraftstoffe zu verbrennen, um Energie zu gewinnen, so wie bei Kohle oder Erdgas. Dieser Prozess ist von Anfang an CO2-neutral. Wenn man nun das CO2 einfängt und ablagert, ist es sogar mehr als CO2-neutral, da aus der Atmosphäre CO2 entzogen, gebunden und dauerhaft abgelagert wird. Natürlich gelten auch hier dieselben Vorbehalte wie bei der CO2-Abscheidung im Zusammenhang mit Kohle oder Erdgas: Man muss in der Lage sein, dass CO2 effizient, sicher und effektiv dauerhaft einzulagern – und das ist gar nicht so einfach. Außerdem ist eine vollständige Abscheidung unwahrscheinlich, wie wir bereits bei CCS gesehen haben, so dass ein Teil des CO2 wieder in die Atmosphäre gelangt.
Hinzu kommt, dass „Negativemissionstechnologien“, allen voran BECCS, Teil der verschiedenen IPCC-Emissionsszenarien oder „-pfade“ sind – und zwar auch derjenigen, mit denen wir die kritischen Erwärmungsschwellen wie 1,5 oder 2,0 Grad Celsius einhalten können. Angesichts der Tatsache, dass eine Wirtschaftlichkeit von BECCS in der in diesen Szenarien angenommenen Größenordnung noch nicht nachgewiesen ist, könnte der IPCC zu Recht dafür kritisiert werden, dass er im Grunde „die Sache auf die lange Bank schiebt“ – indem er Szenarien mit beträchtlichen Kohlenstoffemissionen in naher Zukunft vorschlägt, in denen eine gefährliche Erwärmung des Planeten nur durch massive Negativemissionen in den nächsten Jahrzehnten abgewendet werden kann. Da hierzu eine derzeit nicht existente Technologie zum Einsatz kommen soll, ist die Frage erlaubt, was passiert, wenn diese Technologie nicht verfügbar sein wird. Mephisto lässt grüßen.
Resilienz als Vermeidungsbegriff
Grundsätzlich sollten alle vernünftigen Optionen auf dem Tisch liegen, wenn wir darüber debattieren, wie wir unsere Wirtschaft rasch dekarbonisieren und gleichzeitig den Energiebedarf der Gesellschaft decken können. Es gibt keine einfache Lösung, und es gibt wichtige und ehrenwerte Debatten in der Politik darüber, wie wir diese schwierige Aufgabe bewältigen können.
Manche Kollegen, die ich zutiefst respektiere, schätzen die Rolle der Atomenergie als Teil eines umfassenden Plans zur Bekämpfung des Klimawandels sehr positiv ein. Ich selbst bezweifle jedoch, dass die Atomenergie eine zentrale Rolle bei der erforderlichen sauberen, grünen Energiewende spielen sollte. Denn es gibt eine Reihe von großen und allzu bekannten Problemen, die der Nutzung der Atomenergie als sichere und unerschöpfliche Energiequelle entgegenstehen.
Die letzte Zuflucht der vermeintlichen Problemlöser bildet die Terminologie der „Anpassung“ und „Resilienz“. Das heißt nicht, dass die beiden Themen nicht wichtig wären – sie sind es. Wir haben keine andere Wahl, als uns an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen, die jetzt unvermeidlich sind, und wir müssen angesichts des bereits erhöhten Klimarisikos eine größere Widerstandsfähigkeit aufbauen. Aber so wie in einer Ablenkungskampagne der Schwerpunkt auf individuelles Handeln gelegt wurde, um systemische Veränderungen zu untergraben, ist die ausschließliche Fokussierung auf Anpassung und Resilienz zu einer bevorzugten Taktik der Anstifter klimapolitischer Untätigkeit geworden. Es ist eine weitere Methode, um so zu tun, als ob man die Initiative ergreift, um die Klimakrise zu bewältigen, während man gleichzeitig wie gewohnt fossile Brennstoffe verbrennt und die damit verbundenen Gewinne einfährt.
Wir entscheiden, was wir tun
Es braucht daher aus meiner Sicht echte Lösungen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Wie wir gesehen haben, erfordert ein gangbarer Weg nach vorn beim Klimaschutz eine Kombination aus Energieeffizienz, Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Stromerzeugung durch eine Reihe komplementärer erneuerbarer Energiequellen. Das Problem ist, dass die Interessen der fossilen Brennstoffindustrie in diesem Szenario den Kürzeren ziehen. Daher haben diese ihren immensen Reichtum und ihren Einfluss genutzt, um jegliche Bemühungen in diese Richtung zu unterlaufen. Die Interessenträger und diejenigen, die sich für sie einsetzen, haben versucht, die Aufmerksamkeit von diesen realen Klimalösungen abzulenken und stattdessen vermeintliche Alternativen zu fördern. Zu den von ihnen favorisierten Optionen zählen vermeintlich klimafreundliche Formen der Verbrennung fossiler Brennstoffe, unkontrollierte Manipulation des Klimas auf planetarer Ebene und das Vertrauen in Konzepte wie die massive Wiederaufforstung und die Atomkraft, deren Realisierbarkeit als echte Klimalösung zweifelhaft ist. Eine andere von ihnen bevorzugte Option ist ebenjene hohle Rhetorik über „Anpassung“ und „Widerstandsfähigkeit“, die die grundlegende Ursache des Problems – die Verbrennung fossiler Brennstoffe – vernachlässigt.
Es gibt falsche Propheten, die diese Nicht-Lösungen fördern. Sie haben progressiv klingende Namen, wie das Breakthrough Institute oder die Ökomodernisten. Aber lassen Sie sich nicht täuschen – was sie anpreisen, ist business as usual, verkleidet als Fortschritt. Und fallen Sie nicht auf ihre Krokodilstränen über die „Spaltung“ herein, wenn jemand zu Anstrengungen aufruft, um die falschen Lösungen zu fördern und die Aufmerksamkeit von echten Lösungen abzulenken.
Man denke nur an das klagende Lamento des Ökomodernisten Matthew Nisbet vom Breakthrough Institute, der schrieb, dass „diejenigen, die sich auf die dunklen Künste des ‚Engagements‘ in den sozialen Medien spezialisiert haben, diese Plattformen genutzt haben, um unsere Gehirne zu hacken und unseren Fokus auf Konservative und die Übeltaten der fossilen Brennstoffindustrie zu richten, während die Endzeit naht“. Nisbet fordert uns auf, eine alternative Realität zu akzeptieren, in der die sozialen Medien nicht von Leugnern und Anstiftern klimapolitischer Untätigkeit instrumentalisiert worden sind, sondern von einer zwielichtigen Bande von Umweltaktivisten. Diese ungeheuerliche Behauptung ist vielleicht nicht überraschend, wenn man bedenkt, dass Nisbet vor einigen Jahren einen heftig kritisierten Bericht verfasst hat, in dem er die ziemlich absurde Behauptung aufstellt, dass grüne Gruppierungen die Brennstofflobby in den Propagandaschlachten ums Klima finanziell ausgestochen hätten.
Aber wie steht es mit Nisbets These, dass Klimaaktivisten von der Angst geleitet sein könnten, dass „die Endzeit bevorsteht“? Hier hat er zumindest teilweise recht, aber aus dem verkehrten Ansatz heraus: Die falschen Propheten waren in der Tat teilweise erfolgreich darin, einige Klimaaktivisten davon zu überzeugen, dass Notfallmaßnahmen – wie Geoengineering – erforderlich sein könnten. Verzweifelte Zeiten erfordern schließlich verzweifelte Maßnahmen. So gibt es innerhalb der Klimabewegung einen wachsenden Anteil derer, die sich in eine Erzählung von Untergang und Verzweiflung hineinsteigern – ein Narrativ, das sie ironischerweise genau auf den Pfad der Untätigkeit führen kann, den die Anstifter klimapolitischer Untätigkeit für sie vorgezeichnet haben. Denn wenn eine katastrophale Erwärmung des Planeten wirklich unvermeidlich wäre und wir nichts tun könnten, um sie abzuwenden – warum sollten wir dann überhaupt etwas tun?
Stattdessen kann die Erkenntnis, dass der gefährliche Klimawandel bereits da ist, auch auf eine seltsame Weise ermutigend sein. Denn es gibt kein definiertes Ziel der Gefahrenabwehr, das wir verfehlen könnten. Es ist zu spät, um negative Auswirkungen zu verhindern – sie sind bereits eingetreten. Aber wie viel an zusätzlichen Gefahren auf uns zukommen wird, das können wir weitgehend beeinflussen. Wir entscheiden, was wir tun.
Der Beitrag basiert auf dem gekürzten siebten Kapitel des Buches von Michael E. Mann, „Propagandaschlacht ums Klima“, das vor kurzem im Verlag Solare Zukunft erschienen ist. Alle Quellenverweise sind dort zu finden. Der erste Teil erschien in den „Blättern“ 8/2021. – D. Red