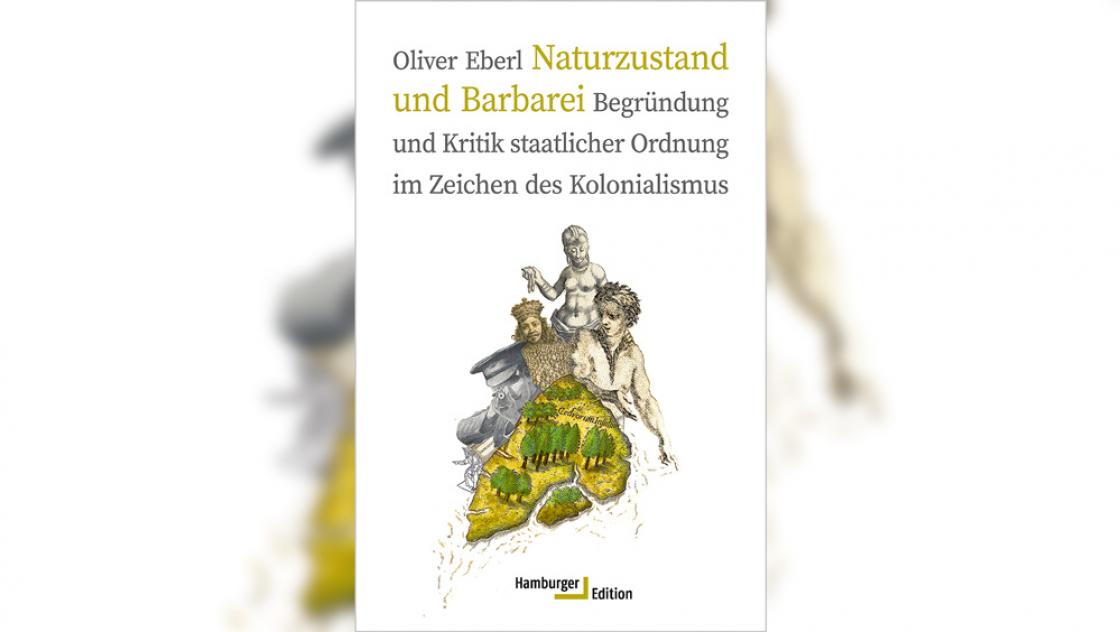
Bild: Hamburger Edition
Wenn der Mensch in Frieden und Wohlstand leben will, bedarf er eines Staates, der mit seinem Gewaltmonopol für Sicherheit und Ordnung sorgt. Dieser eine Satz enthält bereits das Kernargument jener berühmten Theorie, mit der Thomas Hobbes (1588-1679) in seiner Schrift „Leviathan“ die Notwendigkeit politischer Herrschaft begründet. Ohne den Schutz einer staatlichen Gewalt drohe jeder Einzelne der Raubgier oder dem Schwert seiner im Zweifel missgünstigen Mitmenschen zum Opfer zu fallen. Da der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, aber im Unterschied zu diesem über so etwas wie Verstand verfüge, lege ihm die Vernunft nahe, den herrschaftslosen Naturzustand zu überwinden und sich mit den anderen Menschen auf einen Vertrag zugunsten eines übergeordneten Dritten zu verständigen: dem Staat. Fehlt ein solcher Staat, der die legitime Ausübung von Gewalt in einer Hand monopolisiert, so droht sich die Gesellschaft in einen Zustand aufzulösen, in der ein unkontrollierter Gewaltausbruch jederzeit und allen Ortens möglich ist, wie Hobbes unter dem Eindruck des Englischen Bürgerkriegs und der kolonialen Expansion des britischen Empires argumentiert.
Nun legt der in Hannover lehrende Politikwissenschaftler Oliver Eberl in seiner aufwändigen, präzise argumentierenden und von Platon bis Adorno praktisch die gesamte Spanne der europäischen Ideengeschichte durchmessenden Studie „Naturzustand und Barbarei. Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus“ die kolonialen Wurzeln des Naturzustandsbegriffs offen. Hobbes selbst hatte ihn mit seinem Bild eines von Rohheit, Grausamkeit und Armseligkeit geprägten indigenen Amerikas illustriert: „Denn die wilden Völker verschiedener Gebiete Amerikas besitzen überhaupt keine Regierung, ausgenommen die Regierung über kleine Familien, deren Eintracht von der natürlichen Lust abhängt und die bis zum heutigen Tage auf jene tierische Weise leben, die ich oben beschrieben habe.“ Hobbes und mit ihm ein Großteil der nachfolgenden politischen Philosophen haben bevorzugt jene aus der Zeit der Eroberung Amerikas stammenden Beschreibungen indigener Gesellschaften übernommen und in ihre Überlegungen zum Naturzustand und zur Staatsbegründung überführt, die diese in fast jeder Hinsicht als defizitär und den europäischen Herrschaftsanspruch insofern als gerechtfertigt erscheinen ließen.
Dabei waren britische Kolonialbeamte wie Cadwallader Colden durch das Studium der benachbarten und als souveräne Verbündete betrachteten Haudenosaunee (Irokesen) schon im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts zum Ergebnis gekommen, dass bereits der Mensch des Naturzustands – anders als es die von Hobbes angestellten vertragstheoretischen Modellüberlegungen wollten – ein soziales Wesen sei.
Gelebte Selbstorganisation
Der einflussreiche schottische Moralphilosoph Adam Ferguson brachte diese Erkenntnis 1767 in seine eigene republikanisch ausgerichtete Theorie der bürgerlichen Gesellschaft ein: „Der Verkehr im Innern ihrer Gesellschaft“, schrieb er über die Gemeinwesen der heute wahlweise als American Indians, Native Americans oder First Nations bezeichneten Indigenen, „vollzieht sich ohne Polizei und Zwangsgesetze in geordneter Weise.“ Er schlussfolgerte aus dieser Beobachtung, „dass die Menschheit in ihrem einfachsten Zustand unmittelbar im Begriff steht, Republiken zu errichten. Ihre Liebe zur Gleichheit, ihre Gewohnheit, öffentliche Versammlungen abzuhalten, ihr Eifer für den Stamm, dem sie angehören, all dies sind Eigenschaften, die sie befähigen, unter jener Regierungsform zu leben.“
Eberl kommt daher zu dem Schluss, dass die in die Begründung des modernen Staates eingeflossene Naturzustandskonstruktion „kaum so etwas wie reale Gehalte“ hat, weil Menschen immer schon in einem sozialen, kulturellen Zustand lebten. Damit aktualisiert er insofern ein schlüssiges und empirisch belastbares Argument aus der angloamerikanischen Schule des republikanischen Denkens, die – zumindest was Europa betrifft – in der akademischen Philosophie und Politikwissenschaft bis heute eher eine Randexistenz fristet. Bis heute hat es dort die in der Ethnologie spätestens seit Marhall Sahlins‘ viel beachteter Studie „Stone Age Economics“ aus dem Jahr 1974 etablierte Einsicht schwer, dass die Mitglieder egalitärer Gesellschaften ohne Staat keineswegs ständig damit beschäftigt waren, um das pure Überleben zu kämpfen.
Noch weniger Beachtung hat die Politikwissenschaft bislang der Art und Weise geschenkt, in der in diesen Gesellschaften Entscheidungen getroffen und Konflikte gelöst wurden. Viele von ihnen fanden nämlich Mittel und Wege, um die Konzentration von Macht in einer Hand oder an einem zentralen gesellschaftlichen Ort so effektiv zu blockieren, dass so etwas wie ein Staat erst gar nicht entstehen konnte. Dass ein bedeutender Teil der heutigen Sozialwissenschaft und Philosophie hierin keine politischen Strukturen erkennen will, urteilt Eberl, „ist ein Beitrag zum Kolonialismus.“
Sein eigenes sehr ambitioniertes, aber gleichwohl plausibles Vorhaben besteht nun darin, „das Verhältnis politischer Theorie zum Staat neu zu justieren.“ Viele Konflikte um sogenannte ethnische Minderheiten könnten womöglich entschärft werden, wenn deren Autonomiebestrebungen durch eine völkerrechtliche Anerkennungspraxis unterstützt würden. Auch würden die Chancen und Grenzen eines von außen forcierten Nation Building, wie es zuletzt in Afghanistan gescheitert ist, besser eingeschätzt werden können, wenn man die Eigenarten ethnischer Selbstorganisation in Rechnung stellte, die in vielen nichtwestlichen Gesellschaften auf lokaler und regionaler Ebene nach wie vor wirksam sind bzw. sich neu herausbilden, wenn staatliche Strukturen sich als dysfunktional erweisen.
Die repressive Seite des Staates begrenzen
Nach wie vor spielen die verschiedenen Formen der Selbstorganisation, die Gesellschaften ohne Staat entwickelt haben und zum Teil bis heute praktizieren, in der politikwissenschaftlichen Komparatistik so gut wie keine Rolle. Dabei hatte der spätere US-Präsident John Adams in seiner Schrift „Defence of the Constitutions of Government of the United States of America“ schon 1787 eine vergleichende Untersuchung der verschiedenen Gesetzgebungsverfahren indigener Gesellschaften in Amerika angeregt. Warum? Weil er glaubte, daraus für die Gestaltung der politischen Institutionen der neu geschaffenen Republik etwas lernen zu können.
Sollte Eberl sein Projekt weiterverfolgen und eine Demokratietheorie entwickeln, mit deren Hilfe sich die repressive Seite des Staates besser begrenzen lässt, als das heute selbst in liberalen Demokratien der Fall ist, könnte er in der republikanischen Tradition der USA auf Vorläufer stoßen, die es sich auszuwerten lohnte.
Er muss sich dafür ja nicht buchstabengetreu an jene Empfehlung halten, die der seinerzeitige US-Gesandte in Paris, Thomas Jefferson, seinem politischen Vertrauten James Madison in einem Brief vom 30. Januar 1787 mit auf den Weg gab, als ihn auf der anderen Seite des Atlantiks Nachrichten über Volksaufstände in den Neuenglandstaaten erreichten: „Ich glaube, dass ab und zu ein kleiner Aufstand sein Gutes hat, er ist in der Politik genauso nötig wie ein Gewitter in der Natur.“ Republikanische Herrscher, ergänzte er, sollten daher bei ihrer Bestrafung der Aufständischen so milde gestimmt sein, „dass die abschreckende Wirkung nicht zu groß ist. Denn sie sind eine für die Gesundheit eines politischen Systems unerlässliche Medizin.“ In seinen 1785 erschienenen „Notes on the the State of Virginia“ hatte Jefferson seinen republikanischen Mitbürgern vorgeschlagen, sich von ihren indigenen Nachbarn etwas abzuschauen: „Es wird gesagt werden, dass große Gesellschaften nicht ohne Regierung existieren können. Die Wilden zerbrechen sie deshalb in kleine.“
Oliver Eberl, Naturzustand oder Barbarei. Begründung und Kritik staatlicher Ordnung im Zeichen des Kolonialismus, Hamburger Edition, 552 Seiten, 40 Euro.










