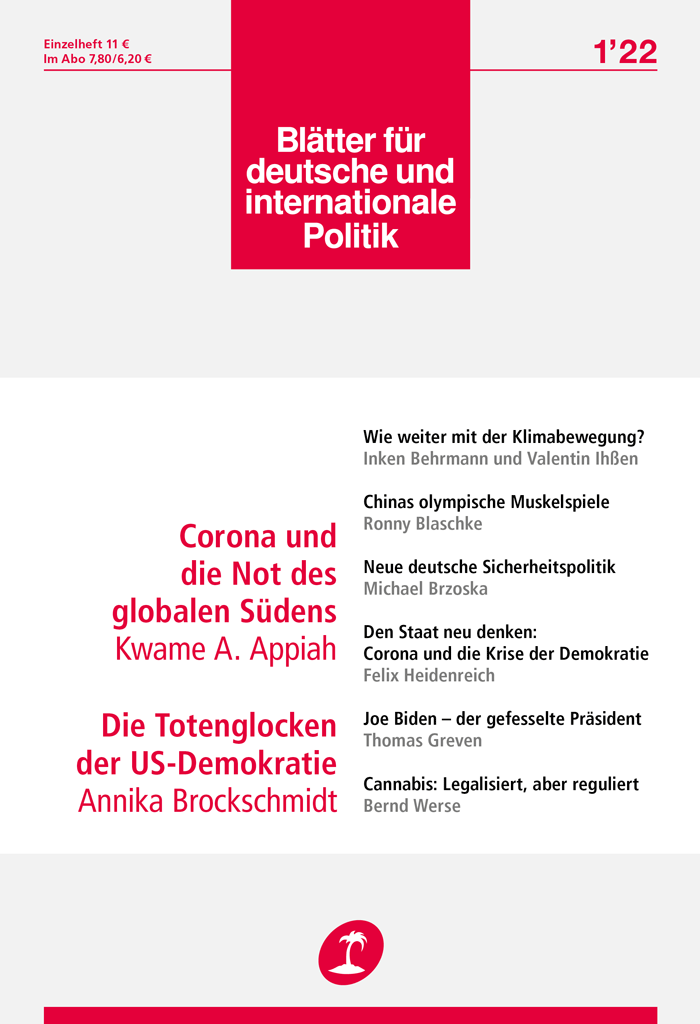Bild: Bauarbeiterfigur auf dem Schriftzug »Hartz IV« (IMAGO / imagebroker)
Anstelle der bisherigen Grundsicherung (Hartz IV) werden wir ein Bürgergeld einführen. Das Bürgergeld soll die Würde des und der Einzelnen achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen sowie digital und unkompliziert zugänglich sein. Wir gewähren in den ersten beiden Jahren des Bürgergeldbezuges die Leistung ohne Anrechnung des Vermögens und anerkennen die Angemessenheit der Wohnung. Wir werden das Schonvermögen erhöhen und dessen Überprüfung entbürokratisieren, digitalisieren und pragmatisch vereinfachen.“ Mit diesen vier Sätzen auf Seite 75, Zeilen 2472 bis 2478 des Koalitionsvertrages versucht die SPD, Hartz IV mit seinen brutalen Härten hinter sich zu lassen – jedenfalls in (allerdings in der Höhe unbezifferter) finanzieller Hinsicht. Dahinter verbirgt sich die Hoffnung, endlich den historischen Fehler von einst vergessen zu machen, endlich wieder solidarisch und links zu sein. Und dafür auch in Zukunft gewählt werden.
Doch allein mit diesen Regelungen wird es nichts werden. Denn mit lediglich mehr Geld – ob 5,50 oder 500 Euro – wird Hartz IV eher zementiert als aufgelöst. Mehr Geld ist ein im Wesentlichen paternalistischer Ansatz, der die Zeit für die Langzeitbetroffenen in Hartz IV zwar etwas angenehmer macht, aber keineswegs beendet. Doch genau darum muss es gehen. Das eigentliche Ziel muss sein, jene Probleme zu lösen, die dem Weg in den Job entgegenstehen. Und dazu zählt weniger fehlendes Geld als vielmehr psychische Erkrankungen, Schulden, Sucht – und zudem Strukturen, die diese Barrieren tabuisieren oder ignorieren. Die Fakten: Laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist mindestens jeder dritte Hartz-IV-Empfänger psychisch krank. Und das sind nur die mit ärztlicher Diagnose – die Dunkelziffer derer, die ihre Krankheit nicht kennen oder anerkennen, dürfte hoch sein. Zu den Krankheiten zählen Angststörungen, Depressionen, bipolare Störungen, kurzum: der ganz normale Wahnsinn.
Psychisch krank schon vor Hartz IV
Die häufig formulierte Schlussfolgerung, dass die Bedingungen von Hartz IV eben psychisch krank machten, trifft die Lage dabei nur bedingt. Die meisten Menschen waren schon vor Hartz IV psychisch krank; genau das hat sie arbeitslos gemacht, nicht umgekehrt. Denn schließlich leiden bis zu 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland innerhalb eines Jahres unter einer psychischen Erkrankung – das ergab die letzte große Studie des Robert-Koch-Instituts zur „Gesundheit Erwachsener in Deutschland“ im Jahr 2014.
Während jedoch Erwerbstätige mit psychischen Problemen mal zeitweilig ausfallen und zu einem Arzt gehen, bedeutet eine psychische Erkrankung in der Arbeitslosigkeit einen Fahrstuhl ins Aus. Wer schon im Arbeitslosengeld I (ALG I) nicht aus seiner Krankheit herausfindet, wenn das soziale und finanzielle Netz noch annähernd stabil ist, verliert bei Hartz IV oft völlig den Halt.
Denn die Beschäftigten der bundesweit 406 Jobcenter, die die Arbeitslosen betreuen, sind für die Erkennung psychischer Krankheiten weder ausgebildet, noch haben sie Zeit dafür. Die Vermittlung in Arbeit hat hier immer noch Vorrang. Tatsächlich formuliert das Sozialgesetzbuch II die Integration in Arbeit bisher als oberstes Ziel der Jobcenter. Entsprechend orientiert sich die Personalausbildung und -ausstattung in den Jobcentern am Ziel der Arbeitsmarktintegration. Nur sogenannte „Fallmanager“ erhalten eine besondere Ausbildung für Menschen mit vielen und schwierigen Problemen. Von den Arbeitslosen wird grundsätzlich erwartet, dass sie vor allem mit hoher Eigeninitiative daran mitarbeiten, die Arbeitslosigkeit möglichst schnell zu beenden.
Selbst wenn die Erkrankung im Jobcenter erkannt wird, entsteht in der nächsten Stufe nicht die Frage, wie kommt der Betroffene an eine Therapie, sondern: Kann er oder sie arbeiten? Denn auch mit einer – mitunter schweren – psychischen Erkrankung gelten erwachsene ALG-II-Beziehende meist erst einmal als erwerbsfähig. Er oder sie soll vorrangig in Arbeit vermittelt werden, so will es bisher das Gesetz.
Streitpunkt Erwerbsfähigkeit
Zentrale Ursache ist die Schwelle für Erwerbsfähigkeit in Deutschland: Als erwerbsfähig gilt, wer sofort oder absehbar – das heißt innerhalb der nächsten sechs Monate – auf dem normalen Arbeitsmarkt drei Stunden am Tag arbeiten kann. Wer also in sechs Monaten einen Depressionsschub überstanden hat, ist damit per definitionem erwerbsfähig, selbst wenn der nächste Schub schon wartet. Oder um es mit der Rentenversicherung zu sagen, wenn sie Anträge des Jobcenters für psychisch Erkrankte ablehnt: Es gilt der aktuelle Gesundheitszustand. Im internationalen Vergleich ist diese Grenze niedrig und zudem wissenschaftlich hoch umstritten.
In Deutschland ist die Diagnose Erwerbsfähigkeit für alle beteiligten Behörden zentral. Denn ist der Mensch es nicht oder nur eingeschränkt, kommen andere Sozialgesetzbücher zum Zuge – und damit muss eine andere, dafür zuständige Behörde für Kosten aufkommen, wie die Sozialhilfe, Rehabilitation oder Rente. So streiten sich Jobcenter und Rentenversicherung regelmäßig darüber, wer „erwerbsfähig“ ist und wer nicht, wer also arbeiten muss oder Rente bezieht.
Die meisten psychisch Kranken wollen aber ohnehin nicht frühverrentet werden, sondern arbeiten, wie die Forscher des IAB in ihrer Befragung herausfanden. Sie können es und sie wollen es; sie sehen Erwerbstätigkeit als Teil eines normalen Lebens, das sie unbedingt erreichen wollen. Doch dafür brauchen sie Unterstützung: nicht mit mehr Bürgergeld, sondern vor allem mit medizinischer Hilfe.
Für diese Unterstützung fehlt aber eine systematische Zusammenarbeit der Jobcenter mit Fachkliniken, es fehlen Therapieplätze und Arbeitgeber, die mit psychischen Erkrankungen umgehen können. Schon der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen konstatierte 2018, dass das Versorgungssystem für psychisch Kranke „selbst für Fachleute nicht in allen Aspekten übersichtlich ist“.[1] Das IAB nennt die Angebotspalette eine „schiere Überforderung psychisch Kranker mit dem Dschungel der Zuständigkeiten und Einrichtungen“.[2]
Zwar gibt es für die Jobcenter Unterstützungsangebote, um festzustellen, ob und wie krank ein Betroffener ist. Dazu zählen der Ärztliche Dienst der Bundesagentur, der berufspsychologische Dienst, die Gesundheitsämter, die sozialpsychologische Beratung der Kommunen oder auch Haus- und Fachärzte. Doch allein die unübersichtliche Zahl von nicht aufeinander abgestimmten Anlaufstellen mit unterschiedlichen Bewertungen und Zuständigkeiten ist oft mehr Problem als Lösung.
In einigen wenigen Jobcentern hat man deswegen eine eigene Lösung gesucht: Das psychosoziale Coaching direkt im Jobcenter, mit klinisch geschulten Psychologen, bestenfalls angebunden an eine Klinik vor Ort. Diese Beratung wurde 2011 in Leipzig als Modellprojekt von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe entwickelt. Arbeitslose, aber auch Vermittlungskräfte können sich hier direkt im Jobcenter Beratung holen. Für die betroffenen Arbeitslosen sind die Coachs vor allem Lotsen im Dschungel der Möglichkeiten.
Solche Kooperationen fordern auch die Forscher des IAB in Nürnberg – und die OECD. In der 2015 erstellten Studie mit dem Titel „Fit Mind, Fit Job“ fordert die Organisation mehr Zusammenarbeit aller zuständigen Institutionen und eine möglichst frühe Intervention und Behandlung dieser Krankheiten. Das Coaching-Modell aus Leipzig wird dabei im Bericht lobend erwähnt.
Laut Stiftung Deutscher Depressionshilfe ist diese professionelle Begleitung in den Jobcentern oft erfolgreich; es wird in Fällen geholfen, die längst als hoffnungslos galten. Trotz dieser Erfolge gibt es das Coaching für psychisch Kranke bundesweit nur in wenigen Jobcentern. Der Grund: Mit dem Angebot bewegen sich die Behörden bisher auf rechtlich unsicherem Gelände, weil diese Beratung keine klassische Arbeitsmarktmaßnahme ist. Das macht die Finanzierung schwierig: Wer kommt für die Kosten auf? Im besten Fall zweigt eine Geschäftsführung die erforderliche Summe aus irgendeinem Etat ab, als befristetes Projekt, mit hohem Risiko, dass es mangels rechtlich solider finanzieller Basis nach seiner Zeit eingestampft wird.
Doch selbst wenn mehr Jobcenter eine solche Beratung im Haus hätten, an einem späteren Punkt sind sie wieder hilflos: Wenn es nämlich darum geht, dass die Betroffenen sich einen externen Therapieplatz suchen sollen. Vor allem bei der häufig indizierten ambulanten Therapie sind die Wartezeiten sehr lang – und die Pandemie hat die Situation noch verschärft. Zudem sind psychisch Kranke – Arbeitslose insbesondere – oft mit einer intensiven Suche überfordert.
Und wenn auch das mal klappt, ist wiederum die Aussicht auf einen Arbeitsplatz schlecht: Lediglich zehn Prozent psychisch Kranker haben einen regulären Arbeitsplatz, konstatiert das IAB. Die Ansprüche an Geschwindigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität auf dem regulären Arbeitsmarkt lassen wenig Raum für diese Menschen, die immer wieder durch Krisen gehen. Wer eine Arbeit hat, kann mittlerweile besser von seiner Depression, seiner Angststörung sprechen – bei Arbeitslosigkeit bleibt es ein strenges Tabu. Nicht nur für den Einzelnen: Kein Jobcenter, keine Arbeitsagentur spricht offen über den hohen Anteil psychischer Erkrankungen, um nicht den ohnehin Stigmatisierten eine zusätzliche Bürde in der Vermittlung mitzugeben. Denn Arbeitgeber sind auf den Umgang mit diesen Beschäftigten in der Regel nicht vorbereitet: Was sollen sie tun, wenn jemand in einer Krise ausfällt? Was dürfen sie überhaupt tun?
Baustellen für die Hartz-IV-Politik der Zukunft
Ähnliches gilt für Suchterkrankungen und Schulden: Eine Hartz-IV-Erhöhung nützt wenig, wenn Schulden wie Dämonen im Raum stehen und nachweislich psychisch belasten. Rund sechs Millionen Menschen waren 2021 laut Creditreform überschuldet. Die wenigsten werden von den chronisch unterfinanzierten Schuldnerberatungen aufgefangen.
Von diesen gewaltigen Baustellen findet sich wenig im neuen Koalitionsvertrag. Wolkig wird nur angekündigt, dass die Schuldner- und Insolvenzberatung ausgebaut werden soll. Jede Windkraftplanung ist hier detaillierter.
Es könnte zwar leichter werden, einen Arbeitslosen in eine Weiterbildung zu vermitteln statt in den nächsten Niedriglohnjob: Der Vorrang, in Arbeit zu vermitteln, soll fallen. Auch sollen die Jobcenter mehr Gestaltungsfreiheit bekommen, sie dürfen künftig auch „Instrumente anderer Sozialgesetzbücher“ nutzen. Doch das alles zusammen ist nicht mehr als die alte Stellschraubenpolitik: Hier ein wenig mehr Geld, dort ein Instrument freigeben – die Geschichte des SGB II wimmelt von solchen Versuchen, ohne dass der Sockel schwerst Vermittelbarer wirklich schwindet. Vor allem ändert eine solche Politik nichts an dem Dschungel der Sozialgesetzbücher, mittels derer auf dem Rücken der Betroffenen mit viel Bürokratie darum gezankt wird, wer wofür zuständig ist und wer was genehmigen und bezahlen darf.
Ganz vorne bei diesen Sozialgesetzbüchern: die unselige Trennung zwischen Hartz IV (SGB II) und ALG I (SGB III). Säuberlich werden hiermit die Arbeitslosen seit 2005 getrennt: Wer Hartz IV bezieht, muss meist zu einem anderen Gebäude, trifft andere Vermittlerinnen und Vermittler, bekommt andere Angebote, lebt mit anderen Gesetzen und füllt andere Formulare aus als „normale“ Arbeitslose. Auch wenn Hartz IV zukünftig Bürgergeld heißt, bleibt genau diese Trennung bestehen. Damit bleibt aber auch das Stigma, mit dem Hartz-IV-Empfänger behaftet sind – und die Diskriminierung.
Sachlich aber ist die institutionelle Trennung nicht nachvollziehbar. Denn eigentlich sind sich die Arbeitslosen diesseits und jenseits von Hartz IV oft ähnlich, nicht nur in dem gemeinsamen Ziel, eine Arbeit zu finden: Auf beiden Seiten gibt es Langzeitarbeitslose, die länger als ein Jahr Arbeit suchen. Auf beiden Seiten gibt es Armut: Rund 170 000 Menschen bezogen beispielsweise im September 2021 weniger als 700 Euro ALG I. Tausende müssen jeden Monat mit Hartz IV aufstocken, weil das ALG I zu niedrig ausfällt. Allen voran betrifft das Frauen, die ihren niedrig bezahlten Teilzeitjob verloren haben. Im ALG I landen ebenso psychisch Kranke und Alkoholiker wie in Hartz IV, so wie Studierende nach ihrem Abschluss, wenn sie während des Studiums nicht sozialversicherungspflichtig gearbeitet haben, oder Selbstständige, die gescheitert sind. Wer in dieses sehr deutsche, sehr fein ziselierte System nur mehr Geld, Namensänderungen, ein wenig Bürokratieabbau und etwas Instrumentenfreiheit pumpt, verfestigt diese Diskriminierung, statt zu schauen, wer welches und wie viel Geld und wann welche Hilfe braucht.
An diese Großbaustelle der versäulten Sozialgesetzbücher hat sich die Koalition schlicht nicht herangewagt. Stattdessen begünstigt man lieber noch mal die, die ohnehin mehr haben als die anderen: Künftig soll das Schonvermögen der Hartz-IV-Beziehenden angehoben werden, plant die Koalition. Dabei wurde 2021 gerade einmal in 945 von 1,6 Millionen untersuchten Fällen[3] nachgewiesen, dass mehr Vermögen als erlaubt vorhanden war. Das wäre dann die ungefähre Zahl der Profiteure dieser großherzigen Ankündigung. Mit diesen Maßnahmen hat man, wie schon bewährt in 16 Jahren, erneut bloß Tünche aufgetragen. Das Hartz-IV- oder nun Bürgergeld-System bleibt damit am Ende das, was es ist: zutiefst ungerecht, ineffektiv und diskriminierend.
[1] Vgl. das Gutachten „Bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung“, 2018, S. 683.
[2] Frank Oschmiansky u.a., Psychisch Kranke im SGB II: Situation und Betreuung, IAB-Forschungsbericht 14/2017, https://doku.iab.de.
[3] Thomas Öchsner, Die meisten Hartz-IV-Empfänger sind ehrlich, www.sueddeutsche.de, 7.9.2021.