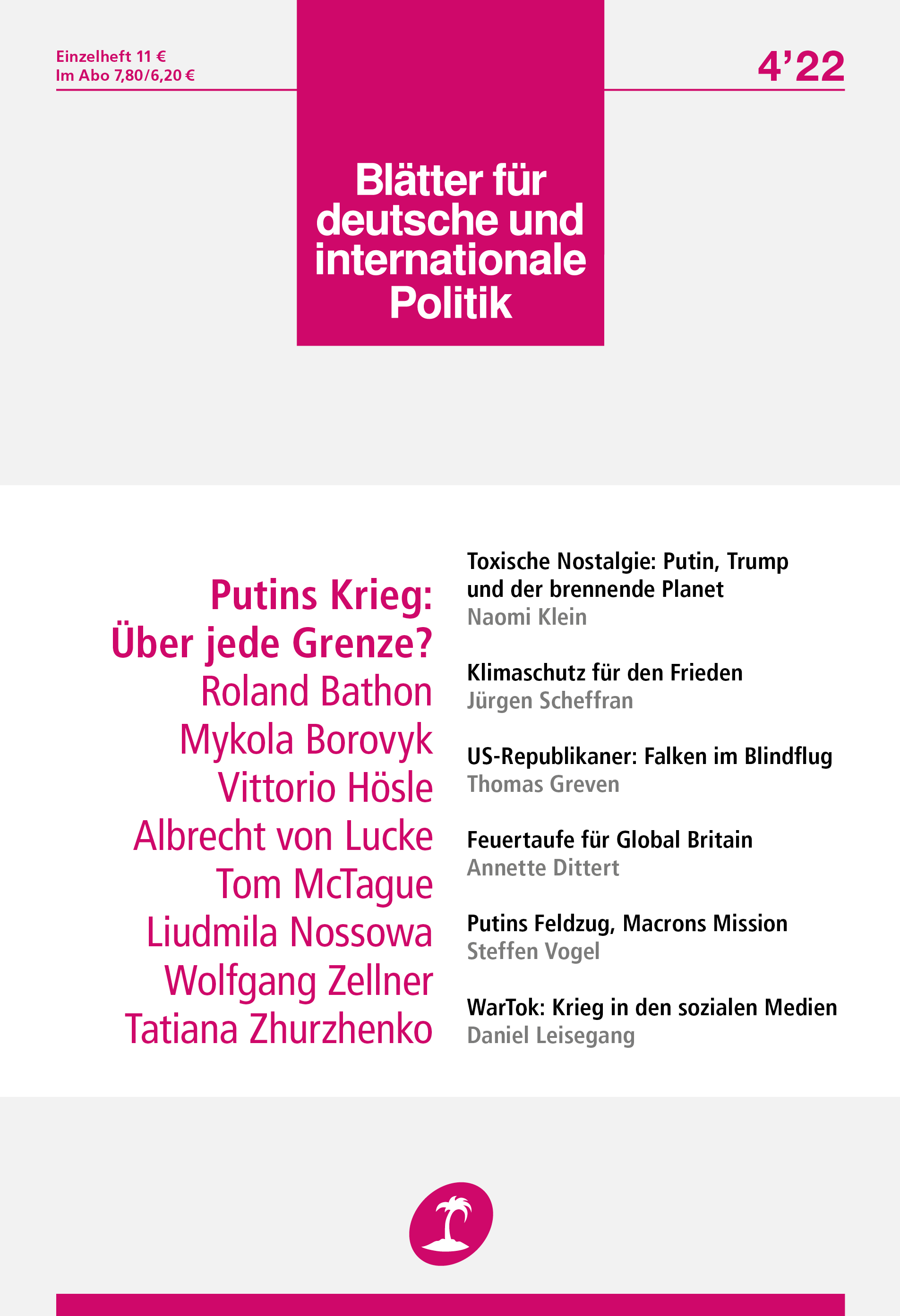Bild: Paulo Sousa
Gerade einmal 120 Euro erhielt ein Schweinemäster zuletzt, wenn er ein Tier am Schlachthof ablieferte. Ein Betrag, mit dem er noch nicht einmal die Kosten für Ferkelankauf, Futter und Energie decken kann, geschweige denn, sich und seine Familie ernähren oder gar in neue Ställe und mehr Tierschutz investieren. Aus gutem Grund also hob Cem Özdemir dieses sich seit Jahren zuspitzende Marktversagen auf die Agenda: Gleich in den ersten Interviews nach seiner Ernennung sagte der neue Landwirtschaftsminister „Ramschpreisen“ bei Lebensmitteln den Kampf an. Indem er sie – wie auch immer – abschaffen möchte, will Özdemir die prekäre Lage vieler Bäuerinnen und Bauern verbessern.[1]
Das Echo in Form eines Aufschreis der Sozialverbände folgte jedoch prompt und ist angesichts der Aussicht auf höhere Lebensmittelpreise wenig verwunderlich. Es verhallte nicht ungehört. Bereits in seiner wenig später gehaltenen Antrittsrede im Bundestag adressierte Özdemir das andere Ende der Lieferkette mit – das der Verbraucher*innen. Es gehe ihm darum, „gute Sozialpolitik zu machen und gute Landwirtschaftspolitik“, ausdrücklich mit keinem „oder“, sondern einem „und“ dazwischen. „Alle“, betonte der Minister, müssten „hochwertige und bezahlbare Lebensmittel bekommen“.[2] Für ein so reiches Land wie die Bundesrepublik formuliert der Grünen-Politiker damit vermeintlich Selbstverständliches. Doch deutet in all seinen Äußerungen wenig darauf hin, dass er die ganze Dimension eines vollkommen unterschätzten sozialen Problems bereits erfasst hat – eines Problems, das schon seit langem existiert. Denn bereits heute sind viele Menschen hierzulande auf die vielgescholtenen Ramschpreise geradezu angewiesen. Mehr noch: Selbst diese sind für sie noch zu hoch.
Ungleichheit und Hunger
Bereits seit langem warnt etwa die Soziologin Sabine Pfeiffer davor, dass mit der Ernährungsarmut „eine Dimension sozialer Ungleichheit“ zurückkehre, „die seit den frühen Nachkriegsjahren als überwunden galt“.[3] Vor eineinhalb Jahren verlieh sogar der Wissenschaftliche Beirat in Özdemirs Bundesernährungsministerium – noch unter Vorgängerin Julia Klöckner – den Warnungen Nachdruck:[4] „Auch in Deutschland gibt es armutsbedingte Mangelernährung und teils auch Hunger“, was für Kinder ein „manifestes Entwicklungsrisiko“ darstelle, brachte das hochkarätig besetzte Gremium den gravierenden Missstand auf den Punkt. In der politischen Debatte aber kam das Thema nicht an: Die Große Koalition legte das Gutachten zu den Akten, und auch die Ampelparteien schweigen sich in ihrem Koalitionsvertrag zum Thema aus.
Kulinarische Klassengesellschaft
Dessen ungeachtet belegt die Sozial- und Ernährungsforschung, dass dringender Handlungsbedarf besteht: Schätzungen zufolge betrifft Ernährungsarmut mindestens fünf Prozent der Menschen in Deutschland. Es lohnt ein näherer Blick – vor allem auf die ebenfalls greifbaren Folgen.
Fest steht: Menschen mit geringem Einkommen ernähren sich schlechter, verzehren vor allem weniger Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und Pilze als Wohlhabendere.[5] Geld ist freilich nicht der einzige Grund, an dem eine ausgewogene Ernährung scheitert, allerdings bildet ein gewisses Budget die notwendige Voraussetzung dafür. Denn eine gesundheitsfördernde Lebensmittelauswahl ist teurer als eine kaloriendichte Kost, zu der greift, wer für wenig Geld vor allem satt werden möchte.
Viele Studien konnten dies belegen, ebenso den Umstand, dass eine gesunde Ernährung mit Hartz IV nicht zu bezahlen ist: Während die Regelsätze heute für einen Erwachsenen rund 5 Euro am Tag für Nahrung und alkoholfreie Getränke vorsehen, bezifferte eine Untersuchung die Kosten einer empfehlenswerten „Vollwertkost“ auf gut 7,50 Euro. Das war jedoch bereits vor 15 Jahren.[6] Seither sind die Lebensmittelpreise deutlich gestiegen.
Die Erfahrung von Menschen in Armut, dass am Ende des Geldes noch reichlich Monat übrig ist, hat also einen fundierten wissenschaftlichen Hintergrund. Viele Hartz-IV-Beziehende – darunter zahlreiche alleinerziehende Mütter – sehen sich systematisch dazu gezwungen, den Kauf von frischem Obst und Gemüse spätestens im Laufe des Monats einzuschränken. Stattdessen landen sie bei kalorienreichen Fertiggerichten sowie vor allem bei Nudeln und Kartoffeln – also bei Lebensmitteln, die nicht schlecht, aber arm an Vitaminen und Mineralien sind. Sie vertreiben den Hunger, lassen aber einen „verborgenen Hunger“ nach wichtigen Nährstoffen zurück, wie es Wissenschaftler*innen bezeichnen.
Es geht um Lebenschancen von Kindern
Während die bereits genannten umfassenden staatlichen Studien das Ernährungsverhalten der Menschen in Deutschland detailreich analysierten, ließen sie die soziale Dimension auf beinahe groteske Weise außen vor: Armutsbetroffene wurden unterrepräsentiert, zum Teil sogar ausgeklammert, sozioökonomische Daten zwar erhoben, aber nicht näher ausgewertet. „Weil nicht sein kann, was nicht sein darf“, wie der Hohenheimer Wissenschaftler Hans Konrad Biesalski, einer der führenden Ernährungsmediziner des Landes, vermutet. So wissen wir zwar, dass Kinder im Durchschnitt von manchem wichtigen Nährstoff signifikant weniger aufnehmen als empfohlen. Welche Kinder dies genau betrifft, weisen die Studienberichte nicht aus. Allerdings liegt der Schluss nahe, dass in Armut aufwachsende Kinder auch diejenigen sind, die häufiger und stärker als andere von einer Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralien betroffen sind.
Besonders beunruhigt zeigen sich Ernährungsmediziner darüber, dass es den Heranwachsenden insbesondere an jenen Nährstoffen mangelt, die für eine gesunde körperliche wie kognitive Entwicklung zentral sind. Spätestens damit aber wird offensichtlich, dass Ernährungsarmut kein Luxusproblem ist: Es geht um nicht weniger als die Lebenschancen von Kindern.
Eine 2008 publizierte Langzeituntersuchung warnte bereits vor den gravierenden Folgen von Ernährungsarmut. Für ihre Studie werteten Wissenschaftler*innen über Jahre hinweg die Daten von mehr als 250 000 Schuleingangsuntersuchungen aus Brandenburg aus. Ihr schockierendes Ergebnis: Kinder aus schlechter situierten Familien waren im Schnitt signifikant kleinwüchsiger und geistig weniger weit entwickelt als Gleichaltrige aus wohlhabenderem Elternhaus.[7] Dass die Ernährung dafür eine bedeutende Rolle spielt, halten sie für gesetzt: Denn sowohl körperliches Wachstum als auch die Leistungsfähigkeit bestimmter Gehirnregionen hängen wesentlich von einer ausreichenden Versorgung mit Nährstoffen ab. 2020 wiesen Soziologen zudem nach, dass – abhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern – bereits bei halbjährigen Säuglingen deutliche Leistungsunterschiede bestehen.[8] Die Schere öffnet sich also nicht erst in der Schule, sondern bereits lange davor, just in einem Zeitfenster, in dem neben der elterlichen Sorgearbeit die Nahrungsversorgung eine besonders prägende Rolle für die Entwicklung spielt.
Trotz bestehender Datenlücken deutet also alles darauf hin, dass sich im reichen Deutschland eine regelrechte Armutsspirale dreht: Menschen in Armut fehlt das Geld für eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder. Diese tragen ein höheres Risiko für eine Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen, haben damit geringere Chancen auf eine gesunde Entwicklung und Bildungserfolge – was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie auch als Erwachsene in Armut leben und es damit schwerer haben werden, ihre eigenen Kinder gesund zu ernähren. Oder kurz gesagt: Armut schafft Mangelernährung und Mangelernährung schafft Armut.
Das Menschenrecht auf Nahrung ist gefährdet
Freilich kann (und sollte) ein Staat nicht dafür sorgen, dass alle Menschen sich und ihre Kinder auch tatsächlich gesund ernähren. Allerdings muss er die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie zumindest dazu in der Lage sind. Eine Politik, die dies ignoriert, negiert das Menschenrecht auf Nahrung. Zu dessen Kernbestandteil gehört die Ernährungssicherheit, die erst dann erfüllt ist, wenn alle Menschen zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, sich ausreichend bedarfsgerechte Nahrung zu beschaffen. Dieser offiziellen Definition folgend, ist Deutschland ein Land ohne Ernährungssicherheit.
Bereits das Bekenntnis zu zentralen Menschenrechten verpflichtet die politisch Verantwortlichen also zum Handeln. Sie verweigern dies jedoch mit bemerkenswerter Ignoranz: Ihr Konzept des so genannten Existenzminimums erhebt erst gar nicht den Anspruch, dass Menschen nicht nur satt werden, sondern auch gesund leben, Kinder sich optimal entwickeln und damit ihre Lebenschancen möglichst groß ausfallen können. Die zynische Realität ist es vielmehr, dass der Geldbedarf für eine gesunde Ernährung bei der Festlegung der Hartz-IV-Sätze schlichtweg keine Rolle spielt. Er wird nicht einmal ermittelt.
Stattdessen wird ausschließlich zugrunde gelegt, wie viel Geld Einkommensschwache in der Vergangenheit de facto für Lebensmittel ausgaben. Menschen in Armut wird heute also nur so viel Geld für Essen zugestanden, wie es andere Arme gestern zur Verfügung hatten, also zu wenig. Diese Logik, nach der ein Mensch allein deshalb kein ausgewogenes Essen braucht, weil er sich ja auch in der Vergangenheit keines leisten konnte, wird eisern verteidigt. So antwortete das SPD-geführte Bundessozialministerium im März 2021 auf eine Parlamentarische Anfrage: Die von Wissenschaftler*innen erhobenen Ansprüche, denen zufolge das Geld nicht nur zum Sattwerden, sondern auch zum Gesundbleiben reichen sollte, „können [...] nicht im Rahmen der Regelbedarfsermittlung berücksichtigt werden“.[9] Diese Verweigerungshaltung ist hausgemacht. Denn eine Regierungsmehrheit könnte dies durchaus ändern, nur entschieden sich die Koalitionen der vergangenen Jahre dazu, das zu unterlassen.
»Nur wer arbeitet, soll auch essen«
Damit manifestiert die Ernährungsarmut von heute auch jene von morgen, mit all den dramatischen Folgen vor allem für Kinder. Die jüngst vom Bundestag beschlossene Anhebung der Hartz-IV-Sätze um ganze 0,76 Prozent zum 1. Januar 2022 lindert keine Not, da die Lebensmittelpreise binnen der zwölf Monate zuvor um fünf Prozent gestiegen waren; Obst und Gemüse sind noch einmal deutlich teurer geworden.
Die großen Krisen tun ihr Übriges: Die Corona-Pandemie schränkte kostenlose Essensangebote ein und brachte zusätzliche Menschen in Armut und Putins Krieg gegen die Ukraine wird ebenfalls Folgen für die Lebensmittelversorgung und -preise zeitigen, derweil die steigenden Energiekosten den wirtschaftlichen Druck auf Menschen in Armut zusätzlich noch von anderer Seite erhöhen.
Ungeachtet der Frage, ob „Ramschpreise“ überhaupt eine wesentliche Ursache für die prekäre Lage der Bauernhöfe sind: Cem Özdemir steht vor einer gewaltigen Herausforderung, um seinen Anspruch – gesunde Lebensmittel für alle – zu verwirklichen. Noch etwas kommt hinzu: Was Özdemir verspricht, kann er allein nicht halten.
Eine gesundheitsfördernde Ernährungspolitik, die niemanden zurücklässt, muss ressortübergreifend gestaltet werden und allen wenigstens ein angemessenes Budget für eine gesundheitsfördernde Ernährung garantieren. Dafür braucht der Landwirtschaftsminister vor allem seinen Kabinettskollegen Hubertus Heil an seiner Seite – ausgerechnet jenen Arbeits- und Sozialminister also, der in der vergangenen Legislaturperiode noch dafür verantwortlich war, dass die Große Koalition trotz pointierter Gutachten ihre Augen vor der Ernährungsarmut verschloss.
Diese Ignoranz steht in einer langen Tradition. Ungeschönt brachte sie vor einigen Jahren der damalige Bundesarbeitsminister und frühere SPD-Chef Franz Müntefering auf den Punkt: „Nur wer arbeitet, soll auch essen“, lautete dessen zynisches Credo.[10] Man möchte hinzufügen: Es müsste schon ein besser bezahlter Job sein, wenn dabei auch ein gesundes Essen auf den Tisch kommen soll.
[1] Vgl. Özdemir gegen Ramschpreise für Lebensmittel, www.zdf.de, 26.12.2021 sowie: Matthias Wolfschmidt, Grüne Agrarwende: Das Ende der Ramschpreise?, in: „Blätter“, 2/22, S. 13-16.
[2] Vgl. Plenarprotokoll 20/12 des Deutschen Bundestages, Stenografischer Bericht, 14.1.2022, https://dserver.bundestag.de.
[3] Sabine Pfeiffer, Tobias Ritter und Elke Oestreicher, Kapitel 20: Armutskonsum. Ernährungsarmut, Schulden und digitale Teilhabe, in: Forschungsverbund Sozioökonomische Berichterstattung (Hg.), Berichterstattung zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland. Exklusive Teilhabe – ungenutzte Chancen, Bielefeld 2019, S. 717-749, www.wbv.de.
[4] Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Politik für eine nachhaltigere Ernährung: Eine integrierte Ernährungspolitik entwickeln und faire Ernährungsumgebungen gestalten – Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz (WBAE), Juni 2020, www.bmel.de.
[5] Robert-Koch-Institut, EsKiMo II – Die Ernährungsstudie als KiGGS-Modul, Berlin 2021, https://edoc.rki.de sowie Max Rubner-Institut, Nationale Verzehrstudie II, Ergebnisbericht Teil 2, Karlsruhe 2008, www.mri.bund.de.
[6] Eva Mertens und Ingrid Hoffmann, Lebensmittelkosten bei verschiedenen Ernährungsweisen, www.ernaehrungs-umschau.de, 18.11.2007.
[7] Joerg Baten und Andreas Böhm, Trends of children’s height and parental unemployment: A large-scale Anthropometric Study on Eastern Germany, 1994-2006, CESifo Working Paper No. 2189, Category 3: Social Protection, Januar 2008, https://papers.ssrn.com.
[8] Jan Skopek und Giampiero Passaretta, Socioeconomic Inequality in Children’s Achievement from Infancy to Adolescence: The Case of Germany, September 2021, https://academic.oup.com.
[9] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Antworten auf schriftliche Fragen im März 2021, Arbeitsnummern 205 und 206, 18.3.2021, www.sven-lehmann.eu.
[10] Vgl. Katharina Schuler, Arbeiten fürs Essen, www.zeit.de, 17.5.2006.