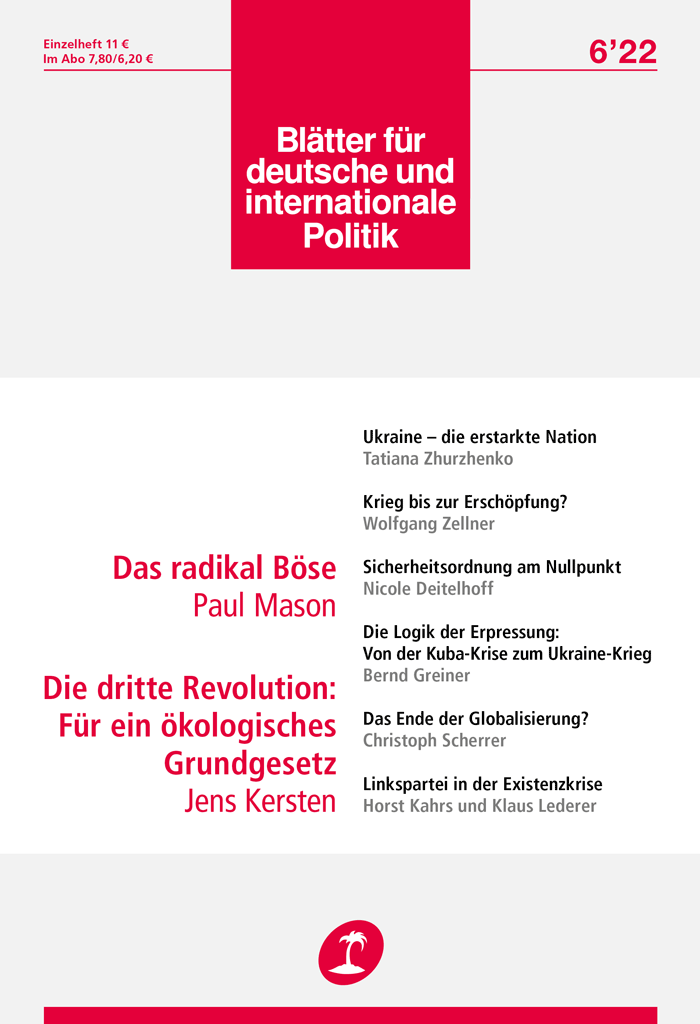Plädoyer für ein ökologisches Grundgesetz
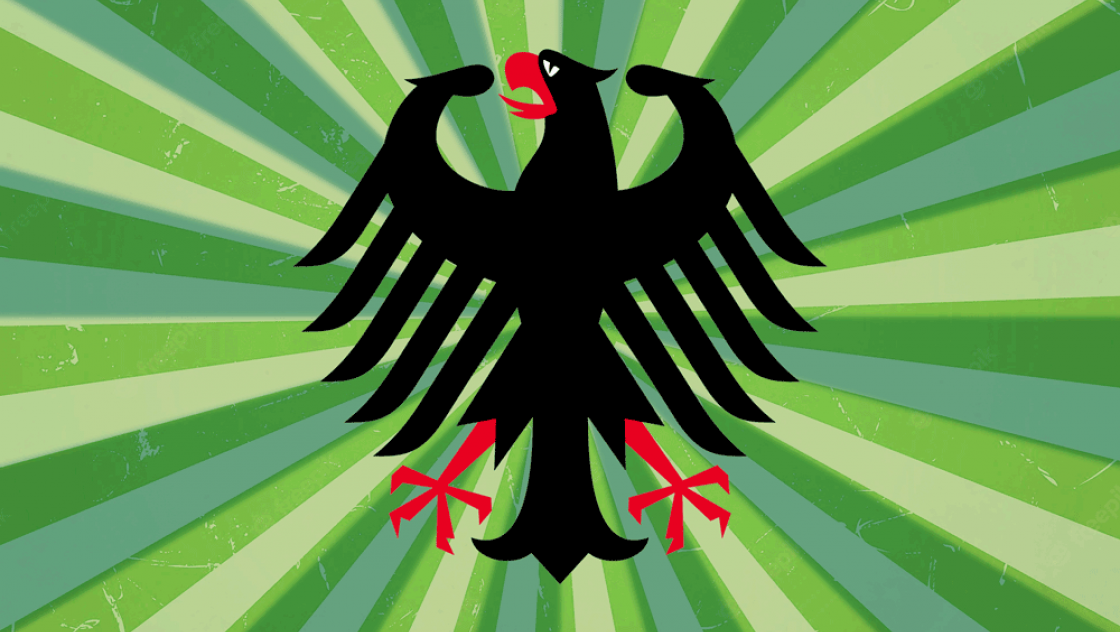
Bild: Blätter
Der Krieg in der Ukraine bestimmt vollkommen zu Recht die Politik, auf internationaler wie nationaler Ebene. Von einer „Zeitenwende“ ist im politischen Berlin die Rede. Doch dieser Begriff verdeckt mehr, als er hilft. Nüchtern betrachtet geht es um drei Dinge: Die Realität zu sehen, naive Fehleinschätzungen offenzulegen und eine neue Politik demokratisch zu gestalten und zu verantworten. Dies betrifft nach dem russischen Überfall auf die Ukraine den Zerfall der europäischen Ordnung, die sich nach 1989 entwickelt hat. Darüber hinaus dürfen wir aber auch die gleichzeitig drängenden Gegenwarts- und Zukunftsfragen nicht vernachlässigen: die soziale Ungleichheit, den digitalen Strukturwandel und die ökologischen Krisen.
Insbesondere mit Blick auf die ökologische Herausforderung gilt es, endlich ebenfalls einen neuen Wirklichkeitssinn zu entwickeln: Der Klimawandel steht uns nicht bevor, sondern wir befinden uns bereits mitten in der Klimakatastrophe. Wir ignorieren das exponentielle Artensterben, obwohl wir längst in einer globalen „Gesellschaft des Verschwindens“[1] leben. Auf den ansteigenden Meeren schwimmen unsere Plastikinseln, deren Partikel über die globalen Stoffströme wieder in unsere Körper zurückfinden. Unser Versuch, den Atommüll aus gut fünfzig Jahren „friedlicher“ Nutzung der Kernenergie „für einen Zeitraum von einer Million Jahren“[2] zu „entsorgen“, ist Ausdruck einer „Metaphysik der Endlagerung“[3]. Angesichts dieser Entwicklungen brauchen wir mehr sozialen und ökologischen Realitätssinn. Wir leben nicht nach dem Grundsatz: Nach uns die Sintflut. Vielmehr findet die Sintflut bereits neben uns statt.[4]
In dieser Situation müssten wir eigentlich versuchen, mit der Natur einen „Friedensvertrag“ zu schließen. Doch die Natur wird nicht mit uns verhandeln, nicht über den Biodiversitätsverlust, nicht über Extremwetter und auch nicht über die Polarschmelzen. Eine ökologische Schubkraftumkehr erscheint kaum noch möglich. Wir können nur noch versuchen, den anthropozänen Drift der Erdsysteme zu verlangsamen und unsere Zukunft ökologisch zu gestalten. Dies bedeutet aber, dass wir vor der schwierigsten Frage der praktischen Philosophie und der politischen Praxis stehen: Wir müssen unsere Lebensgewohnheiten fundamental ändern.
Ein zentraler Baustein dafür ist die ökologische Transformation unserer Verfassungsordnung, die unser individuelles und soziales Leben demokratisch regelt. Doch damit ist neben unserem ökologischen Konsumismus sogleich das zweite Grundproblem formuliert, vor dem wir verfassungsrechtlich stehen: Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Vor allem das parlamentarische Regierungssystem agiert in vierjährigen Legislaturperioden; und der jeweilige Koalitionsvertrag bildet die unüberwindbare Schranke jeder zukunftsorientierten politischen Phantasie. Wir müssen also zwei Dinge gleichzeitig tun: unsere Verfassungsordnung ökologischer und zukunftsoffener gestalten. Ein ökologisches Grundgesetz wäre zugleich auch ein zukunftsoffenes Grundgesetz.
Die liberale, die soziale und die ökologische Revolution
Unsere Verfassungsordnung ist das Ergebnis von Revolutionen. Die Amerikanische und die Französische Revolution des 18. Jahrhunderts haben uns den liberalen Verfassungsstaat gebracht, der die Menschen- und Bürgerrechte mit der Demokratie verbindet. Die liberale Verfassungsordnung hat sodann die zweite – soziale – Verfassungsrevolution angestoßen: Die Wirtschafts- und Eigentumsfreiheit der bürgerlichen Gesellschaft bildete die verfassungsrechtliche Grundlage der Industrialisierung. In Europa und in den USA hat die Industrialisierung zur sozialen Ausbeutung und Verelendung der Bevölkerung geführt und in globaler Perspektive den Kolonialismus noch einmal weiter befeuert. Doch während die koloniale Ausbeutung vollkommen ausgeblendet wurde, stand die soziale Frage in den Industrienationen des Globalen Nordens nun auf der politischen Tagesordnung. In Deutschland versuchte man sie noch im 19. Jahrhundert mit der Entwicklung des Interventionsstaats und der Einführung der Sozialversicherung zu beantworten.
Die zweite verfassungsrechtliche Revolution fand in Deutschland jedoch erst statt, als die Weimarer Reichsverfassung die soziale Frage mit über hundertjähriger Verspätung aufgriff: mit einem Wandel des verfassungsrechtlichen Wirtschafts- und Eigentumsverständnisses, mit Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, mit der Anerkennung von Tarifautonomie und Mitbestimmung. Ihr sozialpolitisches Programm fasste die Weimarer Reichsverfassung in ihrem Art. 151 Abs. 1 zusammen: „Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen zu sichern.“ Das Ergebnis der zweiten Revolution war also der Sozialstaat, der sich in der Bundesrepublik voll entfaltet hat.
Heute stehen wir nach der liberalen und der sozialen Revolution vor einer dritten – ökologischen – Revolution unserer Verfassungsordnung: Die liberalen und sozialen Wohlfahrtsgesellschaften in Europa und in den USA haben sich auf Kosten des Globalen Südens und auf Kosten der globalen Natur entwickelt. Die Menschen des Globalen Nordens sind dadurch selbst zu einer Naturgewalt geworden. Damit ist die Erde in ein neues Zeitalter eingetreten: in das Erstzeitalter des Menschen, das Anthropozän.[5] Aus diesem Grund wird seit den 1970er Jahren über eine ökologische Revolution unserer Gesellschafts- und Verfassungsordnung diskutiert. Angesichts der anthropozänen Krisen kommt es nun darauf an, diese dritte Revolution in einem ökologischen Grundgesetz umzusetzen, ohne dabei die postkoloniale Frage aus den Augen zu verlieren.[6]
Staatsziel »Umweltschutz«: Das veraltete Verfassungsrecht
Das Grundgesetz versucht, die ökologische Frage mit der Staatszielbestimmung „Umweltschutz“ zu beantworten, die 1994 in unsere Verfassung aufgenommen und 2002 durch den Tierschutz ergänzt wurde: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“, heißt es in Artikel 20a Grundgesetz (GG). Auf den ersten Blick klingt dieses Staatsziel „Umweltschutz“ nicht schlecht: Art. 20a GG verpflichtet den Staat, die Umwelt zu schützen, also beispielsweise die Artenvielfalt zu erhalten und Klimaschutz zu betreiben. Auf den zweiten Blick stellt sich jedoch die Frage: Wie kann es sein, dass angesichts der desaströsen ökologischen Bilanz der Bundesrepublik das Staatsziel „Umweltschutz“ in den vergangenen dreißig Jahren keinerlei verfassungsrechtliche Rolle gespielt hat?
Die Antwort ist ganz einfach. Art. 20a GG kennt nur einen Akteur: den Staat, dem ein weiter Ermessens-, Gestaltungs- und Abwägungsspielraum zukommt, ob, wann und wie er Umweltschutz betreiben möchte. Damit verzichtet das Grundgesetz jedoch gerade mit Blick auf den Naturschutz auf das zentrale Instrument der subjektiven Rechte, das in allen anderen Lebensbereichen für eine dynamische und innovative Rechtsentwicklung sorgt. Denn durch subjektive Rechte erhalten Bürgerinnen und Bürger die Fähigkeit, die Rechtsordnung im eigenen oder fremden Interesse in Bewegung zu setzen.[7] Dies führt zu rechtlichen Konflikten, die durch Gerichte entschieden oder durch den Gesetzgeber gelöst werden. Deshalb sind subjektive Rechte eine ganz entscheidende Quelle für eine dynamische Rechtsfortbildung. Rechtliche Konflikte halten eine Rechtsordnung auf der Höhe ihrer Zeit. Doch das Staatsziel „Umweltschutz“ wendet sich ausschließlich „objektiv-rechtlich“ an den Staat. Die Bürgerinnen und Bürger können aus Art. 20a GG kein subjektives Recht auf Umweltschutz herleiten. Deshalb kennt das Grundgesetz bisher nur ein statisches Umweltverfassungsrecht „von oben“. Was wir aber brauchen, ist ein dynamisches Umweltverfassungsrecht „von unten“: Die Bürgerinnen und Bürger müssen durch ökologische Rechte die Möglichkeit erhalten, einen effektiven Naturschutz einzufordern und gegebenenfalls einzuklagen.
Das Staatsziel „Umweltschutz“ ist aber nicht bloß statisch, es hat auch seine normative Steuerungskraft mit Blick auf die ökologische Langzeitverantwortung eingebüßt. Zwar nimmt die Regelung des Art. 20a GG mit dem Schutz der Natur auch – in Verantwortung für künftige Generationen – das Nachhaltigkeitsprinzip auf, das sich seit dem Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen von 1987 zu dem ethischen „Weltprinzip“ entwickelt hat.[8] Doch zugleich muss man sich klarmachen: Das Nachhaltigkeitsprinzip schützt keineswegs die Natur als solche, sondern die nachhaltige Entwicklung.[9]
Was kommt nach der Nachhaltigkeit?
Diese nachhaltige Entwicklung wird heute nach Maßgabe des sogenannten Drei-Säulen-Konzepts bestimmt. Wenn aber Nachhaltigkeit auf einen angemessenen Ausgleich von sozialen, ökonomischen und ökologischen Interessen zielt: Was ließe sich dann Nachhaltiges über das Artensterben und die Klimakatastrophe, über die Vermüllung der Meere und die „Entsorgung“ atomarer Brennelemente für eine Million Jahre sagen? Die fatale Antwort lautet: Nichts! Wir haben den Punkt längst verpasst, an dem das letztlich konservative Nachhaltigkeitsprinzip noch hätte greifen können, um die Natur zu schützen. Und deshalb stehen wir heute vor der zentralen Frage: Was kommt nach der Nachhaltigkeit?
In seiner Klima-Entscheidung vom 24. März 2021 macht das Bundesverfassungsgericht einen Schritt in die richtige Richtung:[10] Auf die Verfassungsbeschwerde vor allem junger Menschen erklären die Karlsruher Richterinnen und Richter das angegriffene Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig, weil es die CO2-Reduktionslasten nicht freiheitsschonend auf die Generationen verteilt, sondern einseitig auf die Zeit nach 2030 verschoben hat. Um dies zu begründen, haben die Karlsruher Richterinnen und Richter genau das getan, was notwendig ist, um unsere Verfassungsordnung ökologisch zu dynamisieren: Sie erkennen ein subjektives Recht der Bürgerinnen und Bürger an, um die Rechtsordnung im ökologischen Interesse mit demokratischer Langzeitwirkung in Bewegung zu setzen. Sie leiten aus der Allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) in Verbindung mit dem Staatsziel „Umweltschutz“ (Art. 20a GG) ein neues Grundrecht auf „intertemporale Freiheitssicherung“[11] ab. Man kann dies auf die Formel bringen: Freiheitsrecht plus Staatsziel „Umweltschutz“ gleich intertemporale Freiheitssicherung. Die auf diese Weise, durch das subjektive Recht auf intertemporale Freiheitssicherung, erzeugte Rechtsdynamik schlug sich unmittelbar nach der Klima-Entscheidung insofern nieder, als es den Gesetzgeber dazu veranlasste, das Klimaschutzgesetz ambitionierter zu gestalten. Dieser grundrechtliche Ansatz lässt sich verallgemeinern, um demokratische Langzeitverantwortung auf einer sehr viel breiteren Linie zu verwirklichen.
Über Gleichheit und Teilhabe: Grundrechte sind nicht nur Freiheitsrechte
In seiner Klima-Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht „nur“ auf die zukünftige Freiheitssicherung abgestellt. Doch Grundrechte sind nicht nur Freiheitsrechte. Sie vermitteln auch Gleichheitsrechte und Teilhabeansprüche. Deshalb lässt sich im Anschluss an die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts neben dem Recht auf intertemporale Freiheitssicherung auch ein Recht auf intertemporale Gleichheits- und intertemporale Teilhabesicherung herleiten. Ein Beispiel für die Anwendung des Rechts auf intertemporale Gleichheitssicherung ist unsere Verschwendung von natürlichen Ressourcen wie beispielsweise fossilen Brennstoffen, Erzen und Metallen zulasten künftiger Generationen. Ein Beispiel für einen intertemporalen Teilhabeanspruch bildet das Recht künftiger Generationen auf Biodiversität, das dem exponentiell beschleunigten Artensterben entgegengesetzt werden kann. Doch so wichtig dieser ökologische Verfassungswandel auch ist, den das Bundesverfassungsgericht mit seinem Klima-Beschluss eingeleitet hat: Eine Gerichtsentscheidung führt noch nicht zu einer ökologischen Verfassungsordnung. Deshalb müssen wir verfassungsrechtlich sehr viel grundlegender und umfassender ansetzen. Wir brauchen ein ökologisches Grundgesetz.
Ein wirklich ökologisches Grundgesetz verbindet ökologische Grundrechte mit einem ökologisch ausgerichteten Staatsorganisationsrecht. Die verfassungspolitische Debatte über diese ökologische Transformation unserer Verfassungsordnung muss allerdings nicht vollkommen neu beginnen. Seit über fünfzig Jahren werden Vorschläge für eine ökologische Reform des Grundgesetzes formuliert und diskutiert. Insbesondere die ostdeutsche Bürgerrechtsbewegung hat vor und nach der deutschen Einheit sehr innovative und vor allem auch umfassende Vorstellungen für eine soziale und zugleich ökologische Verfassungsordnung unterbreitet, zunächst für die DDR nach der friedlichen Revolution und sodann für eine gesamtdeutsche Verfassung.[12] Viele dieser Vorschläge sind in die ostdeutschen Landesverfassungen eingegangen, die deshalb ökologisch sehr viel innovativer als die westdeutschen Landesverfassungen sind. Doch in der Verfassungsreform nach der deutschen Einheit wurden die Vorschläge der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung leider nicht berücksichtigt. Stattdessen haben wir 1994 die Staatszielbestimmung „Umweltschutz“ (Art. 20a GG) als ökologisch und rechtlich folgenlosen Minimalkonsens bekommen. Deshalb sollten wir die innovativen Anregungen von 1989 heute für die unbedingt notwendige ökologische Transformation unserer Verfassung aufgreifen – zwar spät, aber hoffentlich nicht zu spät.
Ökologische Grundrechte
Das Grundgesetz gewährleistet in der Tradition der bürgerlichen Revolution die Menschen- und Bürgerrechte (Art. 1 bis Art. 19 GG). Heute müssen wir diese klassischen Freiheits- und Gleichheitsrechte ökologisch weiterentwickeln. Dafür können wir zunächst neue ökologische Grundrechte im Grundgesetz verankern. Ein Recht auf ökologische Integrität kann beispielsweise eine intakte Umwelt und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen garantieren.[13] Daneben trägt ein neues Grundrecht auf Umweltinformationen zum notwendigen ökologischen Strukturwandel der Öffentlichkeit bei.
Darüber hinaus ist es angesichts der katastrophalen Situation von Natur und Umwelt notwendig, dass wir die klassischen Freiheitsrechte aus Gründen des ökologischen Allgemeinwohls begrenzen.[14] Dies sollte für die Allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) ausdrücklich geregelt werden, die dann nicht nur in den Grundrechten anderer und in der verfassungsmäßigen Ordnung, sondern auch im ökologischen Allgemeinwohl ihre gesetzliche Schranke findet. Diese ausdrückliche Regelung ökologischer Schranken für die Handlungsfreiheit stellt zugleich klar, dass auch andere Freiheitsrechte zur Gewährleistung des ökologischen Allgemeinwohls durch Gesetz beschränkt werden können, beispielsweise die Berufs- und Wirtschaftsfreiheit.
Was aber ist ganz konkret das ökologische Allgemeinwohl? Es ist die Aufgabe des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, das ökologische Allgemeinwohl zu bestimmen, um die Freiheitsrechte einzuschränken. Dafür muss er die ökologische Entwicklung im Anthropozän ständig beobachten, um diese sodann anhand der verfassungsrechtlich garantierten ökologischen Rechte und ökologischen Staatsziele zu bewerten. Das Ergebnis dieser Bewertung bildet das ökologische Allgemeinwohl, das der Gesetzgeber wiederum einer verfassungskonformen Einschränkung von Freiheitsrechten zugrunde legen kann.
Von zentraler Bedeutung für die ökologische Transformation unserer Gesellschaft ist die Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG). Denn das Eigentum ist ein individuelles Recht und zugleich auch eine Grundstruktur unserer Gesellschaft. Wir begegnen uns nicht nur als Personen, sondern auch mit unserem Eigentum. Darüber hinaus bildet das Eigentum in unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung den normativen Kern der Ökonomie, gerade auch wenn es um die Rechtfertigung von Eingriffen, den Verbrauch und die Zerstörung der Natur geht.
Von den ostdeutschen Verfassungen lernen: Eigentum als ökologische Kernfrage
„Natur hat man zu haben!“, lautet seit 200 Jahren das anti-ökologische Prinzip unserer Wirtschaftsordnung. Deshalb wird immer wieder die Forderung erhoben, das Eigentum nicht nur aus Gründen der sozialen, sondern auch der ökologischen Gerechtigkeit abzuschaffen. Wir können hier aber auch einen anderen Weg gehen, der sozial und ökologisch vielversprechender ist: Es kommt darauf an, das Eigentum in der anthropozänen Entwicklung sozial und ökologisch neu zu gestalten. Gerade weil das Eigentumsrecht eine so zentrale und allgegenwärtige Struktur unserer Gesellschaft ist, würde dessen soziale und ökologische Ausgestaltung eben auch ganz zentral zur sozialen und ökologischen Transformation unserer Gesellschaft beitragen.
Doch wie kann dies geschehen? Wir müssen nur dem Verfassungstext folgen. Das Grundgesetz ruft den demokratischen Gesetzgeber in Art. 14 Abs. 1 Satz 2 dazu auf, sowohl den Inhalt als auch die Schranken des Eigentums zu bestimmen. Der Gesetzgeber muss also nach dem Verständnis des Grundgesetzes das Eigentum keineswegs einfach hinnehmen, wie es ist, um sodann „nur“ dessen Gebrauch zu beschränken. Vielmehr geht das Grundgesetz davon aus, dass der Gesetzgeber bereits den Inhalt des Eigentums ausgestalten kann. Das Kriterium für diese inhaltliche Ausgestaltung und rechtliche Begrenzung des Eigentums wird in Art. 14 Abs. 2 GG ausdrücklich formuliert: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Wir haben dies immer im Sinne einer Sozialpflichtigkeit des Eigentums verstanden. Dies war Ausdruck und Folge der industriellen Revolution und ist bis heute eine zentrale Antwort auf die soziale Frage. Aber nun erleben wir die dritte Revolution, nämlich die ökologische Revolution des Anthropozän. Deshalb tritt jetzt neben die Sozialpflichtigkeit die „Ökologiepflichtigkeit“[15] des Eigentums. Die Länder Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben die ökologisch innovativen Anregungen der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung aufgenommen und sind diesen Schritt bereits gegangen. Sie haben die Eigentumsgarantie ausdrücklich unter den Vorbehalt des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen gestellt.[16]
Angesichts der ökologischen Krisen und Katastrophen, vor denen wir stehen und die wir erleben, sollten wir die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes jedoch nicht „nur“ ökologisch interpretieren, sondern sie ausdrücklich ökologisch gestalten. Dafür ließe sich Art. 14 Abs. 2 GG beispielsweise wie folgt fassen: „Das Eigentum und sein Gebrauch sind insbesondere dem sozialen und ökologischen Wohle der Allgemeinheit verpflichtet.“[17]
Eigentum verpflichtet – sozial und ökologisch
Der Gesetzgeber kann und muss also den Inhalt und die Schranken des Eigentums sozial und ökologisch neu gestalten. Dabei muss der Gesetzgeber den folgenden Grundsatz beachten: Die eigentumsrechtliche Position ist verfassungsrechtlich umso stärker geschützt, je mehr sie auf der eigenen Leistung der Eigentümerin oder des Eigentümers beruht.
Auf dieser Grundlage eröffnen sich gerade aus ökologischem Blickwinkel auf den Inhalt des Eigentums zwei gesetzgeberische Gestaltungsmöglichkeiten: Erstens kann der Gesetzgeber entscheiden, dass bestimmte Naturgüter von vornherein nicht eigentumsfähig sind. Eine solche Entscheidung ist dem Gesetzgeber verfassungsrechtlich problemlos möglich, weil Naturgüter von vornherein nicht auf der individuellen Leistung einer Eigentümerin oder eines Eigentümers beruhen. Dementsprechend hat der Gesetzgeber beispielsweise schon heute das Wasser von fließenden oberirdischen Gewässern und das Grundwasser für nicht eigentumsfähig erklärt.[18] Weitere ökologische Güter sollten dem folgen. Zweitens kann der Gesetzgeber für ökologische und nichtökologische Güter, die er als Eigentum anerkennt, festlegen, wie mit ihnen inhaltlich umzugehen ist. So bleibt es dem Gesetzgeber beispielhaft unbenommen, den ökologischen Inhalt immobilen Eigentums – an Grund und Gebäuden – zu definieren. Aber auch die ökologischen Schranken des Eigentums müssen sehr viel stärker als bisher profiliert werden, wenn wir die anthropozänen Herausforderungen meistern wollen, vor allem was umweltschädliche Abfälle und Emissionen angeht.
Es versteht sich von selbst, dass die ökologische Ausgestaltung der Eigentumsordnung sehr umstritten, ja umkämpft sein wird. Es ist zu erwarten, dass sich die neoliberalen Advokaten des Status quo gegen ein ökologisches Verständnis des Eigentums wenden. Sie werden auf das reflexhafte Totschlagargument der „Ökodiktatur“ setzen, das Wirtschaftswachstum beschwören und eine ökologische „Realpolitik“ anmahnen, die neben einer marktkonformen Demokratie auch eine marktkonforme Ökologie einfordert. Doch angesichts des Artensterbens, der Klimakatastrophe und der Globalvermüllung ist eine „marktkonforme Ökologie“ keine Real-, sondern längst eine Illusionspolitik, die die Augen vor der ökologischen Entwicklung verschließt. Je länger wir uns diese aktive Ignoranz der katastrophalen ökologischen Entwicklung leisten, desto härter werden die Freiheitseinschränkungen ausfallen und desto krasser wird sich die soziale Ungleichheit zuspitzen. Wenn Wirtschaft und Eigentum weiterhin verfassungsrechtlich auf einem ökologischen Verwüstungswachstum bestehen, werden sie in der Erderhitzung schlicht weggeschmolzen oder im Meeresanstieg einfach untergehen. Deshalb muss man mit Blick auf unsere Eigentums- und Wirtschaftsordnung die Alternative, vor der wir stehen, ganz klar formulieren: Entweder wächst die Wirtschaft ökologisch, oder es wird keine Wirtschaft und kein Wachstum mehr geben, sondern nur noch Verwüstung und Elend. Kurzum: Es geht nicht um eine marktkonforme Ökologie, sondern um einen ökologiekonformen Markt.
Die Rechte der Natur – ungewohnt, aber unabdingbar
Um die Konflikte zwischen sozialen und ökonomischen Interessen einerseits und ökologischen Interessen andererseits juristisch fair auszutragen, sollten wir schließlich noch einen weiteren, noch grundsätzlicheren Schritt wagen, nämlich auch die Rechte der Natur in das Grundgesetz aufnehmen. Menschen und Wirtschaft verfügen über Grundrechte, um soziale und ökonomische Interessen zulasten der Natur durchzusetzen. Weil sich die Staatszielbestimmung „Umweltschutz“ gegenüber sozialen und ökonomischen Interessen als zu nachgiebig erweist, ist es notwendig, die Rechte der Natur anzuerkennen, um „juristische Waffengleichheit“ herzustellen. Dafür spricht nicht nur der Eigenwert der Natur, sondern auch der Wert der Natur für den Menschen. Und wenn wir Wirtschaft und Kapital – also beispielsweise GmbHs, Aktiengesellschaften und Stiftungen – Grundrechte verliehen haben, dann sollte uns dies auch mit Blick auf die Natur nicht schwerfallen.
Bereits seit den 1970er Jahren werden auch die Rechte der Natur verfassungsrechtlich kontrovers diskutiert.[19] Durch die Verfassung von Ecuador aus dem Jahr 2008 hat diese Diskussion neue politische Schubkraft erhalten. Diese Verfassung räumt der Natur (Pacha Mama) das Recht auf einen umfassenden Respekt ihrer Existenz und auf die Erhaltung und Regeneration ihres Lebenskreislaufs, ihrer Struktur und Funktionen sowie ihrer evolutionären Prozesse ein (Art. 10, Art. 71 ff. Verfassung Ecuador).[20]
Wenn wir über die Einführung von Rechten der Natur in das Grundgesetz nachdenken, bestehen dafür grundsätzlich zwei Regelungsmöglichkeiten. Erstens könnten die Rechte der Natur analog zur Verfassung von Ecuador im Grundgesetz verankert werden, beispielsweise in neu zu schaffenden Artikeln 20b ff. GG.[21] Doch es gibt auch noch einen zweiten – verfassungsrechtlich bereits angelegten – Weg, um der Natur Rechte zu verleihen, nämlich die Regelung des Art. 19 Abs. 3 GG.
Nach dieser Bestimmung können sich juristische Personen – also beispielsweise GmbHs, Aktiengesellschaften und Stiftungen – auf die Grundrechte berufen, die ihrem Wesen nach auf sie anwendbar sind, also insbesondere auf die Wirtschaftsfreiheit und auf die Eigentumsgarantie. Wir sollten nun das Grundgesetz ändern und auch ökologische Personen in Art. 19 Abs. 3 GG als grundrechtsfähig anerkennen. Dadurch wird der Gesetzgeber verpflichtet, diese ökologischen Personen, ihre Vertretung und ihre Klagemöglichkeiten auszugestalten. Wie im Fall des ökonomischen Gesellschaftsrechts kann der Gesetzgeber dabei zwischen unterschiedlichen ökologischen Personen differenzieren. Es liegt nahe, Tiere individuell als ökologische Personen anzuerkennen, auf die dann beispielsweise das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit oder die Bewegungsfreiheit bzw. Freizügigkeit anwendbar sind. Bei Pflanzen könnte der Gesetzgeber unterscheiden: Im Fall von bedrohten Pflanzen liegt wie bei Tieren eine Anerkennung als individuelle Person nahe. Der Schutz von nicht bedrohten Pflanzenarten könnte demgegenüber als Teil eines Ökosystems erfolgen, also beispielsweise als Teil einer Landschaft oder eines Flusses, die ihrerseits als ökologische Personen anerkannt werden. Umweltmedien wie Luft, Klima oder Wasser lassen sich ebenfalls als juristische Personen anerkennen und ausgestalten.
Auch mit Blick auf die Vertretung von ökologischen Personen stehen dem Gesetzgeber eine ganze Reihe von Regelungsoptionen zur Verfügung. Sie reichen von der individuellen Vertretung durch eine menschliche Person oder einen Verein bis zur Popularklage. Durch ökologische Personen wird sich unsere Rechtsgemeinschaft vergrößern; und wir können die sozialen, ökonomischen und ökologischen Konflikte, vor denen wir stehen, auf juristischer Augenhöhe fair austragen. Auf diese Weise entwickelt sich unsere liberale Gesellschaft über die Konflikte weiter, die sie selbst erzeugt. Durch die Rechte der Natur entsteht weitere Dynamik im Rechtssystem, die ebenfalls zur ökologischen Transformation unserer Gesellschaft beiträgt.
Ökologisches Staatsorganisationsrecht
Für die notwendige ökologische Transformation unserer Gesellschaft genügt es jedoch nicht, neue ökologische Grundrechte zu schaffen und die Rechte der Natur anzuerkennen. Damit die ökologischen Rechte im politischen Prozess auch aktiv wahrgenommen und effektiv umgesetzt werden, ist es notwendig, auch die zweite Ebene des Grundgesetzes ökologisch auszugestalten – das Staatsorganisationsrecht. Das klingt zwar technisch, ist aber politisch von zentraler Bedeutung. Denn nur wenn das parlamentarische Regierungssystem für ökologische Rechte sensibilisiert ist, werden diese nicht schlicht in den weiten gesetzgeberischen Abwägungsspielräumen „verpuffen“.
Um die ökologische Sensibilität unseres Staatsorganisationsrechts zu erhöhen, muss zunächst die Ökologie als Staatsfundamentalnorm in Art. 20 Abs. 1 GG verankert werden: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer, sozialer und ökologischer Bundesstaat.[22] Damit gehört die Ökologie zur verfassungsrechtlichen DNA unserer Staatsorganisation, sodass sie die Arbeit der drei demokratischen Gewalten – Legislative, Exekutive und Judikative – bestimmt.
Auf dieser Grundlage gilt es sodann, das parlamentarische Regierungssystem des Grundgesetzes ökologisch umzugestalten – zu einem auch ökologischen Regierungssystem. Dafür weist das Grundgesetz allen zentralen Staatsorganen – Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat und Bundespräsident – ökologische Aufgaben und Funktionen zu, um insbesondere die ökologische Langzeitverantwortung des parlamentarischen Regierungssystems zu gewährleisten. So kann beispielsweise der Bundestag durch eine Verfassungsänderung verpflichtet werden, einmal im Jahr eine ökologische Haushaltsdebatte zu führen, in der die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler die ökologischen Richtlinien der Politik erläutert und alle Bundesministerinnen und Bundesminister zu deren Umsetzung in ihrem Ressort parlamentarisch Rede und Antwort stehen. Indem Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck das Bruttoinlandsprodukt bereits weiter, nämlich ökologisch definiert hat, ist er auf ministerieller Ebene bereits einen wegweisenden Schritt in diese, richtige, Richtung gegangen.
Mit Fridays for Future zum ökologischen Grundgesetz
Der Umweltausschuss des Bundestags sollte künftig aus Bundestagsabgeordneten und einer gleichen Anzahl von ehrenamtlichen, stimmberechtigten Mitgliedern bestehen, die von anerkannten Naturschutzverbänden und der Nationalen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt werden. Auf diese Weise würde naturpolitischer und naturwissenschaftlicher Sachverstand unmittelbar in die Parlamentsarbeit integriert. Der Bundestag schafft darüber hinaus das Amt einer Naturbeauftragten, das – analog zum Amt des Wehrbeauftragten – zu einer effektiven und professionellen Wahrnehmung ökologischer Kontroll- und Untersuchungsrechte des Parlaments beiträgt. Das elektronische Petitionsrecht wird so weiterentwickelt, dass auch ökologische Gesetzesvorschläge von Bürgerinnen und Bürgern ohne den riesigen Aufwand einer klassischen Volksinitiative über den Umweltausschuss in den Bundestag eingebracht werden können. Die Bundesumweltministerin erhält ein Widerspruchsrecht gegen alle Entscheidungen der Bundesregierung von ökologischer Bedeutung, das sich in Anlehnung an das Widerspruchsrecht der Bundesminister für Finanzen, des Innern und der Justiz ausgestalten lässt.[23]
All diese Änderungen zusammengenommen hätten zweifellos den Charakter einer Revolution. Wenn es um diese dritte Revolution unserer Verfassungsordnung geht, stellt sich automatisch die Frage: Wird diese Revolution friedlich oder gewalttätig verlaufen? Auch hier kommt es darauf an, nicht bloß von einer „Zeitenwende“ zu sprechen, sondern schlicht die Realität wahrzunehmen: Das Anthropozän ist längst ein zutiefst gewalttätiges Zeitalter, von zudem dramatischer Ungerechtigkeit. Für die Klimakatastrophe ist insbesondere der Globale Norden verantwortlich; ihre ökologischen Folgen schlagen sich dagegen vor allem im Globalen Süden nieder – als Verwüstung, Hunger und Migration. Darüber hinaus ist absehbar, dass anthropozänes Geoengineering zu internationalen Krisen bis hin zu bewaffneten Konflikten führen wird. In globaler Perspektive kann also von einer friedlichen ökologischen Transformation keine Rede sein.
Angesichts dieser keineswegs friedlichen realen Entwicklung stellt sich die erforderliche dritte Revolution für die Gesellschafts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik als eine regelrecht pazifizierende Entwicklung dar: Neben das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Ausdruck einer liberalen Gesellschaft ist, und das Sozialgesetzbuch (SGB), das die soziale Frage beantwortet, muss ein Ökologisches Gesetzbuch (ÖGB) treten, das unsere gesamte Gesellschaft ökologisch transformiert.
Wer aber soll diese ökologische Transformation unserer Gesellschaft gestalten? Verfassungsrechtliche Revolutionen beginnen immer damit, dass Menschen ihre Rechte einfordern. Zweifellos verfügen wir in der Bundesrepublik über eine höchst aktive Zivilgesellschaft, die gerade auch mit Blick auf die notwendige ökologische Transformation ihre Meinung öffentlich kundtut und demonstriert. Aber ein strategischer Aktivismus, der seine ökologischen Ziele tatsächlich erreichen will, muss heute weitergehen und ökologische Rechte aktiv einfordern. Das ist eine Sache, die man auch Fridays for Future empfehlen kann: Verlangt ökologische Rechte und studiert Jura, um dann unsere Verfassungsordnung ökologisch zu transformieren, ja zu revolutionieren – und das ökologische Grundgesetz für das 21. Jahrhundert zu schreiben.
Mein ganz herzlicher Dank gilt Mathias Greffrath. Die folgenden Überlegungen setzen das Gespräch fort, das wir im Rahmen der Sendung „Essay und Diskurs“ im Deutschlandfunk am 20. März d.J. führen konnten.
[1] Stefan Breuer, Die Gesellschaft des Verschwindens. Von der Selbstzerstörung der technischen Zivilisation, Hamburg 1995.
[2] So ausdrücklich § 1 Abs. 2 Satz 2 Standortauswahlgesetz.
[3] Peter Sloterdijk, Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frankfurt 2006, S. 146.
[4] Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, München 2016.
[5] Paul J. Crutzen, Geology of mankind: the Anthropocene, in: „Nature“, 415/3.1.2002, S. 23.
[6] Sigrid Boysen, Die postkoloniale Konstellation. Natürliche Ressourcen und das Völkerrecht der Moderne, Tübingen 2021.
[7] Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, Tübingen 1905, S. 51, 56 f.
[8] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987, 1. Kap., Rn. 49, 2. Kap., Rn. 1 ff., www.netzwerk-n.org.
[9] Boysen, a.a.O., S. 89.
[10] BVerfG, 24.3.2021, BVerfGE 157, 30 – Klima.
[11] Ebd., Rn. 122, 183 – Klima.
[12]Vgl. insbesondere Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder/Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Vom Grundgesetz zur deutschen Verfassung. Denkschrift und Verfassungsentwurf, Berlin/Köln/Leipzig 1991.
[13] Vgl. für entsprechende Vorschläge der Bundestagsfraktion Die Grünen bereits BT-Ds. 10/990, BT-Ds. 11/604, BT-Ds. 11/663; Ferdinand von Schirach, Jeder Mensch, München 2021, S. 18; kritisch Michael Kloepfer, Zum Grundrecht auf Umweltschutz, Berlin und New York 1978, S. 11 f., 31 f., 35 ff
[14] Klaus Bosselmann, Ökologische Grundrechte. Zum Verhältnis zwischen individueller Freiheit und Natur, Baden-Baden 1998, S. 50, 59 ff., 125.
[15]Jörg Leimbacher, Die Rechte der Natur, Basel/Frankfurt 1988, S. 268 ff.
[16] Vgl. Art. 39 Abs. 5 Satz 3 Verfassung Brandenburg, Art. 31 Abs. 2 Satz 2 Verfassung Sachsen, Art. 18 Abs. 2 Satz 2 Verfassung Sachsen-Anhalt.
[17] Vgl. für alternative Formulierungsvorschläge Kuratorium, a.a.O., S. 90; Bosselmann, a.a.O., S. 124.
[18] Vgl. § 4 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG).
[19] Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects, in: „Southern California Law Review“, 45 (1972), S. 450 ff.
[20] Andreas Gutmann, Hybride Rechtssubjektivität. Die Rechte der „Natur oder Pacha Mama“ in der ecuadorianischen Verfassung von 2008, Baden-Baden 2021.
[21] Andreas Buser und Hermann Ott, Zur Ökologisierung des Rechts: Rechte der Natur als Paradigmenwechsel, in: Frank Adloff und Tanja Busse (Hg.), Welche Rechte braucht die Natur? Wege aus dem Artensterben, Frankfurt und New York 2021, S. 159 (168 f.).
[22] Kuratorium, a.a.O., S. 95; vgl. für entsprechende Regelungen in den Landesverfassungen Art. 2 Abs. 1 Verfassung Brandenburg, Art. 65 Abs. 1 Verfassung Bremen, Art. 1 Abs. 2 und Art. 31 Verfassung Niedersachsen, Art. 1 Satz 2 Verfassung Sachsen, Art. 2 Abs. 1 Verfassung Sachsen-Anhalt, Art. 44 Abs. 1 Satz 2 Verfassung Thüringen.
[23] Vgl. § 26 Geschäftsordnung der Bundesregierung; weitergehend Kuratorium, a.a.O., S. 128.