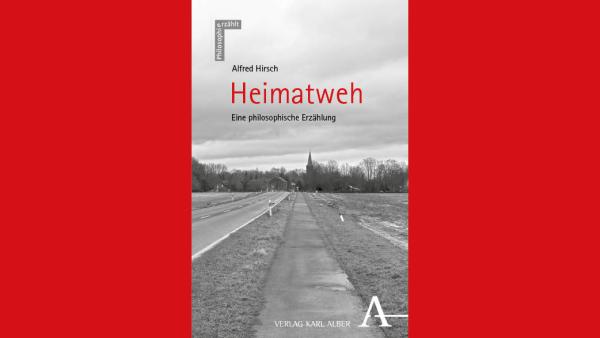Bild: David Van Reybrouck: Revolusi. Indonesien und die Entstehung der modernen Welt, Verlag: Suhrkamp
Hast du eine Ahnung, wo Indonesien liegt?‘ ‚Öhm … nicht genau. Irgendwo in der Gegend von Bali?‘“ David Van Reybrouck zitiert in seinem neuen Buch „Revolusi“ einen unter westlichen Expats beliebten Witz: Indonesien, den Namen kennt man natürlich, aber von Geographie und Geschichte des Landes haben die meisten keine Ahnung. Nach der Lektüre dieses grandiosen Buches ist das anders. Van Reybrouck ist ein begnadeter Erzähler an der Schwelle zwischen Wissenschaft und Journalismus und zugleich ein glühender Anhänger der Oral History. Die weit über hundert hochbetagten Zeitzeugen, die er interviewt hat, machen deutlich, was es heißt, die niederländische Kolonialherrschaft erlebt oder erlitten zu haben. Im Zentrum steht dabei jener Aufstand gegen die andauernde Demütigung, der dem Buch seinen Titel gegeben hat: die Revolusi. „In Indonesien ist sie seit Jahrzehnten der unveränderliche Gründungsmythos des weiträumigen, hyperdiversen Staates.“ Dass sich die fast dreihundert ethnischen Gruppen überhaupt als eine Nation, als ein „Wir“ empfinden, liegt nicht an ihrer Begeisterung für Diversity, sondern an der gemeinsamen Unterdrückung durch die Niederländer. Deren Nachfahren tun sich bis heute schwer, diesem Teil ihrer Geschichte ins Auge zu sehen, weil er so gar nicht ihrem Selbstbild entspricht: Die Niederländer sind ein liberales Volk, keine brutalen Eroberer.
Und in der Tat, schreibt Van Reybrouck, begann das koloniale Abenteuer der Niederländer nicht mit dem Hunger nach Land, sondern mit dem Wunsch nach mehr Geschmack. „Die Niederlande fielen nicht in ein Land ein, um dort die Herrschaft zu übernehmen. […] Sie wollten nur etwas abnehmen, in erster Linie Gewürze. Schon seit Jahrhunderten waren asiatische Gewürze in Europa hoch geschätzt.“ Für den Geschmack aber war die Wirtschaft zuständig. Fast 200 Jahre lang besaß die Vereinigte Ostindische Kompanie das Monopol auf den Überseehandel: eine Aktiengesellschaft, die internationale Verträge abschließen, Recht sprechen und Soldaten anwerben durfte. Sie nahm Schritt für Schritt – und manchmal mit brutaler Gewalt – jene unzähligen Inseln in Besitz, die heute Indonesien heißen. Dann übernahm der Staat diese Aufgabe, so dass die Niederlande schließlich eine Kolonie besaßen, die 50 mal so groß wie das Mutterland war. Das Verhältnis zu den Kolonisierten, so ein niederländischer Beamter, war von kommerzieller Orientierung und Reserviertheit geprägt: „Das Ergebnis war Gleichgültigkeit, […] Gleichgültigkeit gegenüber allem, was die anderen Bevölkerungsgruppen betraf.“
Gleichgültig – aber nicht gleichwertig. In der Hierarchie standen oben die Niederländer, darunter die „Indos“, die einen niederländischen Vater und eine Mutter aus Java oder Sumatra hatten, und ganz unten die einheimische Bevölkerung, wobei es auch hier vielfältige Unterschiede gab. Die Rechtsprechung war genauso einer diskriminierenden Struktur unterworfen wie das Wirtschaftssystem. „Je mehr Pigment, desto weniger payment“, so ein damals übliches Sprichwort. Dass der Widerstand gegen diese Mischung aus Ignoranz und Rassismus nicht von den am stärksten Diskriminierten ausging, sondern von einer einheimischen Elite, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts an indonesischen Hochschulen nach westlichem Vorbild ausgebildet wurde, ist kaum verwunderlich. „Wer die wissenschaftlichen Bezeichnungen aller Muskeln, Sehnen, Membranen, Knochen und Nerven im Kopf hatte und kritisch denken konnte“, schreibt Van Reybrouck, „aber bei einer Feier mit Europäern auf dem Boden sitzen musste, während noch dem tumbsten Europäer ein Stuhl angeboten wurde – wer Tag für Tag solche Demütigungen erlebte […], der empfand natürlich schneller Verbitterung über die kolonialen Verhältnisse als ein armer Bauer, der sein dürftiges Reisfeld bearbeitete, wie all seine armen Vorfahren es getan hatten.“
Die erste Konferenz des globalen Südens
Am Anfang stritten Nationalisten, Marxisten und Muslime erbittert um den richtigen Weg zur Befreiung, doch dem charismatischen Architekten Sukarno gelang es, die drei Strömungen zu vereinen – unter dem Banner des Nationalismus. Das Rezept des späteren ersten Präsidenten Indonesiens war gleichermaßen schlicht wie überzeugend: „sini und sana, hier und dort. Hier wir, dort sie. Hier die Indonesier, dort die Holländer.“
Und dann waren da noch die Japaner. Die Kapitel über ihre Besatzung Indonesiens gehören zu den spannendsten, auch weil sie das widersprüchliche Verhältnis zu Kolonialismus und Faschismus deutlich machen: Viele Indonesier liebäugelten nicht nur mit den Nazis, weil diese nationale Befreiung versprachen, sondern begrüßten auch die japanische Invasion 1942, da die „asiatischen Brüder“ die verhassten Niederländer vertrieben. Doch schnell wurde deutlich, dass die Japaner nicht als Befreier, sondern als neue Herrscher kamen, die nur an den Rohstoffen des Landes interessiert waren. Und im Mutterland der Kolonisatoren, den Niederlanden, schlossen sich indonesische Studenten dem Kampf gegen die deutsche Besatzung an – nach dem Motto: erst den Faschismus bekämpfen, dann den Kolonialismus. Doch als Japan im August 1945 kapitulierte und Sukarno die Republik Indonesien ausrief, erkannten die Niederlande dies nicht an. Erst nach vier Jahren Kampf – mit brutaler Gewalt auf beiden Seiten und einer Weltöffentlichkeit, die das westliche Kolonialsystem zunehmend infrage stellte – sah die niederländische Regierung ein, dass sie die Unabhängigkeit nicht aufhalten konnte.
Das letzte Kapitel des Buches ist dem Weiterwirken der Revolusi gewidmet. Im April 1955 fand in Bandung die erste internationale Konferenz des Globalen Südens statt, deren Teilnehmer mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung vertraten. Sukarno eröffnete das Treffen mit dem Bekenntnis zu einer gemeinsamen Ablehnung jeglicher Form von Kolonialismus und Rassismus. Dass auch der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al Husseini, der dem antisemitischen Rassedenken der Nazis keineswegs ablehnend gegenüberstand, Gast der Konferenz war, verschweigt Van Reybrouck. Sein Interesse gilt dem ägyptischen Staatschef Gamel Abdel Nasser, der den Geist von Bandung in die arabische Welt trug und dort als Held gefeiert wurde, als er den in britisch-französischem Besitz befindlichen Suezkanal verstaatlichte. Wenig später wurden in der italienischen Hauptstadt die Römischen Verträge unterzeichnet, das Gründungsdokument der EU. „Ohne ‚Bandung‘ kein ‚Suez‘, ohne ‚Suez‘ kein ‚Europa‘. Die europäische Einigung sollte die energische Reaktion Europas auf den Antiimperialismus des Südens sein.“ Die Erklärung des niederländischem Außenministers Joseph Luns, die Römischen Verträge seien eine Fortsetzung der Kulturmission Europas, kommentiert Van Reybrouck mit den Worten: „Nicht post-, sondern spätkolonialistisches Denken lag der europäischen Einigung zugrunde.“
Vom Kolonialismus zur ökologischen Ausbeutung
Bei aller Kritik am historischen Kolonialismus hält er etwas anderes für viel wichtiger: die ökologische Ausbeutung in den Blick zu nehmen. „Kolonialismus ist keine Unterwerfung von Gebieten mehr, sondern findet in der Zeit statt“, schreibt er am Ende des Buches: „Wir verhalten uns wie die Kolonisatoren künftiger Generationen, nehmen ihnen ihre Freiheit, ihre Gesundheit, vielleicht sogar ihr Leben.“ Van Reybrouck hat diese Kritik in seiner Eröffnungsrede auf dem diesjährigen Internationalen Literaturfestival Berlin mit drastischen Worten wiederholt. Statt endlose Diskussionen über Statuen und Straßennahmen zu führen, müsse der Westen endlich über den heutigen Kolonialismus sprechen: den Klimawandel, für den der Globale Norden hauptverantwortlich ist und der vor allem dem Globalen Süden die Lebensgrundlage entzieht. Van Reybrouck hat Recht und doch macht er es sich mit seiner Analyse zu einfach. Denn anders als der Kolonialismus der Vergangenheit basiert die Kolonialisierung der Zukunft nicht auf der Unterdrückung anderer Völker, sondern auf der Verheißung von Fortschritt und Selbstverwirklichung. Und diese Ideale sind längst nicht mehr auf die Länder des Westens begrenzt, sondern überall auf der Welt zu finden – nur sind sie mit den Ressourcen einer begrenzten Erde schlicht nicht kompatibel.
David Van Reybrouck, Revolusi. Indonesien und die Entstehung der modernen Welt. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Suhrkamp, Berlin 2022, 751 S., 34 Euro.