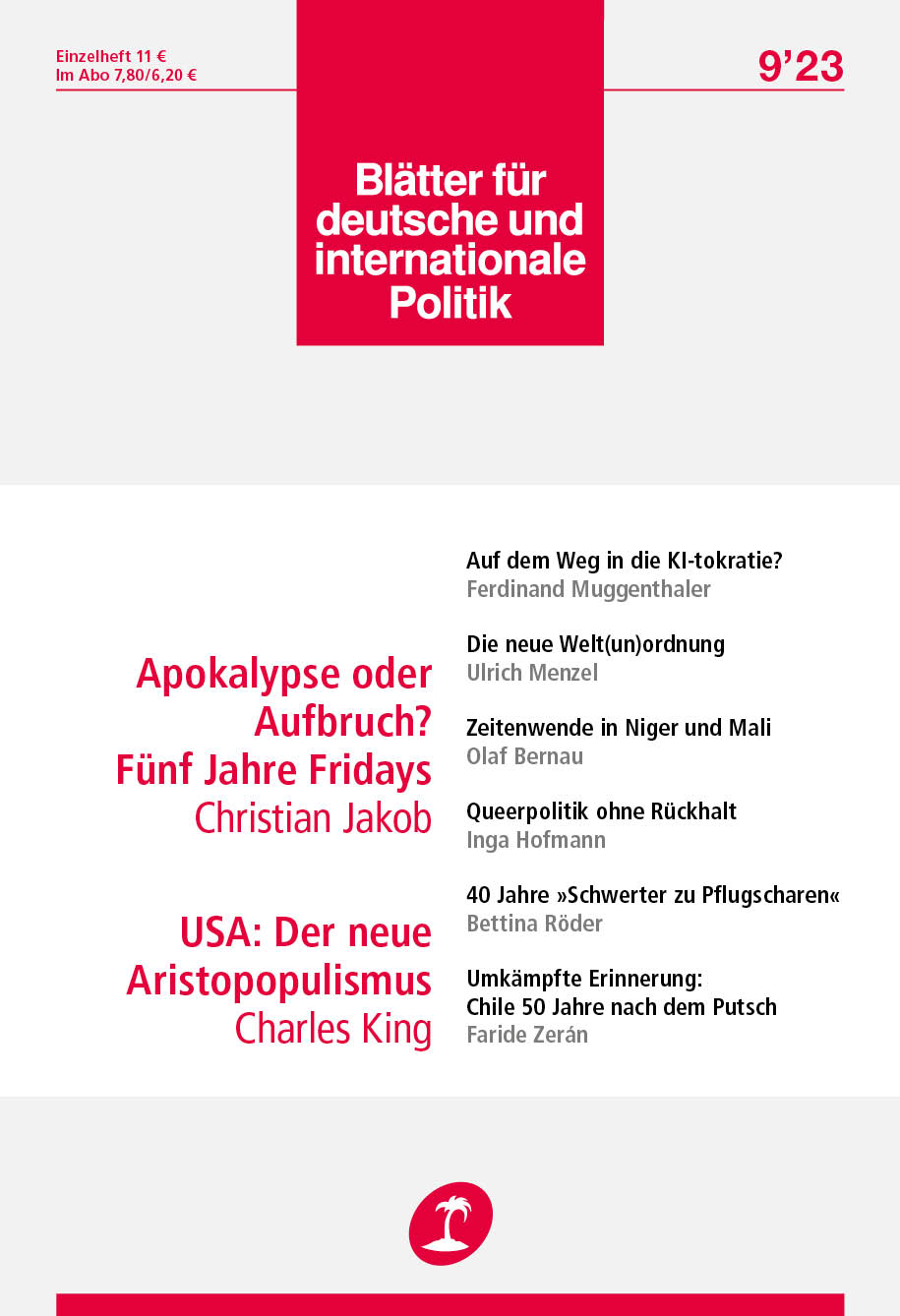Bild: Eine Familie an einem Brunnen im Stadtzentrum von Magdeburg, 25.6.2022 (IMAGO / Panthermedia)
Wer in Berlin nach einem starken Regen knöcheltief im Wasser steht oder in einigen niedersächsischen oder brandenburgischen Orten bei Trockenheit nicht mehr seine Blumen gießen darf, hat es in diesem Sommer gespürt: Viele Städte und Kommunen in Deutschland sind nicht auf extreme Wettereignisse im Klimawandel vorbereitet.
Sie haben nicht vorgesorgt für das, was uns mit Sicherheit[1] bevorstehen wird: Bei Trockenheit und Niedrigwasser wird es an Trinkwasser mangeln, wasserintensive Anlagen wie Chemie- und Papierwerke müssen den Betrieb einstellen. Starkregen, Sturzfluten und Hochwasser bringen kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Kraftwerke in Gefahr, und auch viele Häuser und Wohnungen sind hochwassergefährdet. Durch höhere Meeresspiegel sind Küstenzonen größeren Flutrisiken ausgesetzt, Städte und Dörfer können überschwemmt werden.
Eine aktuelle Recherche[2] von Correctiv, BR Data, WDR Quarks und NDR Data zeigt, dass die allermeisten Landkreise und kreisfreien Städte, die an deren Umfrage teilgenommen haben, um die steigenden Risiken wissen: Neun von zehn Landkreisen rechnen demnach damit, dass in ihrem Gebiet künftig mehr extreme Wetterereignisse eintreten. Trotzdem hat nur ein Viertel der 329 Landkreise und kreisfreien Städte ein Schutzkonzept für die Klimakrise, weitere 22 Prozent planen eines. In Sachsen-Anhalt ist die Lage besonders schlecht: Die allermeisten Gemeinden dort verfügen bisher über keinen Plan für die Anpassung an die Klimaveränderungen. Auch in anderen Bundesländern sorgen nicht einmal diejenigen Landkreise vor, die die Folgen der Klimakrise bereits gespürt haben. Zum Beispiel der Landkreis Karlsruhe: Die Menschen dort litten zwischen 1993 und 2022 durchschnittlich unter 17 Hitzetagen im Jahr. Trotzdem hat der Landkreis Maßnahmen gegen Hitze weder umgesetzt noch geplant.
Dabei sind es in erster Linie Bürgermeister:innen und Landrät:innen, die ihre Bewohner:innen schützen könnten. Deshalb richtet sich auch das geplante Anpassungsgesetz[3] von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) explizit an die Rathäuser.
Aber auch dieses Gesetz wird an der mangelnden Vorsorge erst einmal wenig ändern: Zwar werden damit alle Gemeinden und Kreise der Republik dazu verpflichtet, Schutzpläne zu entwerfen – doch Vorgaben, was genau sie umsetzen müssen, gibt es nicht. Und wenn die Gemeinden oder Kreise besonders klein sind, können Landesregierungen ihre Städte sogar von dieser Pflicht befreien. Außerdem sorgt der Bund, über bescheidene Förderprogramme hinaus, nicht für das nötige Geld für die kommunale Umsetzung. Über eine dauerhafte Finanzierung wollen Bund und Länder erst noch diskutieren.
Das ist eine verhängnisvolle Nachlässigkeit: Ohne einen Plan wird es nur in seltenen Fällen auch konkrete Maßnahmen geben. Und das, obwohl die Vorsorge für die Klimakrise ganz entscheidend in den Rathäusern der Republik umgesetzt werden kann.
Beispielsweise ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich für heiße Temperaturen und Starkregen zu wappnen, Asphalt und Beton durch Bäume und Grünflächen zu ersetzen. Genau darüber können die kommunalen Parlamente und die Verwaltungen entscheiden. Sie bestimmen, welche Flächen als Bauland ausgewiesen werden, ob für Parkplätze und Supermärkte Wiesen schwarz asphaltiert werden oder im Gegenteil Beton aufgebrochen und durch Bäume ersetzt wird.
All dies bestimmt darüber mit, wie heiß es in einer Stadt wird und wie sie mit Starkregen zurechtkommt. Asphaltierte Straßen werden zu Hitze-
inseln und bei Starkregen zum Problem: Wenn es Unmengen Wasser in kurzer Zeit regnet, läuft die Kanalisation über. Dann können sich auf den versiegelten Flächen Flutwellen bilden, Keller volllaufen, Parkhäuser zu tödlichen Fallen werden. Grünflächen hingegen können Wasser aufnehmen, dort versickert es ins Grundwasser.
Entsiegeln dringend erforderlich
Kommunen entscheiden auch darüber, ob eventuell vorhandene Flüsse renaturiert werden, Sickergruben für Starkregen geschaffen und neue Systeme eingeführt werden, bei denen statt wertvollen Trinkwassers das so genannte Grauwasser für die Toilette genutzt wird. Sie entscheiden darüber, ob und wie Wasser gespart werden soll, wie teuer Trinkwasser wird und welche Fabrik wieviel Kubikmeter entnehmen darf.
Bei der Vorsorge für die Klimakrise sind die Kommunen und Gemeinden daher sehr mächtig – im Unterschied zum Klimaschutz, wo die maßgeblichen Entscheidungen eher in Berlin und Brüssel fallen.
Trotzdem werden die meisten Kommunen die nächsten Extremwetterereignisse nahezu unvorbereitet erleben. Anpassung findet nicht statt. Dafür gibt es zwei Gründe: die Freiwilligkeit und das fehlende Geld. Zunächst zur Freiwilligkeit: Noch immer gehört die Vorsorge nicht zu den verpflichtenden Aufgaben einer Kommune. Das wäre dringend nötig, um die Umbauprojekte vorrangig zu behandeln. Pflichtaufgaben sind bislang Dinge wie Kindergärten, Wasserversorgung und die Müllabfuhr. Klimaanpassung hingegen, die im Zweifel Leben rettet, ist nur eine Kann-Aufgabe mit demselben Rang wie das Betreiben einer Tourismusinformation.
Dabei ist sie eine der größten Aufgaben überhaupt. Ein der Klimakrise angepasstes Leben in der Stadt hieße, sie komplett umzuwandeln, um die Schlafzimmer, Büros und die Einkaufsstraßen möglichst kühl zu halten. Dichte Häuserreihen, versiegelte Flächen, nur wenige grüne Büsche und zusätzliche menschengemachte Wärme, verursacht durch Klimaanlagen und Heizungen, kann während Hitzewellen die Lufttemperatur in größeren Städten um bis zu zehn Grad höher ansteigen lassen als in der Umgebung. In Berlin wurden sogar schon Temperaturunterschiede von zwölf Grad zum kühleren Umland gemessen: Je größer der Betonring um einen Standort, desto heißer wird es Tag und Nacht.
Wir müssen in großen Dimensionen denken, das fordert[4] auch der erste Professor für „urbane Klimaresilienz“ an der Universität in Augsburg, Markus Keck. Es gehe dabei nicht nur um ein paar Bäume. Jede Kühlfläche sei gut, aber ein Ahornbaum allein bringe wenig: Nötig seien grüne Schneisen, Flüsse müssten renaturiert werden. Tatsächlich sind bislang Städte darauf ausgerichtet, das Wasser im Zentrum möglichst schnell loszuwerden und dafür in schmale Kanäle zu zwängen.
Die begradigten und kanalisierten Flüsse können dann für Wasserkraft und Abwasserentsorgung genutzt werden. Aber eine ungewollte Folge ist: Ihr Pegel steigt bei Starkregen wesentlich schneller an, der Fluss rauscht bei Hochwasser mit hoher Geschwindigkeit durch das Zentrum. Eine Renaturierung aber kostet viele Millionen Euro und viel Zeit.
Den Kommunen fehlt das Geld
Dieses Beispiel führt zum zweiten Grund, warum Kommunen nicht handeln: Ihnen fehlt das Geld. Flächen zu entsiegeln, kostet hunderttausende Euro, die Pflege der Grünflächen muss jedes Jahr neu budgetiert werden. Kindergärten brauchen Sonnensegel, und um Menschen vom Auto abzubringen benötigen sie einen funktionierenden, günstigen öffentlichen Nachverkehr und sichere Radwege.
In der Correctiv-Umfrage geben viele Landkreise an, notwendige Dinge nicht zu tun, weil ihnen das Geld dafür fehlt. Beispiel Ostallgäu: Der Kreis liegt in den Bergen, der höchste Gipfel kommt auf über 2000 Meter, die Ortschaften liegen auf einer Höhe von 600 bis 900 Metern. Dort sammelt sich viel Regenwasser aus den Alpen und bedroht Siedlungen und Menschen. Doch der Kreis hat nach eigenen Angaben „notwendige Maßnahmen nicht finanziert“ – dazu zählt er die Entsiegelung von Flächen und auch, Gebäudebesitzer zur Eigenvorsorge zu sensibilisieren. In der kommunalen Bauleitplanung seien die Herausforderungen durch Starkregen „teilweise“ berücksichtigt worden, jedoch auch noch nicht finanziert.
Dieser entscheidende Punkt fehlt bislang in der Debatte um eine Vorsorge weitgehend: Städte brauchen dazu neues Geld. Denn weiter verschulden können sie sich kaum. Viele Städte haben schon jetzt Haushaltssperren verhängt. Rund 13 Prozent der Kommunen waren schon vor der Coronapandemie überschuldet, nun sind es mehr als die Hälfte: Sie haben deutlich weniger eingenommen und mussten mehr Arbeitslose und Arbeitsausfälle finanzieren. Ende 2021 beliefen sich die kommunalen Schulden pro Einwohner und Einwohnerin auf rund 4000 Euro.[5] Schon jetzt müssen viele Bürgerinnen und Bürger mit ansehen, wie ihre Theater und Schwimmbäder schließen oder ihre kommunalen Steuern für Abwasser massiv steigen.
Beide Entscheidungen treffen ärmere Familien besonders hart. Diejenigen also, die heute schon extremen Wetterereignissen stärker ausgesetzt sind. Etwa, weil sie in Betonburgen wohnen, die sich wesentlich stärker aufheizen als grüne, wohlhabende Viertel.
Aber bislang fehlt eine aufrichtige Debatte darüber, dass neue Einnahmen gefunden werden müssen, um Menschen in der Klimakrise zu schützen. Ein höheres Wirtschaftswachstum ohne Änderung der Struktur kann in der Klimakrise jedenfalls keine Lösung sein. Vermehrtes Produzieren und Kaufen von den derzeit beliebten Produkten würde diese nur befeuern. Bleiben also höhere Steuern für Großverdiener und Luxusprodukte, von denen es seit der Pandemie mehr gibt als jemals zuvor. Nur so können die Kosten der Anpassung gerecht verteilt werden.
Und noch ein Punkt ist wichtig: Wer über Anpassung spricht, ignoriert keineswegs die Dringlichkeit, Treibhausgasemissionen drastisch zu reduzieren. Im Gegenteil: Angesichts des enormen Aufwands, sich auf minimale Temperaturunterschiede von nur einigen Zehntelgrad vorzubereiten, ist Klimaschutz existenziell. Aber sich auf die konkreten Folgen vorzubereiten, bedeutet auch, dem Drama ins Auge zu sehen. Nur ein Leugner der Klimakrise würde abstreiten, dass wir uns, selbst bei vergleichsweise geringen Veränderungen, anpassen müssen.
Anpassung ist auch Klimaschutz
Doch auch die Anpassung stößt an Grenzen, beispielsweise bei Pflanzen. Keine Züchtung hat es je vermocht, sich von Niederschlag unabhängig zu machen. Weniger Wasser bedeutet weniger Ertrag – wir können und sollten dies abmildern, mit Hecken und bedeckten Böden, aber die künftige Ernte wird trotzdem mit jedem Dürretag und jedem Starkregen kleiner ausfallen.
Technologie und Erfindungsgeist werden irgendwann nicht mehr ausreichen. Deiche kann man nicht unbegrenzt in die Höhe bauen, Klimaanlagen oder Heizungen sind auf ein stabiles Energiesystem angewiesen, das bei Stürmen, aber auch Dürren oder Überflutungen nicht kollabiert.
Deshalb bedeutet eine gute Vorsorge auch immer: Emissionen senken. Glücklicherweise tragen die meisten Dinge, die Städte einführen können, zu beiden Zielen bei. Sich an die Klimakrise anzupassen, heißt in den meisten Fällen auch, die Klimakrise abzumildern. Wenn Parkflächen für Sicker- und Abkühlungsflächen verringert werden, bleibt das Auto stehen. In grüneren und damit fußgängerfreundlicheren Städten gehen Menschen eher zu Fuß oder nehmen den Bus.
Längst ist wissenschaftlich beschrieben, wie positiv eine solche Stadtpolitik wirken könnte. Forscherinnen einer weltweiten Studie[6] benannten die Vorteile einer Lebensweise, die sowohl Emissionen einspart als auch mit Hitze und Überschwemmungen besser zurechtkommt. Radfahren und weniger Fleisch und verarbeitete Lebensmittel zu essen, verbessert auch die Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger. Die britischen Forschenden nennen sogar eine konkrete Zahl: Mit all diesen Maßnahmen könnte in Deutschland jedes Jahr der Tod von rund 160 000 Menschen vermieden werden.
Trotzdem erkennt kaum eine Verwaltung wie lebenswert eine klimaangepasste Stadt sein würde. Stattdessen erlassen sie teilweise autoritäre Maßnahmen, deren Sinn fraglich ist. Wegen der Dürre dürfen etwa in Lüchow-Dannenberg Gärten, wenn es wärmer als 24 Grad Celsius ist, zwischen 11 und 19 Uhr nicht mehr bewässert werden. Für Felder gilt dies erst ab einer Temperatur von 28 Grad oder bei stärkerem Wind.
Komplizierte Regeln, die sich niemand merken und noch weniger überprüfen kann, die aber offenbar vorspielen sollen, die Stadt handele. Niemand aber kann beziffern, welchen Wert solche Erlasse tatsächlich haben – der Wert von Grünflächen, Sickergruben und renaturierten Flüssen ist hingegen hinlänglich bekannt. Die meisten Städte belassen es bislang trotzdem bei diesen kostenlosen Schikanen, anstatt sich den wirklich wichtigen Dingen zu widmen. Eben weil die Aufgabe freiwillig ist – und das Geld fehlt.
Wie wenig sich getan hat, dürfte jedem und jeder auffallen, der oder die durch Mannheim, Berlin oder Herne spaziert: Die meisten deutschen Städte sehen kaum anders aus als vor zehn oder 20 Jahren. Autos dominieren nach wie vor das Bild, Billig-Supermärkte dürfen Felder und Wiesen asphaltieren und nach grünen Fassaden sucht man meist vergeblich.
Falls sich irgendetwas zum Positiven verändert haben sollte, ist es offensichtlich minimal – und das bei maximaler Warnstufe angesichts der kommenden Dürren, Überschwemmungen und Hitzewellen in einem der reichsten Länder der Erde.
[1] Renee Cho, Attribution Science: Linking Climate Change to Extreme Weather, climate.columbia.edu, 4.10.2021.
[2] Katarina Huth, Annika Joerese et al., Hitze, Dürre, Starkregen: So schlecht ist Deutschland vorbereitet, correctiv.org, 13.7.2023.
[3] BMUV, Bundesregierung verabschiedet erstes bundesweites Klimaanpassungsgesetz, bmuv.de, 13.7.2023.
[5] Statista, Integrierte kommunale Schulden zum Jahresende 2021, destatis.de, 9.11.2022.
[6] The lancet Countdown, The Lancet Planetary Health special issue, 9.2.2021.