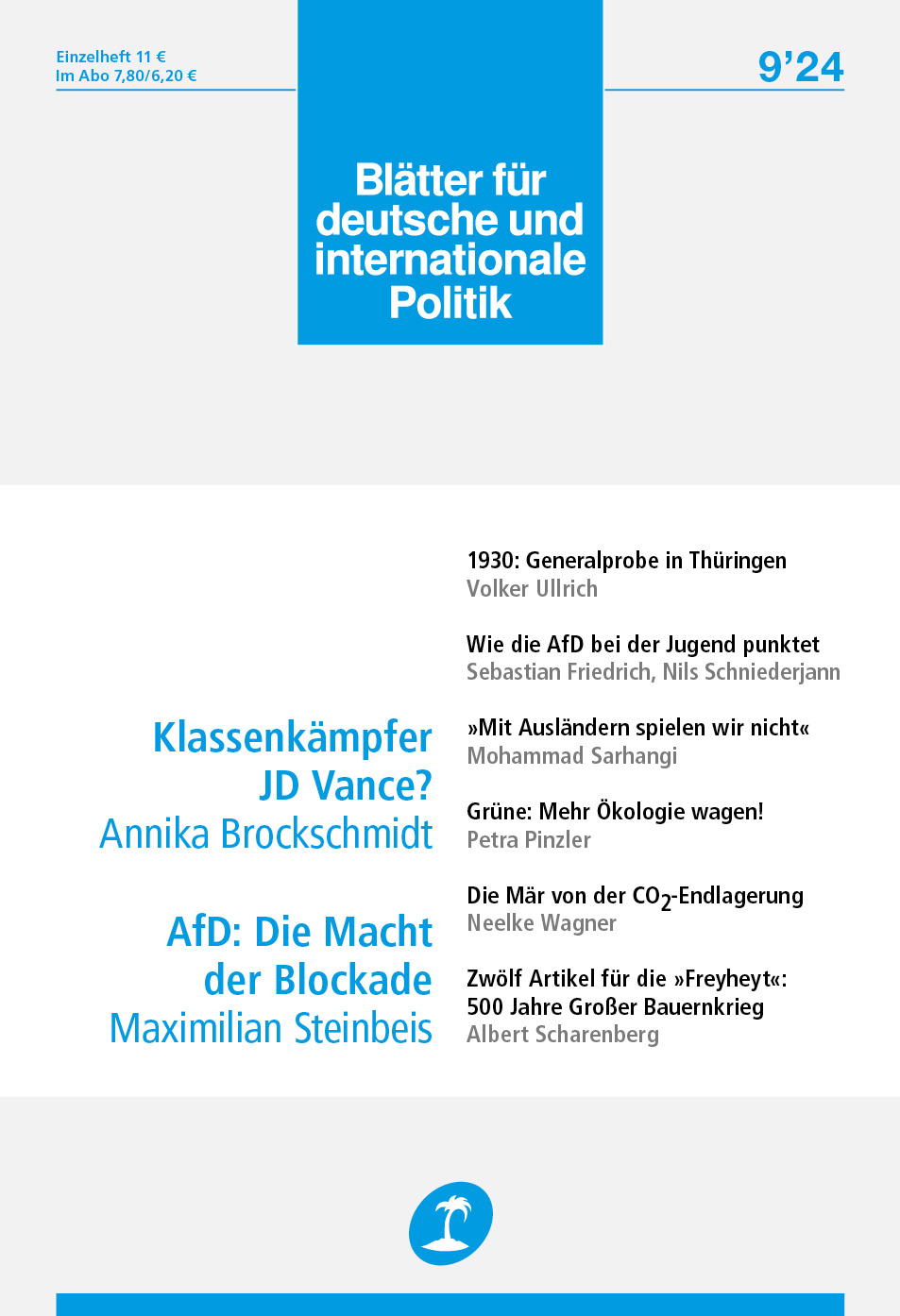Bild: Das VW-Werk in Osnabrueck, 17.5.2020 (IMAGO / Fotostand / Gelhot)
Nun also auch die Europäische Union: Nach den USA, Indien, Brasilien und der Türkei erhebt seit dem 5. Juli nun auch Brüssel vorläufig zusätzliche Einfuhrzölle auf in China produzierte Elektroautos. Strafzahlungen in Höhe von etwa 17 bis 38 Prozent des Verkaufspreises der Autos werden zusätzlich zum bereits geltenden Einfuhrzoll fällig, je nachdem, wie die jeweiligen Produzenten im Rahmen der „Antisubventionsuntersuchung“ mit der EU kooperiert haben. Mit dieser prüft die EU seit vergangenem Herbst, ob E-Auto-Hersteller in China von illegalen Subventionen profitieren.
Mit den Einfuhrzöllen, die zunächst für eine Dauer von höchstens vier Monaten gelten und offiziell im November eingeführt werden sollen, verfolgt die EU eine Strategie des industriepolitischen Protektionismus: Seit nicht einmal zwei Jahren steigen die Importe von chinesischen Elektroautos in die EU rasant an, denn Autobauer wie BYD, Geely oder Nio sind europäischen Herstellern wie VW, Stellantis (Fiat, Peugeot u.a.) und Mercedes nicht nur technisch voraus, sie sind vor allem deutlich preiswerter. Einfuhrzölle, so das Kalkül, sollen den Wettbewerbsvorteil ausgleichen.
Dass es ökologischer Irrsinn ist, die im Vergleich zu Verbrennern deutlich klimafreundlicheren Elektroautos zu verteuern, liegt auf der Hand. Zwar sollte man sich hüten, die positiven Klimaeffekte der Antriebswende überzubewerten.[1] Trotzdem gilt: Wenn schon motorisierter Individualverkehr, dann ist ein Elektroauto mittlerer Größe und moderater Fahrleistung die bessere Wahl. Eine Verkehrswende darf zwar nicht auf Elektroautos reduziert werden, aber ohne (bezahlbare) E-Autos wird sie, vor allem im ländlichen Raum, nicht funktionieren.
Mehr als fraglich ist aber auch, ob diese Art von protektionistischer Industriepolitik dazu beitragen kann, die etwa 2,5 Mio. Arbeitsplätze in der europäischen Automobilindustrie mittel- und langfristig zu schützen. Viel wahrscheinlicher ist das Gegenteil. Denn Brüssel wird mit dieser Maßnahme den komplexen Ursachen für die fehlende Konkurrenzfähigkeit der europäischen Autobauer keineswegs gerecht: verzögerte Innovationen, hohe Energiekosten und ein immer noch schleppender Ausbau der Ladeinfrastruktur.
Die »doppelte Transformation«
Dahinter steht eine tiefgreifende Umwälzung der gesamten Branche. Eigentlich haben wir es in der Automobilindustrie nicht mit einer, sondern mit zwei Transformationen zu tun.[2] Die Autohersteller müssen ihre Flotten nicht nur dekarbonisieren, sondern sie müssen auch Software und Elektronik der Autos an die rasanten technischen Entwicklungen und die sich dadurch radikal wandelnden Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden anpassen.
Bei der Antriebswende vom Verbrennungs- zum Elektromotor handelt es sich zunächst um eine Reaktion auf die politische Entscheidung, Wirtschaft und Konsum klimaneutral zu gestalten, indem der Verbrauch fossiler Energieträger sukzessive reduziert wird. Exemplarisch dafür steht das im Februar vom EU-Parlament in abschließender Lesung beschlossene EU-Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035. Das Neuzulassungsverbot für Verbrenner sollte der zentrale Schritt hin zu einem klimaneutralen Verkehrssektor bis 2050 sein.
Der andere große Trend der Automobiltransformation, die Digitalisierung, ist dagegen in erster Linie marktgetrieben. Der Toyota-Manager Steve Adler brachte die Entwicklung auf den Punkt, als er feststellte: „Software frisst die Welt auf, und Autos stehen als nächstes auf der Speisekarte.”[3] Autos werden im Zuge der Digitalisierung zum „Software definierten Fahrzeug“ (SDV), die untereinander, mit der Verkehrsinfrastruktur und den Fahrenden vernetzt sind. Dafür brauchen sie eine leistungsfähige IT-Architektur.
Hier schließt sich der Kreis zur Dekarbonisierung. Denn sowohl der elektronische Antriebsstrang als auch gute Infotainment- oder Navigationssysteme benötigen riesige Rechenkapazitäten und damit leistungsfähige Halbleiter. Das Problem der alten Automobilindustrie im Allgemeinen und der deutschen im Besonderen: Sie kann Verbrennungsmotoren, Einspritzpumpen und Bremssysteme. Doch das Geld wird inzwischen mit Batteriezellen, Software und Halbleitern verdient. Wer hier mitmischen will, muss mit globalen Schwergewichten wie Nvidia, Google, Amazon Web Service (AWS), Huawei oder dem chinesischen Batterieweltmarktführer CATL konkurrieren. „Die Traditionalisten bei uns haben den E-Antrieb verpennt, das wiegt schwer; aber noch schwerer wiegt, dass sie die Digitalisierung verschlafen haben“, so die nüchterne Feststellung eines Betriebsrats eines großen europäischen Autoherstellers.[4]
Wie schwer es ist, diese Versäumnisse aufzuholen, zeigt das Beispiel von Volkswagen, jahrzehntelang Weltmarktführer neben Toyota und Europas Nummer eins unter den Automobilkonzernen. Um sich technologisch unabhängiger von Google und Co. zu machen, gründete der Konzern 2020 auf Initiative des ehemaligen Chefs Herbert Diess eine eigene Software-Einheit, die Cariad. Bis dahin lag der Anteil der bei VW entwickelten Software bei bescheidenen zehn Prozent. Mit Cariad, so der Plan, sollte er auf 50 Prozent wachsen. Diess verkündete damals: „Tech oder Tod.“[5] Vier Jahre und zahlreiche, aufgrund von Entwicklungsverzögerungen gescheiterte Modelleinführungen später, ist klar: Cariad ist tot, und der Versuch, konkurrenzfähige Betriebssysteme innerhalb eines deutschen Automobilkonzerns zu entwickeln, ist gescheitert. Im Juni zog Diess‘ Nachfolger, Oliver Blume, die Reißleine. Statt Eigenentwicklung heißt es jetzt, teuer zukaufen: Im Juli wurde bekannt, dass VW mit bis zu fünf Mrd. Euro in ein Joint Venture mit dem US-amerikanischen Elektroauto-Start-up Rivian eingestiegen ist, um auf deren Softwareplattform zugreifen zu können.[6] Was das für die 6000 Cariad-Beschäftigten bedeutet, verrät VW bisher nicht.
»Tech oder Tod«
Aber nicht nur US-Unternehmen wie Rivian oder Tesla, auch die unzähligen chinesischen Autoproduzenten haben offenbar weniger Probleme, Fahrzeuge von der Software her zu entwickeln. Tatsächlich hatte die Volksrepublik früher als alle anderen Automobilherstellernationen verstanden, dass die elektronische Antriebswende und die Digitalisierung des Autos eine Chance bieten, die technologischen Rückstände gegenüber den großen internationalen Autokonzernen zu kompensieren und eine führende Rolle auf dem globalen Automobilmarkt einzunehmen. So förderten der chinesische Staat und viele Provinzen in großem Maßstab nationale Autobauer etwa über Kredite oder Rabatte für Kunden, verpflichteten sie aber gleichzeitig auf bestimmte Quoten für Elektro- und Hybridmotoren. Was Europas Wirtschaftsliberalen als Gängelei erscheinen mag, schaffte für die chinesischen Unternehmen Planungssicherheit. Heute verfügt die chinesische Autoindustrie nicht nur über einen jahrelangen technologischen Vorsprung im Bereich Elektrobatteriezellen, sondern chinesische Firmen sind auch deutlich vertikaler aufgestellt, sprich: Sie integrieren den gesamten Produktionsprozess von den Batterierohstoffen bis zur Softwareentwicklung in einem Unternehmen, anstatt auf Fremdanbieter zurückzugreifen. Der weltgrößte Automobilzulieferer Bosch hat sich dagegen bereits 2018 aus der Forschung zu Batteriezellen zurückgezogen. Der Grund: Angesichts der etablierten asiatischen Konkurrenz und deren Kostenvorteilen rechneten sich die Stuttgarter als Newcomer keine Chancen aus.
Kurzum: Die globalen Machtverhältnisse in der Automobilindustrie haben sich mit der „doppelten Transformation“ zugunsten Chinas verschoben. 2023 kamen 60 Prozent aller 13 Mio. weltweit verkauften Electric Vehicle (Hybrid und batterieelektrisch) aus der Volksrepublik.[7]
Besonders schmerzlich bekommt das VW zu spüren. Die Wolfsburger waren einer der ersten großen Autobauer, die sich in China etabliert hatten. Die Position als verkaufsstärkster Hersteller in der Volksrepublik musste VW jedoch 2023 an das Unternehmen BYD abgeben. Im dort immer wichtiger werdenden Elektrosegment spielt VW heute keine Rolle. Unter den zehn in China am meisten verkauften Elektromodellen findet sich weder eines von VW noch das irgendeines anderen traditionellen Autobauers.
Aber auch auf dem europäischen Markt läuft es für VW alles andere als rund. Im vergangenen Jahr landete der Konzern in Europa mit seinen verkaufsstarken Marken VW, Skoda und Audi nur noch hinter Tesla auf Platz zwei.[8] Das alles geschieht vor dem Hintergrund eines Marktes, der sich zumindest in den USA und Europa sehr viel langsamer entwickelt, als von der Industrie und Politik erwartet. In Europa ist der Marktanteil batterieelektrischer Fahrzeuge im ersten Halbjahr 2024 sogar von rund 15 auf 13 Prozent zurückgegangen, und auch in absoluten Zahlen sind die Elektro-Verkäufe rückläufig. In Deutschland, dem größten Markt der EU, brach der E-Markt zuletzt regelrecht ein, allein im Juni um 18 Prozent.[9]
Der Verweis auf zu geringe oder gar gekürzte staatliche Subventionen, wie die Streichung des sogenannten Umweltbonus für Elektroautos durch die Ampelkoalition Ende 2023, greift allerdings zu kurz, um den Rückgang zu erklären. Nüchtern betrachtet, fehlt es in Europa schlichtweg an bezahlbaren E-Autos, was in Zeiten kriselnder Wirtschaft und sinkender Massenkaufkraft besonders schwer wiegt. Das ist in erster Linie die Folge verfehlter Strategien der deutschen Autoindustrie. Diese setzte wie keine andere auf das „upmarket-Modell“, also auf immer schwerere und leistungsstärkere Pkws, auch im batterieelektrischen Segment. Das ist auch der Grund, warum die europäische Elektromobilität ein krasses Nord-Süd-Gefälle hat. 2023 gingen 82 Prozent aller verkauften E-Autos in die reicheren nördlichen Länder, obwohl diese lediglich einen Bevölkerungsanteil von 49 Prozent haben. Auch hier kamen die Milliarden-Subventionen vor allem den wohlhabenderen Haushalten zugute, die sich die hohen Preise für Elektrofahrzeuge leisten können.[10]
Was an der EU-Politik falsch läuft, zeigt sich bereits bei der Regulierung der CO2-Emissionsnormen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Demnach müssen Automobilhersteller bei ihren neu zugelassenen Fahrzeugflotten bestimmte Grenzwerte für den Kohlendioxidausstoß pro gefahrenem Kilometer einhalten. Erfüllen sie diese nicht, werden Strafzahlungen fällig. Mit batterieelektrischen Fahrzeugen können die Hersteller die für sie geltenden Werte für ihre Flotten insgesamt senken. Allerdings macht es für die EU dabei keinen Unterschied, ob es sich beim E-Auto um einen SUV handelt oder um einen Kleinwagen. Das Resultat: „Ein über zwei Tonnen schweres elektrisches SUV wie der Volkswagen ID.4 macht es VW also möglich, weiter Verbrenner-SUV wie den Tiguan zu verkaufen“, konstatiert die Sozialwissenschaftlerin Antje Blöcker in einer Studie für die Rosa-Luxemburg-Stiftung.[11]
Immer schwerer, immer teurer
Auch die Strafzölle werden an den Wettbewerbsnachteilen der europäischen Automobilindustrie im Elektrosegment kaum etwas ändern. So kostet der mit dem kleineren „VW ID.3“ vergleichbare „BYD Dolphin“ in China umgerechnet zwischen 12 000 und 13 000 Euro. Das VW-Modell ist dagegen nicht unter 36 000 Euro zu haben. Auch mit dem für BYD geplanten Strafzoll von 30 Prozent auf den Verkaufspreis dürfte es für das Unternehmen aus Shenzhen somit kein Problem sein, VW preislich auszustechen und immer noch eine gute Gewinnmarge einzufahren.
Wenn nun vor allem deutsche Autobauer massiv Front gegen die EU-Einfuhrzölle machen, ist allerdings Vorsicht geboten. BMW-Chef Oliver Zipse etwa spricht von einer „Sackgasse“, die „europäischen Unternehmen und Interessen“ schade. Zwar stimmt es, dass zu erwartende chinesische Gegenmaßnahmen vor allem Mercedes, BMW und Porsche treffen würden, die viele der in Deutschland produzierten hochpreisigen Autos nach China exportieren. Und damit wären auch unzählige Arbeitsplätze gefährdet. Was Zipse nicht sagt: Auch BMW und andere nichtchinesische Hersteller fertigen ihre Autos inzwischen in China und importieren sie nach Europa. Auch für diese Autos werden Zölle fällig. So lässt BMW den „SUV iX3“ ausschließlich im Werk in Shenyang produzieren und will die nächste Generation des vollelektrischen „MINI-Coopers“ in einem gemeinsam mit dem chinesischen Hersteller Great Wall Motors betriebenen Werk produzieren lassen.
Gewerkschaften und Betriebsräte warnen schon lange, dass mit der „doppelten Transformation“ eine neue Welle der Verlagerung auf sie zurollt. BMW beispielsweise lässt E-Autos und Batterien bald im neuen Werk im ungarischen Debrecen bauen, und VW hat komplementär zum Deal mit dem US-Start-up Rivian eine weitreichende Partnerschaft mit dem chinesischen Start-up Xpeng besiegelt. Mit dessen Hilfe soll die Entwicklungszeit für kleine und mittlere E-Fahrzeuge vom gegenwärtigen VW-Tempo (48 Monate) auf China-Tempo (24 Monate) reduziert werden.[12]
All das zeigt: Die deutsche und europäische Autoindustrie erlebt derzeit einen Gramsci-Moment: Das Neue ist noch nicht geboren, das Alte noch nicht tot. Eine kohärente Transformationspolitik müsste in dieser Situation eigentlich steuern, den Akteuren Planungssicherheit geben, durch Subventionen Investitionen in noch nicht profitable Zukunftstechnologien leiten, aber auch sicherstellen, dass die späteren Gewinne nicht an Aktionäre ausgezahlt, sondern reinvestiert werden. Auf diese Weise ließen sich auch aus ökologischer oder gewerkschaftlicher Sicht wünschenswerte Ziele auf die Agenda setzen, sei es die Stärkung der Mitbestimmung oder der Ausbau einer europäischen Schienenfahrzeugindustrie, die Förderung kleinerer Fahrzeugflotten oder öffentlicher und nicht privat organisierter Sharing-Dienste.
Aber zur Wahrheit gehört auch: Es fehlt an Akteuren, die eine solche Strategie verfolgen. Die EU-Politik ist noch immer neoliberal und lehnt eine weitergehende staatliche Wirtschaftspolitik ab. Und mit den jüngsten EU-Wahlen im Juni ist Brüssel deutlich nach rechts gerückt.[13]
Unter diesen Vorzeichen droht die doppelte Transformation zu einer sozialen wie auch ökologischen Katastrophe zu werden. Die einseitige Zollpolitik ohne Industrieleitlinien, wie sie aktuell die EU-Kommission verfolgt, und noch schlimmer, die nicht nur von Europas Rechtspopulisten, sondern auch von der CDU propagierte Abkehr vom sogenannten Verbrennerverbot, macht nicht nur die kleinsten Ansätze für eine weniger klimaschädliche Automobilindustrie zunichte. Sie gefährdet auch die 2,5 Mio. Arbeitsplätze in der Automobilindustrie der Europäischen Union, von denen 770 000 in Deutschland angesiedelt sind. Letzteres mag angesichts von 45 Millionen Erwerbstätigen hierzulande überschaubar klingen. Aber Regionen wie das Saarland, der Großraum Stuttgart oder die neuen ostdeutschen Automobilzentren um Leipzig oder Chemnitz hängen im wahrsten Sinne des Wortes am Auto. Und dank eines vielfach hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades und starker Betriebsräte ist die Autoindustrie eine der wenigen Branchen, in denen Facharbeiterinnen und -arbeiter nicht nur halbwegs faire Löhne bekommen, sondern auch, zumindest in den Großbetrieben, mehr oder weniger auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern agieren.
Das Risiko, dass große Teile davon unter die Räder der „doppelten Transformation“ geraten, ist real: Seit 2018 sind in Deutschland bereits über 60 000 Jobs in der Automobil- und Zulieferindustrie verloren gegangen. Der Großteil der Arbeitsplätze wurde bisher nicht bei VW, Mercedes-Benz und BMW abgebaut, sondern vor allem bei den Zulieferern. Ob globale Schwergewichte wie Bosch, ZF oder Mittelständler – kaum ein Zulieferer, der aktuell nicht Personal reduziert, Standorte schließt oder gleich Insolvenz anmeldet. Auch bei den Autokonzernen selbst steht ein Dammbruch an: Zuletzt haben sich VW-Vorstand und -Betriebsrat auf Kürzungen in Höhe von 20 Mrd. Euro geeinigt, mindestens 10 000 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden.
Für die IG Metall ist die Lage auch aus organisationspolitischen Gründen bedrohlich. Die Automobilindustrie bildet das Rückgrat ihrer Organisationsmacht. Etwa 35 Prozent der aktuell 2,13 Millionen IG Metall-Mitglieder gehören zur automobilen Wertschöpfungskette.
Unterm Strich geht es in der doppelten Transformation für die IG Metall um die grundsätzliche Frage: Schaut die größte Industriegewerkschaft der Welt nur zu, wie die Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie unter die Räder der Transformation kommen oder kann sie es verhindern?
Die IG-Metall in Bedrängnis
Was die betrieblichen Auseinandersetzungen angeht, hat die IG Metall gezeigt, dass sie durchaus in den Kampfmodus wechseln kann. An einigen Continentalstandorten oder zuletzt beim Zulieferer Driveline in Zwickau hat sie mit harten Streiks geplante Schließungen zwar nicht verhindern, wohl aber aufschieben können und zuvor nicht für möglich gehaltene Abfindungen sowie Millioneninvestitionen für Nachnutzungskonzepte der Standorte erkämpft. Bei Tesla im brandenburgischen Grünheide arbeitet ein professionelles Organizing-Team seit Produktionsbeginn vor zwei Jahren daran, betriebliche Stärke aufzubauen. Über 1000 Beschäftigte sollen der IG Metall bereits beigetreten sein. Bei der Betriebsratswahl im März wurde die Gewerkschaft mit knapp 40 Prozent stärkste Liste.
Eine schon praktizierte Erneuerungsidee sind zudem die sogenannten Zukunftstarifverträge, die die IG Metall in den vergangenen Jahren mit Branchengrößen wie ZF Friedrichshafen, Mahle und Bosch Mobility vereinbart hat. Was bürokratisch klingt, versprüht tatsächlich einen Hauch von Wirtschaftsdemokratie: Nicht die Geschäftsführung allein entscheidet darüber, wie sich Unternehmen für die Postverbrenner-Ära aufstellen. Betriebsräte und Management arbeiten gemeinsam an Zukunftskonzepten und beraten über neue Produkte, notwendige Investitionen und Qualifizierungsmaßnahmen. Ob sich diese sozialpartnerschaftlichen Ansätze behaupten werden, wenn für Bosch und Co. die Luft dünner wird, bleibt indes abzuwarten.
Fakt ist aber auch: Die Herausforderungen sind zu groß, um sie allein auf Unternehmensebene tarifpolitisch lösen zu können. Von einer umfassenden, betriebs- und branchenübergreifenden gesellschaftspolitischen Gesamtstrategie für eine sozial-ökologische Transformation und eine Verkehrswende ist die größte Industriegewerkschaft der Welt – wie auch die EU – immer noch weit entfernt. Querschüsse aus den Reihen der mächtigen Automobilbetriebsräte, wie die jüngste Forderung des Audi-Gesamtbetriebsratsvorsitzenden Jörg Schlagbauer, das EU-Verbrennerverbot aufzuweichen, zeigen, wie schwer es für die IG Metall ist, die kurzfristigen Interessen ihrer Klientel und eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie unter einen Hut zu bringen.
Gelingt diese Gratwanderung jedoch in Zukunft nicht, könnten die AfD und rechte Parteien in anderen europäischen Ländern noch größere Teile der Arbeiterschaft für sich gewinnen. Zumindest gegenwärtig liefert die EU keine geeigneten politischen Rahmenbedingungen, um eine solche Entwicklung zu verhindern. Vielmehr ist sie mit ihrer planlosen Politik auf dem besten Weg, nicht nur Hunderttausende Arbeitsplätze, sondern auch die ökologischen Potenziale der Antriebswende zu gefährden.
[1] Gerade die Herstellung der für E-Autos benötigten Batterien ist extrem CO2-intensiv. Der Treibhausgasrucksack, mit dem ein Elektroauto die Fabrik verlässt, ist um ein Vielfaches höher als bei einem Verbrenner. Je nach Strommix und Batterie muss ein Elektroauto erst einmal zwischen 80 000 und 120 000 Kilometer fahren, um eine günstigere CO2-Bilanz zu erreichen als ein vergleichbarer Verbrenner. Hinzu kommen immense soziale und ökologische Probleme beim Abbau der für die Produktion von E-Autos wichtigen Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt. Vgl. Jörn Boewe und Johannes Schulten, Die Transformation der globalen Automobilindustrie: Ein Handbuch für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Rosa-Luxemburg-Stiftung Genf, März 2023, S. 28 ff.
[2] Vgl. dazu ausführlich: Jörn Boewe und Johannes Schulten, a.a.O.
[3] Zit. nach Andreas Boes und Alexander Ziegler, Umbruch in der Automobilindustrie. Analyse der Strategien von Schlüsselunternehmen an der Schwelle zur Informationsökonomie. Forschungsreport, Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (Hg.), München 2021.
[4] Dieses und folgende Zitate stammen, sofern nicht anders gekennzeichnet, aus einem Forschungsprojekt, das die Autoren für das European Trade Union Institute (ETUI) durchgeführt haben.
[5] Zitiert nach Franz Hubik und Roman Tyborski, wie Stellantis dank Alexa an VW vorbeiziehen könnte, in: „Handelsblatt“, 28.2.2022.
[6] Andreas Boes, Das Scheitern der Cariad zeigt die deutschen Schwächen, faz.net, 12.7.2024.
[7] Rekordjahr für E-Autos – China dominiert den Weltmarkt, Pressemitteilung, mckinsey.com, 24.6.2024.
[8] Verkaufszahlen E-Autos: Das sind die meistverkauften Stromer 2023, enbw.com, 7.3.2024.
[9] Vgl. die Pressemitteilung von acea. Driving mobility for Europe, New car registrations: +4.3% in June 2024; battery electric 14.4% market share, acea.auto, 18.7.2024.
[10] Pardi Tommaso, Is Europe on track towards net zero mobility?, Working Paper 2024-07, etui.org, Brüssel 2024.
[11] Antje Blöcker, Die Automobilindustrie: Es geht um mehr als den Antrieb. Eine Studie im Rahmen des Projekts „Sozial-ökologische Transformation der deutschen Industrie“, Rosa-Luxemburg-Stiftung (Hg.), Berlin 2022.
[12] Andreas Boes, a.a.O.
[13] Steffen Vogel, Europawahl: Mit Rechts gegen den Klimaschutz, in, „Blätter“, 6/2024, S. 9-12.