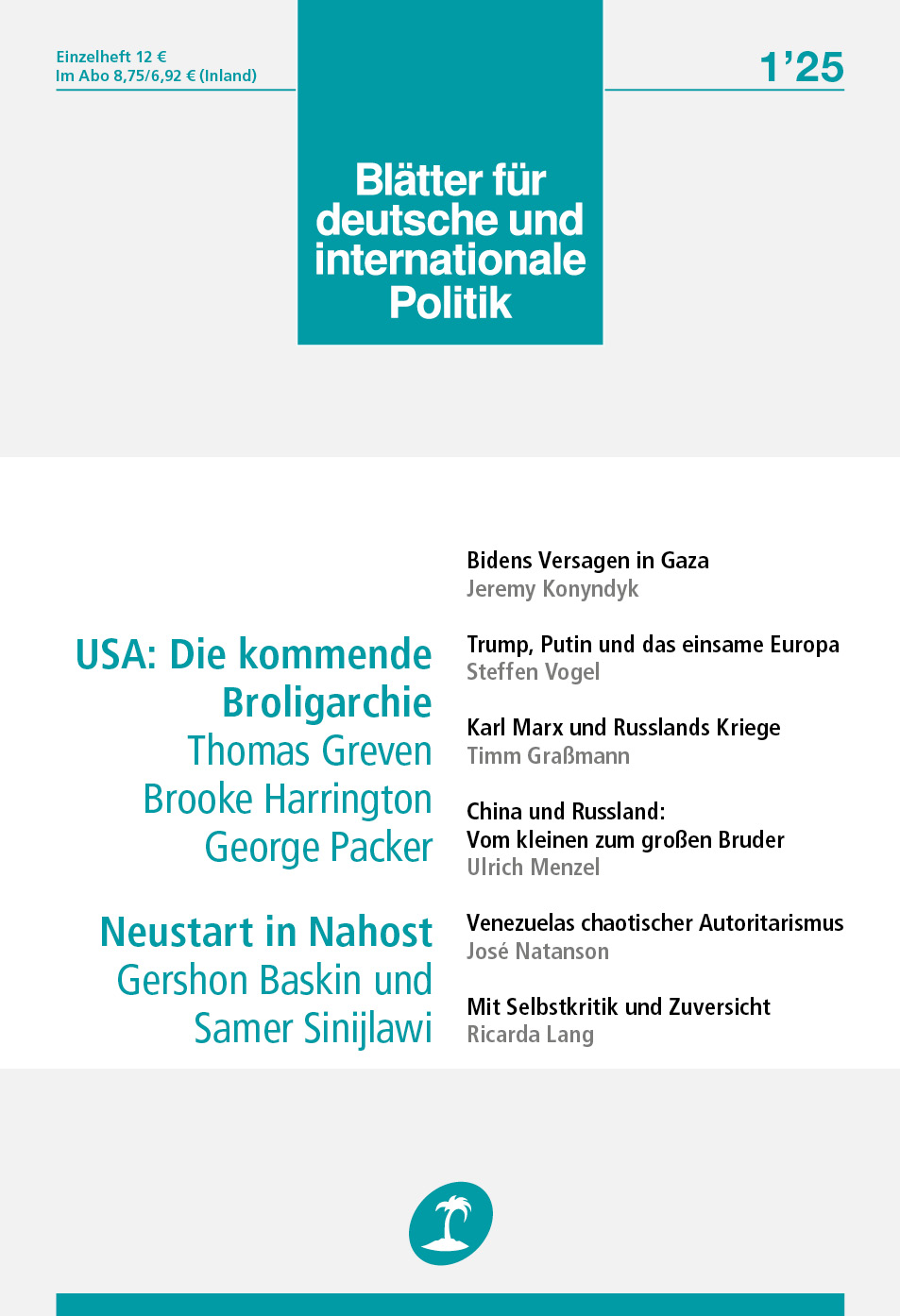Bild: Wolodymyr Zelenskij trifft den Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa in Kiew, 1.12.2024 (IMAGO / Bestimage)
Es ist einer jener Zufälle, die wirken, als stammten sie aus einem Drehbuch. Am 1. Januar kommt es in der Europäischen Union zu einem Stabwechsel, der kaum symbolträchtiger sein könnte: Ungarns halbjährige Ratspräsidentschaft endet, die von Polen beginnt. Viktor Orbán, der Autokrat, Putin-Verbündete und Trump-Bewunderer, übergibt an Donald Tusk, der im eigenen Land die Populisten zurückgedrängt hat und in Europa, gewissermaßen an vorderster Front, die Verteidigung gegen Moskaus Dominanzstreben organisiert. An vorderster Front steht Polen dabei in zweierlei Hinsicht: Es grenzt im Osten und Norden an die Ukraine, an die russische Exklave Kaliningrad und an den russischen Vasallen Belarus – und befindet sich damit in einer bedrohlichen Lage, erst recht, wenn die Ukraine den Krieg nach dem anstehenden Machtwechsel in den USA doch noch verlieren sollte. Und da Frankreich und Deutschland derzeit vor allem um sich selbst kreisen, sieht sich Warschau zusehends in die Rolle einer europäischen Führungsmacht gedrängt.
Viel deutlicher als an diesem Stabwechsel ließe sich nicht zeigen, in welch heikler Situation sich Europa heute befindet: In diesen für den Frieden auf dem europäischen Kontinent so entscheidenden Monaten, während im Osten der Krieg mit von Russland neu entfachter Härte wütet und im Westen der stärkste Verbündete abtrünnig zu werden droht, ringt die EU verzweifelt um ihre Einheit. Orbán und die prorussischen Kräfte, die in Budapest und Bratislava regieren und in Paris und Berlin eine starke Opposition stellen, fühlen sich von Donald Trumps Sieg bestätigt. Aber auch Tusk und die Regierungen der skandinavischen, baltischen und teils auch mittelosteuropäischen Staaten sehen sich bestätigt: in ihrer Kritik an der Zögerlichkeit großer westlicher Länder, aufgrund derer die Ukraine sich nun in einer Schwächeposition befindet, die vermeidbar gewesen wäre. Dazwischen stehen Regierungen im Westen und Süden der EU, deren Solidaritätsbekundungen mit dem angegriffenen Land bislang klarer ausgefallen sind als ihre tatsächliche Hilfe.
Kann dieses notorisch uneinige Europa in einer Welt bestehen, die sich derzeit epochal wandelt? Angesichts eines Russlands, das mit Gewalt auf eine imperiale Einflusszone drängt, die weite Teile Nordost- und Mittelosteuropas umfassen würde? Angesichts einer USA, die vielleicht soeben ihre vorerst letzte freie Wahl erlebt haben? In diesem rauer gewordenen Umfeld stehen die EU und ihre Partner zunehmend einsam da. Darauf müssen sie eine strategische Antwort geben. Aber Europa ist schlecht vorbereitet auf diese neue Realität.
Und so wächst kurz vor Trumps Amtseinführung am 20. Januar die Unsicherheit. Nicht zufällig nutzt das Putin-Regime diese Übergangsphase und attackiert die Ukraine besonders erbittert. Seit der US-Wahl zerstört die russische Armee mit gnadenloser Wucht die Energieinfrastruktur in der gesamten Ukraine, um eine ohnehin schon leidende Zivilbevölkerung weiter zu zermürben. Im Osten des Landes drängt sie bei ihrem Versuch, weitere Gebiete zu besetzen, die Verteidiger immer stärker zurück und nimmt dabei extreme eigene Verluste in Kauf, laut westlichen Angaben zeitweilig bis zu 1500 Tote und Verwundete – jeden grausamen Tag.
In diesem besonderen amerikanischen Interregnum werfen die Akteure noch einmal alles in die Waagschale: Moskau hat in der ukrainisch besetzten russischen Region Kursk nun erstmals ausländische Truppen eingesetzt, Tausende Soldaten aus Nordkorea. Die USA, Großbritannien und Frankreich reagierten auf diese weitere Internationalisierung des Konflikts, indem sie dem ukrainischen Militär erlaubten, militärische Ziele in Kursk mit von ihnen gelieferten weitreichenden Raketen und Marschflugkörpern zu beschießen. Den Einsatz solcher Waffen gegen russisches Territorium hatte der scheidende US-Präsident Joe Biden lange als zu riskant ausgeschlossen. Russland antwortete mit dem erstmaligen Abschuss einer experimentellen Mittelstreckenrakete auf die Stadt Dnipro – auch als warnende Geste an den Westen.
Mit dieser Zuspitzung tritt der Krieg kurz vor dem dritten Jahrestag der vollumfassenden russischen Invasion in eine neue Phase ein. Nicht zuletzt deshalb, weil sich Trump entschlossen gibt, das tödliche Patt aufzulösen, das sich auch aufgrund des langsamen Agierens des Westens unter Bidens Führung entwickelt hat. Seine Überzeugungskraft entfaltet Trumps disruptiver Ansatz ganz wesentlich aufgrund von strategischen Leerstellen, die etwa Jürgen Habermas früh im Handeln des Westens ausgemacht hat.[1] Im Kontrast zum Siegfriedenskurs der Nordosteuropäer erschöpfen sich die öffentlich erklärten Ziele der größten Unterstützer, allen voran Biden und Olaf Scholz, darin, eine Niederlage der Ukraine abzuwenden. Dahinter steht auch die Erwartung, dem Kreml werde der Krieg irgendwann als innenpolitisch zu riskant oder als nicht länger finanzierbar erscheinen. Jedoch hat sich schon im Winter 2023/24, als der US-Kongress monatelang die Ukrainehilfen blockierte, gezeigt, dass auch der Westen vor innenpolitischen Risiken und Finanzierungsproblemen steht – und also keineswegs sicher über den längeren Atem verfügt als das Putin-Regime. Solange aber keine der beiden Seiten ein Übergewicht erlangen kann – oder im Falle des Westens nicht erlangen will –, wäre ein Kriegsende erst nach allgemeiner Erschöpfung denkbar. Für die Ukraine bedeutete das einen Schrecken ohne Ende.
So erklärt sich, warum es in der Ukraine auch Stimmen gibt, die Trumps Wahlsieg etwas abgewinnen können. Sein Versprechen, den Krieg schnell zu beenden, stoße auf großen Widerhall bei all jenen Ukrainerinnen und Ukrainern, die unter den täglichen russischen Bombenangriffen leiden, schreibt beispielsweise Iuliia Mendel, die vor dem Krieg Pressesprecherin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war. Die „unerbittliche Last dieses Krieges“ untergrabe die Grundlagen der ukrainischen Gesellschaft. Ein Waffenstillstand sei das Beste, worauf das Land hoffen könne.[2]
Selenskyj wiederum hat sein Land bereits auf schmerzhafte Konzessionen eingestimmt. In einer Ansprache an das Parlament in Kiew sagte er in Anspielung auf das Alter des 72-jährigen Wladimir Putin: „Vielleicht muss die Ukraine jemanden in Moskau überleben, um alle ihre Ziele zu erreichen.“[3] In einem Gespräch mit Trumps Haussender Fox News wurde Selenskyj konkreter: „Wir können nicht Tausende unserer Leute sterben lassen, um die Krim zurückzubekommen. [...] Wir verstehen, dass die Krim auf diplomatischem Wege zurückgewonnen werden muss.“[4]
Selenskyjs Äußerungen sind Ausdruck der enormen Abhängigkeit seines Landes von den USA – und damit demnächst von Trump. Selbst seinen im Herbst 2024 vorgestellten „Siegesplan“ hat Selenskyj einem Medienbericht zufolge an Trump angepasst. Im Wissen um das transaktionale Verständnis von Außenpolitik des selbsternannten Dealmakers bot er ein investment screening an: Die USA könnten demnach kontrollieren, welche ausländischen Unternehmen in der Ukraine aktiv werden – und damit China den Zugang zum dortigen Markt versperren.[5]
Ein Korea-Szenario für die Ukraine
Selenskyjs Versuche, zu retten, was zu retten ist, sind nicht nur Ausdruck der zunehmend verzweifelten Lage seines Landes, sondern führen zu einer bitteren Erkenntnis: Dieses Kriegsende, wenn es denn wirklich kommt, wird weder der historischen Gerechtigkeit genügen – dann müsste Putin vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag landen –, noch dürfte es dauerhafte Sicherheit für die Ukraine und Europa bringen.
Das zeigt ein Blick auf die Planspiele, die aus dem Trump-Lager nach außen gedrungen sind und die ein Einfrieren des Konflikts vorsehen.[6] Demnach würde die Ukraine für 20 Jahre auf eine Nato-Mitgliedschaft verzichten, dafür vom Westen massiv aufgerüstet werden, um Moskau von weiteren Angriffen abzuschrecken. Auf den gut 1300 Kilometern Frontlinie – die nicht zuletzt quer durch vier von Russland annektierte, aber nicht vollständig kontrollierte Oblaste verläuft –, würde eine Pufferzone errichtet, die nach Vorstellungen der Trump-Berater europäische Soldaten überwachen sollen. Das aber würde das Risiko von Zusammenstößen mit russischen Truppen bergen – also eine Situation schaffen, die die Nato seit 2022 tunlichst zu vermeiden versucht.
Einen ganz ähnlichen Vorschlag hat Trumps designierter Ukraine-Sondergesandter Keith Kellogg schon im vergangenen April unterbreitet. In einem Bericht skizzierte er einen „America First-Ansatz“ für ein rasches Kriegsende, das der Devise „Frieden durch Stärke“ folgen soll. „Die Vereinigten Staaten würden die Ukraine weiter bewaffnen und ihre Verteidigung stärken, um sicherzustellen, dass Russland nicht weiter vorrückt und nach einem Waffenstillstand oder Friedensabkommen nicht wieder angreift. Die künftige amerikanische Militärhilfe wird jedoch von der Bedingung abhängen, dass die Ukraine an Friedensgesprächen mit Russland teilnimmt.“[7] Man werde von Selenskyj nicht verlangen, auf die besetzten Gebiete zu verzichten, diese müssten aber auf diplomatischem Wege zurückgewonnen werden, was wohl erst nach Putins Abtritt möglich sei.
Die durchgesickerten Pläne erinnern an das sogenannte koreanische Szenario, über das schon lange vor Trumps Wahl debattiert wurde. Das darf man nicht mit wirklichem Frieden verwechseln. Auf der koreanischen Halbinsel stehen sich zwei hochgerüstete Armeen gegenüber, getrennt von einer Demilitarisierten Zone am 38. Breitengrad – und das seit dem Waffenstillstand von 1953. Wie negativ ein latent gehaltener Konflikt auch die inneren Verhältnisse prägt, hat der 3. Dezember dramatisch gezeigt, als in Seoul Präsident Yoon Suk Yeol mit dem Kriegsrecht die Demokratie aushebeln wollte.
Und selbst wenn Südkorea offiziell die Wiedervereinigung anstrebt, sind durch das Einfrieren des Konflikts doch Fakten geschaffen worden: die nun seit über 70 Jahren währende Teilung des Landes in zwei Staaten. Mit einer „Korea-Lösung“ würde der Ukraine also ein dauerhafter Gebietsverlust drohen. Ukrainische Bürger würden der Gnade eines Besatzers überlassen, der nach UN-Angaben systematisch Kriegsgefangene foltert.[8]
Bei den Diskussionen um Trumps mutmaßliche Pläne gerät allerdings etwas Wichtiges aus dem Blick: Russland müsste diesen Vorschlägen zustimmen. Denn dass nun sowohl in Moskau als auch in Washington autoritäre Anführer an der Macht sind, bringt die unterschiedlichen strategischen Interessen beider Länder nicht zum Verschwinden. Eine Lösung, die in beiden Hauptstädten als Erfolg oder gar Sieg der eigenen Seite interpretiert werden könnte, ist alles andere als leicht zu finden. Die russische Politikwissenschaftlerin Tatiana Stanovaya meint sogar: „Das Problem für Putin ist, dass keine westliche Führung – einschließlich Trump – einen Plan zur Beendigung des Krieges im Sinn hat, der für den russischen Staatschef annähernd akzeptabel wäre.“[9]
Anders als bei Trump sind Putins Vorstellungen lange bekannt. Sie haben sich seit dem 24. Februar 2022, dem Beginn seiner offiziell immer noch so genannten „Militärischen Spezialoperation“ nicht wesentlich verändert. Ausführlich äußerte sich Putin zuletzt etwa im Juni 2024 in einer Ansprache vor Führungskräften im russischen Außenministerium. Als Vorbedingungen, um in Verhandlungen mit der Ukraine zu treten, nannte er dort: „Die ukrainischen Truppen müssen vollständig aus den Volksrepubliken Donezk und Luhansk und den Regionen Cherson und Saporischschja zurückgezogen werden. [...] Sobald Kiew seine Bereitschaft zu dieser Entscheidung erklärt und einen echten Truppenrückzug aus diesen Regionen einleitet sowie offiziell verkündet, dass es seine Pläne zum Nato-Beitritt aufgibt, wird unsere Seite augenblicklich einen Waffenstillstand und den Beginn von Verhandlungen anordnen.“[10] Was im Planspiel des Trump-Lagers ein Ergebnis der Gespräche sein könnte, ist bei Putin also bloß die Voraussetzung, um überhaupt zu reden.
Putins eigentliche Forderungen gehen deutlich weiter: „Wir reden nicht über ein Einfrieren des Konflikts, sondern über seine endgültige Lösung. [...] Die Ukraine sollte einen neutralen, blockfreien Status einnehmen, atomwaffenfrei sein und sich einer Demilitarisierung und Entnazifizierung unterziehen.“[11] Zu Deutsch: Russlands Ziele bleiben der Sturz der Regierung Selenskyj und die massive Schwächung des ukrainischen Militärs – was für die dann nicht mehr verteidigungsfähige Ukraine auf einen Vasallenstatus nach belarussischem Muster hinausliefe.
Zwar hat Putin nach Trumps Wahlsieg Gesprächsbereitschaft signalisiert, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf anonyme Quellen im Kreml berichtet, aber es bleibt auch laut diesem Bericht dabei: Putin will nicht die Frontlinie einfrieren, sondern beansprucht in Gänze die vier ukrainischen Oblaste, die Russland offiziell annektiert hat, aber nur zu 70 bis 80 Prozent kontrolliert. Und Nato-Truppen auf ukrainischem Territorium – wie im Trump-Planspiel vorgesehen –, sind für Moskau inakzeptabel.[12]
Überreizt Putin?
Auf diesen Gegensätzen basiert die schwache Hoffnung einiger ukrainischer Analytiker und russischer Oppositioneller: Putin könnte stur auf seinen Forderungen bestehen und damit Trump und die außenpolitischen Falken in seinem Kabinett wie den designierten Außenminister Marco Rubio verärgern. Der russische Journalist Konstantin Skorkin bringt es so auf den Punkt: „Falls sich der Kreml weigert, einen Deal zu akzeptieren, was sehr wahrscheinlich ist, wird der US-Präsident die Hilfe an die Ukraine fortsetzen oder sogar verstärken, da dies auch der amerikanischen Rüstungsindustrie nützt.“[13] Auch der Historiker Brendan Simms weist darauf hin, dass Trump in seiner ersten Amtszeit einen „eher harten“ Kurs gegenüber Moskau gefahren sei, unter anderem durch Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Nord Stream II: „Trump war eigentlich gar nicht prorussisch, was die reale Politik betrifft, sondern eher härter als Obama und als Biden.“[14]
Auf Europa aber kommen in jedem Fall schwere Zeiten zu: Sollte Trump tatsächlich auch in seiner zweiten Amtszeit einen scharfen Kurs gegenüber Moskau fahren, würde er die EU-Europäer sicher zu deutlich erhöhten Rüstungsausgaben drängen. Sollte er hingegen auf einen raschen Waffenstillstand zielen, dessen Konditionen dem Kreml zupasskämen, stünde die EU einem triumphierenden Putin und seinen kampferprobten Truppen gegenüber. Auf 1,5 Millionen Soldaten soll die russische Armee künftig anwachsen, damit wäre sie die zweitgrößte der Welt.[15] Ohne die hohen Verluste, die die ukrainischen Verteidiger den Invasoren derzeit zufügen, könnte Russland binnen weniger Jahre eine enorme Streitmacht aufbieten. Gepaart mit einem zuhause als Sieg präsentierten Kriegsende würde das die Gefahr eines Nachfolgekrieges bergen, ob in der Ukraine oder anderswo.
Einen Vorteil hat das bekanntgewordene Planspiel aus dem Trump-Lager: Es zeigt anschaulich, was Europa zugedacht ist und wie wenig Rücksicht auf traditionelle Verbündete das Trump-Lager zu nehmen bereit ist. Denn die Kontrolle einer Pufferzone entlang der 1300 Kilometer langen Front würde Zehntausende Soldaten erfordern. Allein im sehr viel kleineren Gebiet im Süden des Libanon sind rund 10 000 UN-Blauhelme stationiert. Auch wenn sich inzwischen mehrere Regierungen für die Idee offen zeigen, wären allein die finanziellen Aufwendungen enorm. Dazu käme innenpolitischer Streit um die Frage, ob man wirklich in einer Konfliktzone Soldaten europäischer Natostaaten in Schussweite von russischen stationieren möchte. Klar ist aber auch: Die Ukraine braucht verlässliche Sicherheitsgarantien, soll ein Waffenstillstand mehr sein als „eine Pause im Massenmord“ (Maksym Butkevych).[16]
Rücksicht muss Trump aber auch deswegen nicht nehmen, weil Washington bei der Unterstützung für Kiew extrem dominant ist: Je 43 Prozent der Militärhilfe entfallen auf USA und EU.[17] Um ausbleibende amerikanische Lieferungen zu ersetzen, müssten die Europäer ihre Ausgaben also verdoppeln. Ist schon das allenfalls theoretisch möglich, besteht in einzelnen Bereichen, so ausgerechnet bei der für den Schutz von Zivilisten und Infrastruktur so wichtigen Luftabwehr, eine fast vollständige Abhängigkeit von den USA.[18] Zwar können die EU-Staaten die Ukraine so zu unterstützen versuchen, dass sie immerhin in eine bessere Verhandlungsposition kommt, müssen aber wie die Regierung in Kiew schlicht hoffen, dass Washington keine drastischen Schritte unternimmt – und etwa durch Lieferstopps die Luftabwehr der Ukraine fatal schwächt, was im Wortsinne verheerende Folgen hätte.
Angesichts von Trumps Druckpotential und Putins Drohungen stellt sich die Frage: Hält Europa zusammen? Orbán hat schon erklärt, er sei in den Augen Trumps der erste Ansprechpartner für Europa.[19] Diesen Führungsanspruch dürften die anderen EU-Regierungen zwar zu ignorieren versuchen, aber tatsächlich sind die Beziehungen zwischen beiden Politikern so eng, dass Trump über den ungarischen Premier Zwietracht in der EU säen könnte.[20]
Selbst ohne Orbáns Zutun dürften sich in der EU die Spannungen verschärfen: zwischen dem Nordosten, der die von Russland ausgehende Gefahr kennt und ernst nimmt, und dem Südwesten, der sich weit weg wähnt. Eine Brücke müssten Deutschland und Frankreich bauen, beide sind aber gerade gelähmt – bezeichnenderweise aufgrund von Haushaltsstreits, was in Paris zum Sturz der Regierung Barnier geführt hat. Die EU legt sich mit ihrer, wesentlich deutsch geprägten, Schuldenobsession selbst Fesseln an. Wie sollen die EU-Staaten die leider nötigen höheren Verteidigungsausgaben stemmen, wenn mit Frankreich, Italien und Spanien die zweit-, dritt- und viertgrößten Volkswirtschaften der EU über Schuldenstände verfügen, die sie unter den gegebenen Regeln schon jetzt zum Kürzen zwingen und Investitionen mindestens erschweren? Helfen würden gemeinsame Anleihen nach dem Vorbild der Coronabonds, nun aber für Verteidigung, was etwa Frankreich und Estland befürworten. Berlin aber steht bislang auf der Bremse.
Auf Europa kommen damit schwierige Debatten zu: Erhöhte Verteidigungsausgaben durch Kürzungen im Sozialstaat zu kompensieren, beschwört massive Verteilungskonflikte herauf – und wäre angesichts der schon jetzt starken sozialen Ungleichheiten auch nicht zu rechtfertigen. Hingegen dürften mehr Schulden in Staaten wie Deutschland und den Niederlanden auf deutlichen Widerstand im bürgerlichen Lager stoßen.
Der Bedrohung ins Auge sehen
Obendrein bieten sich Trump vielfältige Möglichkeiten, dies alles noch komplizierter zu machen: Erhebt er beispielsweise Schutzzölle auf EU-Produkte, würde dies insbesondere die exportabhängige deutsche Wirtschaft hart treffen – und es damit indirekt auch der Bundesregierung schwerer machen, Finanzmittel für die Ukraine bereitzustellen. Dazu kommt, dass der Nato-Beistand der USA unter Trump keineswegs als so selbstverständlich erachtet werden kann wie noch unter Biden. Europas Regierungen werden also vorsichtshalber noch mehr in die eigene Abschreckung gegenüber Moskau investieren, als sie es zuletzt schon getan haben – zumal sie eine Stärkung Putins durch ein für ihn günstiges Ende des Krieges fürchten müssen.
Bei diesen Kalkulationen mit vielen Unbekannten drohen diejenigen an den Rand gedrängt zu werden, die auf all dies den geringsten Einfluss haben: die Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie haben fast drei Jahre Kälte und Bombenterror getrotzt, haben horrende Verluste an menschlichen Leben erlitten, haben sich, nur unzureichend bewaffnet, einer entfesselten Kriegsmaschinerie entgegengestellt und halten ihr Schicksal doch nicht völlig in den eigenen Händen. Falls sich in der EU die Haltung durchsetzt, notgedrungen eher die eigenen Grenzen gegen mögliche russische Invasoren zu schützen, als weiter hohe Summen für ein Land aufzubringen, das dem oft ignoranten Blick vieler Westeuropäer immer noch fremd erscheint, dann würde die Ukraine einem Diktat aus Moskau wenig entgegensetzen können.
Ein Hoffnungszeichen ist das am 19. November 2024 auf Einladung Polens erstmals zusammengetretene erweiterte Weimarer Dreieck. Neben Deutschland, Frankreich und Polen gehören ihm Italien und Spanien an – also alle großen, wirtschaftsstarken Flächenländer der EU – plus die Atommacht Großbritannien, die sich unter Labour-Premier Keir Starmer wieder der EU annähert. Sogar auf Eurobonds haben sich die Teilnehmer laut dem polnischen Außenminister Radosław Sikorski geeinigt.[21] Dieser Punkt muss wohl bis nach der Bundestagswahl im Februar offenbleiben. Aber das Forum soll verstetigt werden und könnte im günstigsten Fall das dringend benötigte Kraftzentrum bilden, um Kiew am Leben und Moskau in Schach zu halten.
Wie so oft in Krisen der vergangenen Jahre müssen also einzelne Regierungen vorangehen, um eine gemeinsame Antwort zu finden. Erstmals könnte diese Rolle nun Polen zufallen, in dessen leidvoller Geschichte der Freiheitskampf gegen Besatzer eine große Rolle spielt. Doch zeigt das erweiterte Weimarer Dreieck auch: Ein geeintes Europa ist inzwischen nur noch unter Einschluss illiberaler Kräfte zu erreichen. Allein unter den Nettozahlern der EU, auf die es künftig verstärkt ankommen wird, finden sich mit Italien und den Niederlanden zwei rechts regierte Länder. Immerhin hat ihre Einbindung die Spaltung der autoritären Kräfte vertieft. Kaum auszudenken, in welcher Lage sich Europa befände, hätten sich Rom und Den Haag auf die Seite von Budapest und Bratislava geschlagen, also auf die von Moskau.
Jedoch ist ihre Einbindung eine weitere Gefahr für die ohnehin erodierenden normativen Grundlagen der EU. Schon jetzt hat der Rechtsruck in vielen der 27 Mitgliedstaaten den menschenrechtlichen Anspruch Europas teilweise zur Farce verkommen lassen, vor allem im Umgang mit Schutzsuchenden an den Außengrenzen. Nun könnte ausgerechnet Italiens postfaschistische Regierungschefin Giorgia Meloni der EU eine Brücke zu Trump bauen: Mit dessen neuem Verbündeten, dem Tech-Oligarchen Elon Musk, ist sie befreundet und mit Trump selbst verbindet sie ideologisch so manches. Gleichzeitig steht sie, anders als Orbán, fest an der Seite Kiews.
Nach der Ukraine hat Europa derzeit am meisten zu verlieren. Ein imperialistisches Russland wird absehbar eine Bedrohung für den Frieden sein. Der Konflikt mit Moskau muss nicht hybrid bleiben. Dies auszusprechen, beschert Politikern nicht nur Sympathiebekundungen. Aber Beschwichtigungsrhetorik schafft diesen Konflikt nicht aus der Welt. Eine aufgeklärte Debatte verlangt, dass man die Bedrohung benennt – und danach handelt.
[1] Jürgen Habermas, Ein Plädoyer für Verhandlungen, in: „Süddeutsche Zeitung“, 14.2.2023.
[2] Iuliia Mendel, Donald Trump Will Be President: Let’s Not Dramatize, kyivpost.com, 6.11.2024.
[3] Andrea Januta, Martin Fornusek und Asami Terajima, Zelensky presents resilience plan: ‘Ukraine may need to outlive someone in Moscow to achieve all the goals’, kyivindependent.com, 19.11.2024.
[4] Greg Norman und Trey Yingst, Zelenskyy answers whether he’s willing to cede Crimea, other territory in peace deal, foxnews.com, 20.11.2024.
[5] Zelensky’s Plan to Replace US Troops in Europe with Ukrainian Forces Gets Trump’s Attention, kyivpost.com, 12.11.2024.
[6] Alexander Ward, Trump Promised to End the War in Ukraine. Now He Must Decide How, wsj.com, 6.11.2024.
[7] Keith Kellogg und Fred Fleitz, America First, Russia, & Ukraine, americafirstpolicy.com, 11.4.2024.
[8] UN rights chief warns of ‘widespread and systematic’ torture of Ukrainian POWs, un.org, 8.10.2024.
[9] Tatiana Stanovaya, Was bedeutet Trumps Wahlsieg für Russland?, ipg-journal.de, 19.11.2024.
[10] President of Russia Vladimir Putin’s speech at the meeting with senior staff of the Russian Foreign Ministry, Moscow, June 14, 2024, mid.ru, 14.6.2024.
[11] Ebd.
[12] Guy Faulconbridge, Exclusive: Putin, ascendant in Ukraine, eyes contours of a Trump peace deal, reuters.com, 20.11.2024.
[13] Yulia Akhmedova und Lyubov Borisenko, Putin’s Trump card, novayagazeta.eu, 8.11.2024.
[14] Historiker über US-Wahl: „Trump glaubt, die Deutschen hauen die USA übers Ohr“, fr.de, 17.11.2024.
[15] Andrew Osborn, Putin orders Russian army to become second largest after China’s at 1.5 million-strong, reuters.com, 16.9.2024.
[16] Vgl. „Gewalt habe ich falsch verstanden“, taz.de, 7.12.2024.
[17] Oleg Sukhov, Ukraine aid key to battling Russian invasion — Can Europe fill the gap if Trump pulls the plug?, kyivindependent.com, 18.11.2024.
[18] Gustav Gressel, Der Untergang: As Trump returns, Putin will reap the rewards of Europe’s inaction on Ukraine, ecfr.eu, 15.11.2024.
[19] Trump, Musk, Orbán: l’Union est-elle prête? Les réponses de Thierry Breton, legrandcontinent.eu, 8.11.2024.
[20] Iuliia Akhmedova, Zweifel an Orbáns Rolle als US-Vermittler für Europa, euractiv.de, 19.11.2024.
[21] Aleksandra Krzysztoszek und Charles Szumski, Europäische Außenminister erwägen gemeinsame Schulden für Verteidigungsausgaben, euractiv.de, 20.11.2024.