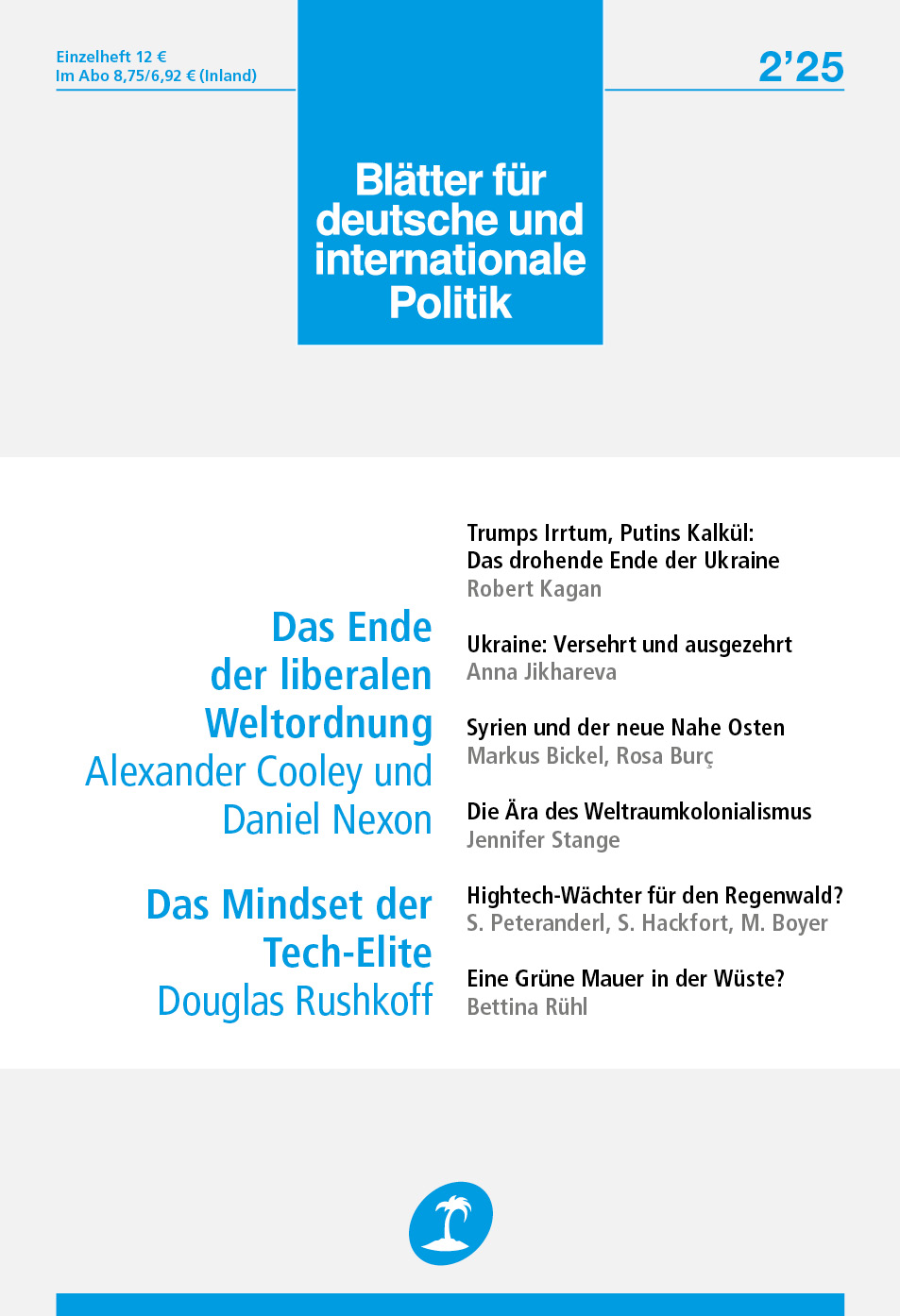Wie Musk und Trump das All privatisieren

Bild: Start einer SpaceX Falcon 9 Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Die Rakete transportiert 24 Starlink-Satelliten, 11.11.2024 (Craig Bailey / IMAGO / Imagn Images)
„So wie man sein Baby nachts hält“, genau so hätten die Greifarme die Rakete gehalten, als sie sanft und sicher zur Startrampe zurückkehrte. In seiner 30-minütigen Siegesrede am 6. November 2024 spricht Donald Trump drei Minuten allein von dieser „wunderschönen, glänzend weißen Rakete“ – und ihrem Besitzer Elon Musk. Dieser darf jetzt nicht nur auf noch mehr staatliche Unterstützung für seine Weltraumgeschäfte zählen. Mittlerweile leitet er das „Department of Government Efficiency“ (DOGE) – ein Posten wie geschaffen für einen Unternehmer, der sich in der Vergangenheit mehrfach durch Gesetze und Regeln drangsaliert fühlte – etwa durch Arbeitsschutzvorschriften bei Tesla oder Sicherheitsprotokolle für Raketenstarts bei SpaceX. Denn diese verlaufen nicht immer so wundervoll, wie es Trump in seiner Rede beschrieben hat. Die „New York Times“ berichtete 2023 von Explosionen, Bränden und herabfallenden Raketentrümmern bei SpaceX-Starts am Rand des Naturschutzgebiets im texanischen Boca Chica.
Auch die zuständige Behörde für Flugsicherheit, die Federal Aviation Administration (FAA), monierte Verstöße: Unter anderem verhängte sie wegen unautorisierter Änderungen an Sicherheitsprotokollen bereits mehrfach Geldstrafen gegen das Raumfahrtunternehmen. Musk reagierte darauf mit dem Vorwurf, die Behörde treffe politisch motivierte Entscheidungen, und hatte angekündigt, die FAA wegen „Überregulierung“ verklagen zu wollen. Das wird wahrscheinlich nicht mehr nötig sein, wenn Musk selbst zukünftig die Vorschriften macht.
Das Schicksal der Vereinigten Staaten liege in den Sternen, erklärte Trump bereits im Januar 2021 in seiner letzten Rede als 45. Präsident der USA. Er meinte das wörtlich und lobte sich selbst für die Gründung der US-Space-Force, der ersten Weltraumarmee. Diese sei eine „monumentale Errungenschaft“. Er hatte außerdem ein Dekret erlassen, wonach der Weltraum nicht länger „globales Gemeingut“, sondern Gebiet legitimer öffentlicher und privater Ressourcengewinnung sei. Nichts davon wurde unter Präsident Joe Biden revidiert. Doch am Ende verkörpert eben Trump die rechtslibertäre Geisteshaltung, die Musk und anderen Weltraumadvokaten näher liegt. Und so konnte Trump mit Musks Geld und Wahlkampfauftritten sowie dessen Plattform X die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Im Gegenzug bekommt der Raumfahrtunternehmer jetzt mehr Macht und noch bessere Geschäftsmöglichkeiten. Auch mit großzügiger staatlicher Unterstützung für seine Siedlungspläne auf dem Mars kann er bald rechnen.
Wiederholt sich die Kolonialgeschichte im Weltall?
In halsbrecherischem Tempo arbeiten Unternehmen wie SpaceX und Blue-Origin daran, die Ersten zu sein. Sie wollen den Weltraum für ihr Kapital erschließen, Himmelskörper besiedeln und deren Ressourcen ausbeuten – nach altbekanntem Muster. Denn wie es aussieht, könnten die neuen Weltraumunternehmer auf Mond und Mars eine ähnliche Rolle spielen, wie europäische Kapitalgesellschaften und Handelskompanien in Afrika, Amerika und Asien. Mit Rückendeckung ihrer Königreiche und Vaterländer konnten sie Eigentumsfragen gewaltsam für sich entschieden. So schufen sie eine ökonomische und soziale Ordnung, die bis heute unseren Planeten prägt. Könnte sich Kolonialgeschichte im Weltraum wiederholen?
Das wäre nach heutigen Rechtsmaßstäben eindeutig völkerrechtswidrig, sagt Völkerrechtler Stephan Hobe. „Wenn Staaten und vor allem private Akteure sagen: So, jetzt rüsten wir uns für die nächste Mission, die darauf aus ist, sich entsprechende Ressourcen anzueignen, dann ist das unrechtmäßig.“ Hobe gilt als der deutsche Experte in Sachen Weltraumrecht und ist Professor für Völkerrecht, Europarecht, Internationales Wirtschaftsrecht und leitet an der Universität Köln das Institut für Luft- und Weltraumrecht, eines der weltweit führenden Zentren zur Erforschung und Entwicklung dieses Rechtsgebiets. Für ihn steht fest: Es existiert keine internationale Vereinbarung, die das Geschäft privater Akteure im Weltraum legitimiert.
Genau das war über Jahrzehnte Konsens, so wurde der Weltraumvertrag von 1967 gelesen. Mit dem Aufkommen der kommerziellen Raumfahrt hat sich allerdings auch die Rechtsauffassung verschoben. Güne¸s Ünüvar vom Luxembourg Centre for European Law gehört zu einer wachsenden Zahl von Juristinnen und Juristen, die meinen, bestehendes Weltraumrecht sei eben nicht eindeutig, wenn es um den Besitz und die Aneignung intergalaktischer Ressourcen geht. Der Rechtsberater der Moon Village Association[1], ein Verbund, der sich als neutraler Vermittler verschiedener Interessen auf dem Mond präsentiert, glaubt, es sei nicht mehr „realistisch“, Unternehmen zu verbieten, Weltraumressourcen zu nutzen oder zu besitzen. Neue internationale Regelungen hält Ünüvar nur für möglich, wenn darin die Interessen von Unternehmen berücksichtigt werden, um diese Unternehmer dann auch in die „ökologische Verantwortung“ für Himmelskörper zu nehmen.
Dieser Ansatz, der zunehmend auch in den Bereichen Datenregulierung und Umweltschutz verfolgt wird, spiegelt die wachsende Macht des Privatsektors in globalen Angelegenheiten wider. Nach diesem Muster versucht die Europäische Weltraumorganisation (ESA), Unternehmen wie SpaceX zur Unterzeichnung ihrer „Zero Debris Charter“ zu bewegen. Sie zielt darauf ab, bis 2030 die Entstehung neuen Weltraummülls zu verhindern, soll aber auf Freiwilligkeit beruhen. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher betont die Notwendigkeit, private Akteure einzubeziehen, um die zunehmende Verschmutzung des erdnahen Raums durch private Satelliten wie die von Starlink zu bekämpfen. SpaceX betreibt mit Starlink eine der größten Satellitenflotten im niedrigen Erdorbit und dürfte schon heute einen nicht geringen Anteil an der Vermüllung der niederen Erdumlaufbahnen haben.
Appelle an Unternehmen statt verbindlicher Regeln
Der Weltraum ist der jüngste Schauplatz der massiven Deregulierung und Privatisierungsbestrebungen im Rahmen der herrschenden Wirtschaftsordnung. Dem voraus ging eine lange Geschichte voller Klagen frustrierter reicher Leute über die angeblich übermäßige Regulierung der Raumfahrt, die zu strengen Sicherheitsmaßnahmen und die Risikoaversion staatlicher Behörden.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sorgte Präsident Barack Obama für einen Paradigmenwechsel. Er stoppte 2010 das Constellation-Program der NASA, das den Weg für neue Mond- und Marsmissionen ebnen sollte, jedoch als zu teuer und ineffizient galt. Deshalb sollte die Raumfahrt weiter für private Akteure mit kostengünstigeren und flexibleren Ansätzen geöffnet werden. Doch um wirklich technologisch und kommerziell einen Unterschied zu machen, sollte es Unternehmern und Investoren möglich sein, eigene Ziele im Weltraum zu verfolgen. Um das rechtlich möglich zu machen, setzen die Vereinigten Staaten auf einen nationalen Alleingang. Im November 2015 gelang es der Obama-Administration, ein Gesetz namens Commercial Space Launch Competitiveness Act zuerst durch das von Republikanern geführte Repräsentantenhaus und dann den Senat zu bringen. Es legt fest, dass alles, was ein US-Bürger von einem Asteroiden oder einem Planeten „bergen“ kann, auch diesem US-Bürger gehört, genutzt und verkauft werden kann. Mit anderen Worten: US-Unternehmen können Ressourcen aus dem Weltraum gewinnen und damit Geld verdienen. Zwei Jahre später, 2017, verabschiedete Luxemburg, Mitgliedstaat der EU, Mitglied der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), ein ähnliches Gesetz. Es erlaubt Unternehmen den Abbau von Ressourcen im Weltraum. Das kleine Land ist nach den USA und neben der Schweiz wichtigster Fondsstandort und Sitz großer internationaler Banken, Versicherungsunternehmen, Vermögensverwaltern und seit jüngerer Zeit eben auch Heimathafen der Weltraumwirtschaft und ihren Lobbyorganisationen. Weitere Länder planen ähnliche Gesetze.
Unter Führung der USA initiierte die NASA 2020 mit den Artemis Accords eine Reihe von bilateralen Vereinbarungen. Darin regeln sie die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des Artemis-Programms, das unter anderem die Rückkehr von Menschen zum Mond und die Erforschung des Mars vorsieht. In diesen Verträgen wird behauptet, die kommerzielle Nutzung von Ressourcen im Weltraum, wie die Extraktion von Mondgestein oder Wasser, sei mit dem Weltraumvertrag von 1967 vereinbar. „Die Artemis Accords verdeutlichen, dass die USA dabei sind, ihren politischen Block aufzubauen“, sagt Weltraumrechtsexperte Ünüvar, „aber ohne die Beiträge von großen Akteuren wie China und Russland können sie nicht garantieren, dass Rechte und Operationen im Weltraum sicher sein werden“. Trotzdem haben mittlerweile sehr viele Länder die Artemis Accords unterzeichnet. Zuerst Australien, Kanada, Italien, Japan, Luxemburg, die Vereinigten Arabischen Emirate und Großbritannien. Später kamen Deutschland (2023), Schweden, Kolumbien, Ecuador, Island, Bulgarien und Österreich dazu.
Wirkungsloser Weltraumvertrag
Der Geist, in dem vor einem halben Jahrhundert Weltraumrecht geschaffen wurde, war ganz offensichtlich ein anderer als heute. Gleich in Artikel 1 des ersten völkerrechtlichen Abkommens, dem oben erwähnten Weltraumvertrag (Outer Space Treaty) von 1967, steht: „Die Erforschung und Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, soll zum Nutzen und im Interesse aller Länder erfolgen, ungeachtet ihres Entwicklungsstandes, und ist allen Staaten ohne Diskriminierung zugänglich.“ Der zweite Artikel verbietet im Weltraum sogar die „nationale Aneignung durch Souveränitätsansprüche, durch Nutzung oder Besetzung oder durch andere Mittel“.
Das Abkommen wurde im „Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums“ (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) mehrere Jahre verhandelt. Die Delegierten, die in den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren im COPUOS mehrere Jahre den ersten Weltraumvertrag verhandelten, waren sich der massiven Ungleichheiten zwischen den industrialisierten Kolonialmächten und den gerade erst unabhängig gewordenen neuen Nationen bewusst. Sie wollten verhindern, dass sich im All die Ungleichheiten der irdischen Welt reproduzieren. Der Weltraum sollte keinesfalls als terra nullius (Niemandsland), als ein vermeintlich leeres Territorium gelten, das von den Stärksten beansprucht, besiedelt und ausgebeutet werden könne. Stattdessen versuchte die internationale Staatengemeinschaft extraterrestrische Gebiete als res communis (Gemeingut) zu definieren.
Auf dem Papier gilt der Weltraumvertrag weiterhin. Allerdings hat er mit Blick auf heute brisante Fragen der Rohstoffausbeutung mindestens zwei Probleme: Die Macht des Gemeinguts, die in den genannten Passagen des Weltraumvertrags festgeschrieben steht, gerät ein paar Zeilen weiter bereits unter Druck. Da heißt es, „die Erforschung und Nutzung durch alle Staaten“ sei frei. Eine erstaunliche Wende, auch weil damals ja klar war, dass diese Freiheit in absehbarer Zeit nur die wenigsten genießen können würden. Neben den USA und der UdSSR, die immerhin ein paar Raketen und wenige Astronauten in den Weltraum geschickt hatten, war Frankreich das einzige Land, das bis Vertragsabschluss eigenständig einen Erdtrabanten in den Orbit geschossen hatte. Viele Länder haben bis heute kein Raumfahrtprogramm. Deutlich bildet sich das altbekannte globale Ungleichgewicht mittlerweile in den niederen Erdumlaufbahnen ab. Hier sind die besten Plätze bereits besetzt. Vor allem von Unternehmen, die ganze Satellitenflotten über unseren Köpfen kreisen lassen – Pech für alle Staaten, Unternehmen und Interessengruppen, die später dran sind.
Die noch größere Schwäche des Outer Space Treaty liegt allerdings woanders: Der Weltraumvertrag verbietet zwar die nationale Aneignung, lässt aber Privatpersonen und Unternehmen unerwähnt. Wahrscheinlich weil man sich damals nicht vorstellen konnte, dass es private Akteure mit genügend Geld geben könnte, die sich ein eigenes Raumfahrtprogramm leisten können, und die ihren Geschäftsbereich gerne in den Weltraum ausdehnen wollen würden. Jedenfalls sind das die Stellen, an denen Jurist Ünüvar „Unklarheiten“ sieht, die andere Weltraumadvokaten als Schlupflöcher bezeichnen.
For all mankind?
Der UN-Ausschuss COPUOS erkannte damals schnell, dass der Vertrag von 1967 allein nicht ausreichen würde. Fast ein Jahrzehnt wurde mit dem sogenannten Mondvertrag („Übereinkommen zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten auf dem Mond und anderen Himmelskörpern”) an spezifischeren Regelungen für die Nutzung und den Schutz des Mondes und anderer Himmelskörper gearbeitet. 1979 stand der Vertragstext. Er definiert den Mond, andere Planeten und Asteroiden als „das gemeinsame Erbe der Menschheit“ und verbietet explizit die Inbesitznahme: „Weder die Oberfläche noch der Untergrund des Mondes oder ein Teil davon sowie natürliche Ressourcen können Eigentum eines Staates, einer internationalen Organisation, einer nichtstaatlichen Einrichtung oder einer natürlichen Person werden.“ Gleichzeitig wird verlangt, dass alle Staaten – unabhängig von ihrem Entwicklungsstand – gleichberechtigten Zugang zu den Vorteilen der Mondforschung und -nutzung erhalten.
Es dauerte Jahre, bis dieser Vertrag 1984 in Kraft trat, nachdem er von nur neun Staaten, darunter Australien, Österreich, Belgien, Mexiko und den Philippinen, ratifiziert worden war. Die USA hatten den Vertag zwar mit ausgehandelt und unterzeichnet, aber der US-Senat weigerte sich, ihn zu ratifizieren. Die Regelungen galten als zu restriktiv bezüglich nationaler und kommerzieller Interessen im All. Russland, China und viele andere Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen folgten diesem Beispiel. Auch wenn mittlerweile 23 Staaten den Mondvertrag unterzeichnet und 18 ihn ratifiziert haben, bleibt er wirkungslos, weil gerade die Raumfahrtnationen ihn nicht anerkennen und mit Australien und Österreich zwei Unterzeichnerstaaten sich inzwischen auch den Artemis Accords angeschlossen haben.
Der Anspruch, eine galaktische Wiederholung des irdischen Imperialismus zu vermeiden, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Trotzdem wird immer noch gerne und oft behauptet, der Weltraum werde „für die gesamte Menschheit“, entdeckt, erforscht und erobert. „For all mankind“ hatte die Crew der Apollo-15-Mission 1971 die amerikanische Flagge in den Boden gerammt, eine Plakette für die „gesamte Menschheit” und später noch eine Bibel auf dem Mond abgelegt.
Die Weltraumbarone der Gegenwart entwickeln diese Rhetorik weiter. Bei allem, was sie tun, gehe es ihnen um nichts weniger als die Rettung der Menschheit ins Weltall, behauptet Musk. Jeff Bezos äußert sich ähnlich. Beide versprechen, was auch immer uns auf der Erde bedroht, wir können davor ins Weltall entkommen. Bezos will mit seinem Unternehmen Blue Origin die industrielle Produktion und Millionen von Erdbewohner:innen in erdnahe Lebensräume, sogenannte Spacepods bringen. Denn ohne „technologische und räumliche Expansion“, so Bezos, werde das wirtschaftliche Wachstum und damit die „gesamte Zivilisation zum Stillstand“ kommen. Der Weltraum und seine unbegrenzten Ressourcen machen es seiner Ansicht nach auch möglich, die Erde zu schonen. Die Vorstellung, besser und nachhaltiger mit irdischen Ressourcen umzugehen, scheint ihm dagegen einfach nicht realistisch.
Elon Musk hängt nicht so sehr an unserem Planeten. Er plant für den „Doomsday“, den Tag, an dem wir wegen des Dritten Weltkriegs, einer mörderischen KI oder des Klimakollaps gezwungen sein werden, die Erde zu verlassen. Richtung Mars, wenn es nach ihm ginge. Musk hat auch bereits eigenes Sperma eingefroren – als „Geschenk“ an die zukünftige Marsbevölkerung. Um die Atmosphäre von durchschnittlich minus 63 Grad Celsius auf überlebbare Temperaturen zu steigern, will er den Mars mit ein paar Atombomben „terraformieren“. Aber auch die NASA, andere Unternehmen und Weltraumagenturen diskutieren ernsthaft die erheblichen Herausforderungen, die vor einem Leben auf dem Mars stehen.
Der Weltraum ist längst zu einer geopolitischen Arena geworden. Das zeigen die zunehmende Konkurrenz um Weltraumressourcen und die allmähliche Militarisierung des Alls. Dabei wird deutlich, dass die bestehenden internationalen Abkommen nicht ausreichen, um klare Regeln für die Nutzung und den Schutz extraterrestrischer Ressourcen zu schaffen und durchzusetzen. Einerseits gibt es mit den Artemis Accords oder der Zero Debris Charter Versuche, Unternehmen und Staaten in eine gemeinsame Regulierung einzubinden, andererseits verdeutlichen sie auch, wie fragmentiert die aktuelle Weltraumordnung ist. Die ursprüngliche Vision des Weltraums als „Gemeingut der Menschheit“ hat praktisch keine Bedeutung mehr .
Elon Musk und Donald Trump stehen sinnbildlich für diese neue Ära der Weltraumpolitik: eine Ära, in der visionäre Rhetorik und pragmatische Machtpolitik Hand in Hand gehen. Während Musk den Mars als Backup-Plan für die Menschheit propagiert, will Trump die wirtschaftlichen und geopolitischen Chancen der Weltraumexpansion nutzen. Da neue, durchsetzbare internationale Regeln fehlen, werden beide den Weltraum in ein weiteres Gebiet verwandeln, in dem sich dieselben Ungleichheiten und Konflikte entfalten, wie wir sie von der Erde nur allzu gut kennen.
[1] Die Moon Village Association (MVA) versteht sich als neutraler Vermittler, der die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stakeholdern auf globaler Ebene fördert, um Standards und Prinzipien für die zukünftige Erforschung und Nutzung des Mondes zu entwickeln.