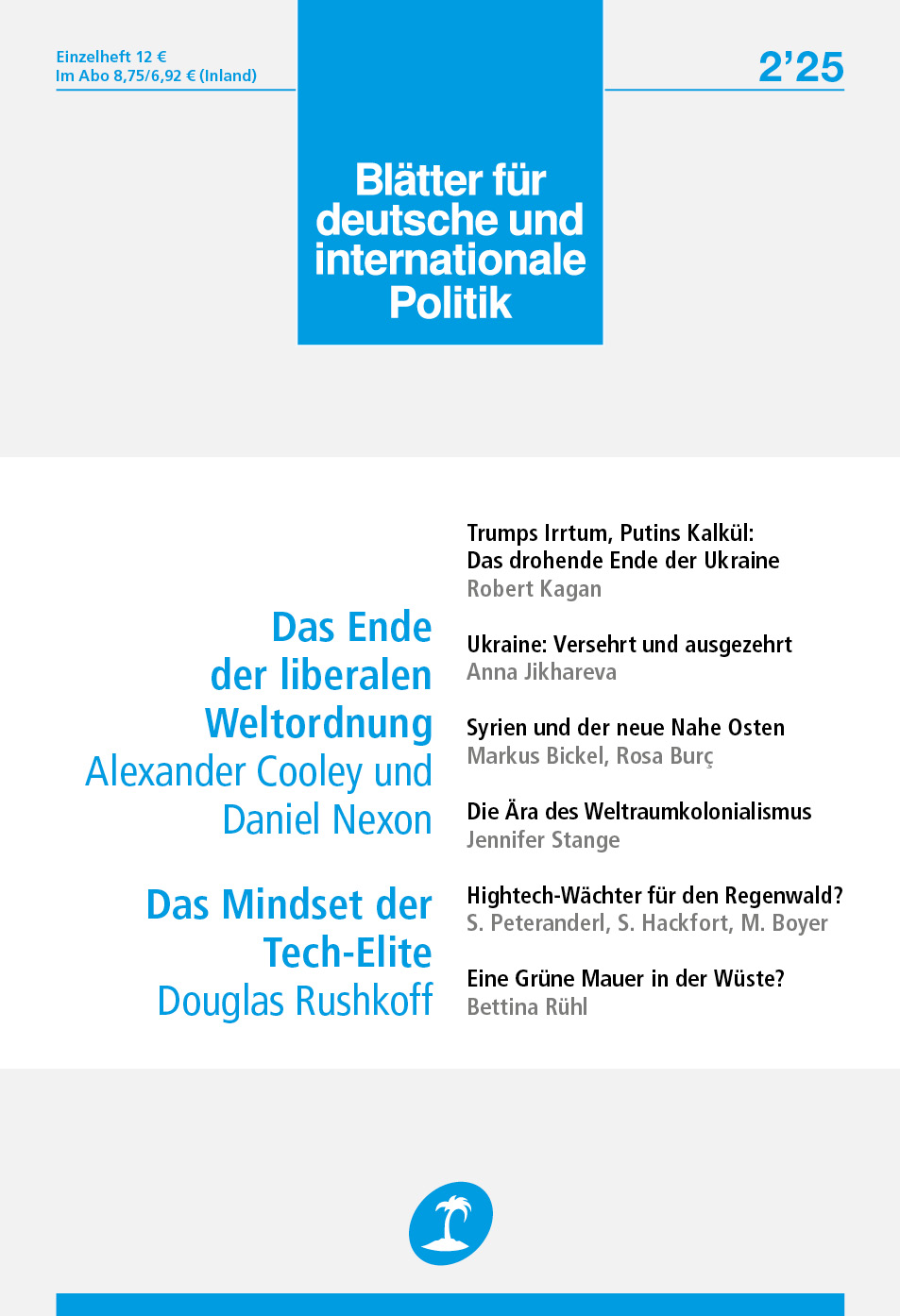Bild: Ein Herbert-Kickl-Wahlkampf-Button (IMAGO / Rudolf Gigler)
Er habe ein „ganz einfaches Ziel“, sagt Herbert Kickl: „Österreich ehrlich regieren.“ Wer dazu nicht bereit sei, könne für die FPÖ kein Verhandlungspartner sein: „Wir brauchen einen, dem man glauben und vertrauen kann“, so Kickl auf einer Pressekonferenz am 7. Januar dieses Jahres, nachdem ihm Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Vortag den Regierungsbildungsauftrag erteilt hatte. Allen Ernstes fordert ausgerechnet der Chef jener Partei, die ihre letzte Regierungsbeteiligung mit der Ibiza-Affäre versenkt hat, es dürfe „keine Spielchen, keine Tricks, keine Sabotage“ geben. Gönnerhaft sagt der FPÖ-Parteiobmann, dessen Immunität der Nationalrat in einer seiner ersten Sitzungen wegen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgehoben hat, man solle niemandem absprechen dazuzulernen, und er sei darum bereit, Vertrauen in seinen potentiellen Koalitionspartner zu investieren.
Verkehrte Welt: Die bis ins Mark verlogene und korrupte FPÖ belehrt die ÖVP über Ehrlich- und Glaubwürdigkeit. Kickl lässt es sich nicht nehmen, seinen Verhandlungspartner zu erniedrigen und zugleich mit Neuwahlen zu drohen. Denn er weiß genau, dass sich die ÖVP in eine Lage manövriert hat, in der sie viele Kröten schlucken muss – und nutzt das, um alte Rechnungen zu begleichen.[1] So fordert er, dass die ÖVP anerkennen müsse, „wer die Wahl gewonnen hat“ und wer demgegenüber „für die Misere im Land verantwortlich“ ist – und macht ihr indirekt ihren Wortbruch (nicht mit der „Kickl-FPÖ“ zu koalieren) zum Vorwurf, indem er ihre Vertrauenswürdigkeit in Zweifel zieht.
In der Tat haben sich die Bürgerlichen mit ihrem Schwenk hin zu den Rechtsextremen so bis auf die Knochen blamiert, dass sie sich von ihnen nun am Nasenring durch die Manege ziehen lassen müssen. Auch der neue ÖVP-Obmann Christian Stocker hatte Kickl bis zuletzt als „Gefahr für die Demokratie“ bezeichnet und schmetterte ihm noch am 11. Dezember im Nationalrat entgegen, „dass Sie in dieser Republik niemand braucht“ – nun braucht er den FPÖ-Chef so dringend, dass er dessen Gesprächsangebot postwendend annimmt. Zwar nennt er dabei Bedingungen – es dürfe keine Abhängigkeit von Russland geben, EU-Mitgliedschaft und Rechtsstaat seien beizubehalten – und versucht seinen Preis hochzutreiben, indem auch er Neuwahlen nicht ausschließt. Doch angesichts von Umfragen, die der ÖVP in so einem Szenario herbe Verluste und der FPÖ gewaltige Zuwächse voraussagen, erscheint das denkbar unglaubwürdig.
Obwohl Österreich schon seit mindestens 25 Jahren, nämlich seit der ersten ÖVP-FPÖ-Koalition unter Kanzler Wolfgang Schüssel und FPÖ-Chef Jörg Haider, Testlabor für die Normalisierung von Rechtsextremismus ist, steht das Land damit heute abermals an einer beispiellosen historischen Schwelle: Erstmals seit dem Sieg über den Nationalsozialismus könnte die Regierung eines Landes, das NS-Terror und Shoah mitverantwortet, von einer indirekten Nachfolgepartei der NSDAP angeführt werden. Was aber sagt es aus über den Umgang mit der Vergangenheit und das Wahrnehmen seiner historischen Verantwortung, wenn das Land bald einen Regierungschef haben sollte, der sich „Volkskanzler“ nennt und dessen Reden wie schlecht parodierter Volksempfänger klingen? Wie konnte es so weit kommen?
Demokratiezersetzende Schreibtischtäter
Manche Kommentatoren sprechen davon, der Austritt der liberalen Neos aus den Koalitionsgesprächen mit ÖVP und SPÖ habe eine tragische Kettenreaktion mit unvorhersehbarem Ausgang in Gang gesetzt. Tatsächlich jedoch handelt es sich um das Produkt konsequenter Prinzipienlosigkeit und eklatanter Gier. Mit der „Banalität des Autoritarismus“ und den „halbloyalen Demokraten“ haben die Harvard-Politologen Steven Levitsky und Daniel Ziblatt dafür treffende Begriffe geprägt.[2] Denn so diszipliniert die FPÖ geworden sein mag, seit sie vom asketischen Ex-Triathleten Kickl und nicht mehr von labilen Lustmenschen wie Haider oder Heinz-Christian Strache geführt wird – es ist nicht brillante Dämonie oder gewieftes Taktieren, das ihn nun zum Kanzler machen dürfte. Wie in so vielen anderen Ländern wäre enthemmter Rechtsextremismus auch in Österreich nie und nimmer in der Lage, durch absolute Mehrheiten oder gar Gewalt die Macht zu ergreifen. Dieser Impotenz wegen ist er auf die Komplizenschaft aus dem demokratischen Spektrum angewiesen – auf die Zuarbeit jener demokratiezersetzenden Schreibtischtäter, die sich in ganz banaler Beschränktheit weigern, über den Tellerrand kleinlicher Partei- und Klientelinteressen hinauszublicken.
Die Erosion scheinbar stabiler Demokratien, wie sie geradezu lehrbuchhaft in Österreich zu beobachten ist, ist darum eher eine Kapitulation im demokratischen Spektrum als ein Sieg der Rechtsextremen – und zwar vor allem im bürgerlichen Lager. Denn offenbar war es Liberalen und Konservativen in Österreich wichtiger, noch die bescheidensten Mehrbelastungen für Großkonzerne und Vermögende abzublocken, als eine von Rechtsextremen geführte Regierung zu verhindern. Sie haben den Ernst der Lage entweder nicht verstanden oder fanden die Verteidigung der liberalen Demokratie weniger dringlich. So richtig also die Feststellung ist, dass alle drei Beteiligten einen Anteil am Scheitern der Koalitionsverhandlungen haben, so falsch wäre es, daraus zu schließen, die Verantwortung wäre genau gleich aufgeteilt. Dagegen sprechen die Fakten.
Der erste Fakt: Die Neos stiegen am 3. Januar völlig überraschend aus den Verhandlungen aus. Offenbar hatten sie bereits eine Weile mit dem Schritt geliebäugelt, sich darauf kommunikativ vorbereitet, und versuchten nun, mit dem Ergreifen der Initiative das Narrativ zu platzieren, ÖVP und SPÖ wollten weitermachen wie bisher, statt echte Reformen anzugehen. Zwar distanzierte sich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger bei ihrer Rede am Morgen von einem Liberalismus, der das Schwingen von Kettensägen und einen budgetären Kahlschlag als nachahmenswerte Vorbilder ansieht, und betonte, auch „sozialer Ausgleich“ sei ihr ein Anliegen. Doch als sie am Abend im Fernsehinterview der Nachrichtensendung ZIB-2 gefragt wird, woran es konkret gehapert habe, kam sie nach der Erwähnung fehlender Leuchtturmprojekte letztlich darauf, dass nicht ausreichend Pensionskürzungen möglich gewesen wären. Dass ihr solche Reförmchen offenbar wichtiger sind als die Verteidigung der Demokratie, gab Meinl-Reisinger geradezu ausdrücklich zu Protokoll, sagte sie doch, „dass als Regierungszweck alleine die FPÖ zu verhindern definitiv zu wenig ist“.
Der zweite Fakt: Die Verhandlungen zwischen den beiden verbliebenen Parteien, die zunächst noch weiter über eine Koalition mit hauchdünner Mehrheit verhandelten, wurden von der ÖVP beendet. Am Schluss wurde etwa über den SPÖ-Vorschlag gesprochen, die von Schwarz-Blau gesenkte Körperschaftssteuer für große Konzerne wieder von 23 auf 25 Prozent zu erhöhen und die Bankenabgabe anzuheben, die aktuell bei 0,024 bis 0,029 Prozent der Bilanzsumme liegt. Doch der offenkundig von Wirtschafts- und Industrielleninteressen kontrollierten ÖVP war es lieber, das Amt des Bundeskanzlers aufzugeben, den bisherigen Amtsinhaber und Parteivorsitzenden Karl Nehammer abzusägen und sich in den Schwitzkasten der FPÖ zu begeben. Das bestätigen Äußerungen von Georg Knill, dem Vorsitzenden der Industriellenvereinigung, der am 7. Januar im Ö1-„Morgenjournal“ sagte: „Für uns ist es nie um die Farbenlehre gegangen, sondern immer um den Standort“ – so als ob Rot, Pink oder eine rechtsextreme Partei nur optische Nuancen unterscheiden und zum „Standort“ nicht auch eine stabile Demokratie gehört. Eine FPÖ-ÖVP-Koalition sei Ausdruck des Wählerwillens, und da es mit der SPÖ nicht möglich gewesen sei, das Budget „ausschließlich ausgabenseitig“ zu sanieren, habe sich gezeigt, dass „mit den Roten leider kein Staat zu machen ist“ – eine Formulierung, die von der ÖVP zuvor oft für Kickl gebraucht wurde. Trotz ausdrücklicher Nachfrage ließ Knill die Behauptung undementiert, der ÖVP-Wirtschaftsflügel habe Nehammer unter Druck gesetzt.
Zu solchen bornierten Eigeninteressen gesellte sich zu allem Überfluss offenbar eine inkompetente Verhandlungschoreografie, die in Detaildiskussionen in zahllosen Untergruppen versiegte, statt vorab die wichtigsten Fragen zur Budgetsanierung zu klären. Und gewiss haben auch die unter Andreas Babler linker profilierten Sozialdemokraten hartnäckiger als früher darauf bestanden, dass auch „breite Schultern“ mehr tragen müssten. Doch es scheint glaubwürdig, dass sie sich durchaus flexibel zeigten, in welcher Form das geschieht, und sich nicht auf die Einführung von Vermögens- oder Erbschaftssteuern festlegten. Dass Babler trotzdem von Stocker vorgeworfen wird, die Verhandlungen mit „Klassenkampf“ sabotiert zu haben, kann wohl nur jemand sagen, der nicht erkennen kann oder will, dass er selbst Klassenkampf von oben betreibt und bereit ist, die liberale Demokratie für klientelistische Steuerschonungsinteressen zu verscherbeln. So zeigt sich auch am Beispiel Österreichs, wie wenig Liberale und Konservative heute noch bereit sind, einen Preis für politische Freiheit und sozialen Frieden zu zahlen. Nicht nur im Silicon Valley und in Mar-a-Lago werden ökonomischer Erfolg und Demokratie zunehmend als Gegensätze und nicht als einander ermöglichende Momente gesehen.
Österreichs Orbánisierung
Wie aber geht es nun weiter? Die Verhandlungen von FPÖ und ÖVP könnten noch scheitern. Manche Politiker wie der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig werben noch immer dafür, die Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos noch einmal aufzunehmen. Doch dass Kickl und Stocker nach nur drei Tagen Einigungen bei zentralen Budgetfragen präsentierten, macht darauf wenig Hoffnung – zumal die ÖVP seit der Nationalratswahl in zwei weiteren Bundesländern Landesregierungen mit der FPÖ gebildet hat, in der Steiermark erstmals seit Jörg Haider unter Führung eines blauen Landeshauptmanns, sodass beide Parteien jetzt fünf von neun Bundesländern gemeinsam regieren.
Allem Anschein nach wird der Bundeshaushalt nun auf dem Rücken der Bürgerinnen und Bürgern saniert. Vorgesehen sind offenbar Einschnitte bei Pensionen für nachkommende Jahrgänge, die Aussetzung der Inflationsanpassung bei Sozialleistungen sowie die Streichung von Förderungen für Klimaschutz oder Vergünstigungen für E-Autos. Dass dabei der Klimabonus gestrichen werden soll, ohne zugleich auf die CO2-Bepreisung zu verzichten, deren Einnahmen per Direktzahlung an die Bürgerinnen und Bürger rückverteilt wurden, kommt einer massiven Erhöhung der Abgaben gleich, die das Versprechen von ÖVP und FPÖ, keine neuen Steuern einzuführen, verlogen erscheinen lässt.
Den beiden Parteien, die sich seit Jahren systematisch aufeinander zubewegt haben – die „soziale Heimatpartei“ mit Blick auf marktradikale Wirtschaftspolitik, die Volkspartei bei reaktionärer Asyl- und Gesellschaftspolitik – dürften bald weitere Einigungen gelingen, sodass in der Innen- und Wirtschaftspolitik mit raschen Verhandlungen gerechnet wird. Schwierig könnte sich dagegen eine Einigung auf dem Feld der Außen-, Verteidigungs- und Europapolitik mit der putintreuen und europafeindlichen FPÖ gestalten, die in der EU die Verlässlichkeit Österreichs infrage stellen und das Land abermals vom Informationsaustausch befreundeter Geheimdienste abtrennen könnte, durch den noch im Sommer ein Attentat auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien verhindert wurde.
Lösen ließe sich das womöglich wie bei den früheren FPÖ-Regierungsbeteiligungen 2000 und 2017 durch eine Präambel, eingefügt auf Verlangen des Bundespräsidenten. Van der Bellen dürfte wohl auch bei der einen oder anderen Personalie mitreden. Womöglich möchte er durchsetzen, dass das Justizministerium von einem parteilosen „Experten“ geführt wird, verantwortet es doch Korruptionsermittlungen gegen beide Parteien. Ansonsten dürfte ihm jedoch nichts anderes übrigbleiben, als die Regierung im Falle einer Einigung ins Amt einzuführen. Speziell für ihn, der im Oktober 2022 mit dem Versprechen wiedergewählt wurde, Kickl nicht als Kanzler anzugeloben und den Regierungsbildungsauftrag zunächst der ÖVP erteilte, wäre dies eine herbe Niederlage.
Sollte es letztlich zu einer FPÖ-geführten Regierung kommen, steht Österreich eine Orbánisierung ins Haus, die zu systematischen und beharrlichen Angriffen auf die Institutionen der liberalen Demokratie wie Medien, Justiz, Kultur und Wissenschaft führen dürfte. Einen ersten Vorgeschmack darauf, was die nächsten Jahre blühen könnte, lieferte der Chef der FPÖ-Wien, Dominik Nepp, als er den „Standard“ am 14. Januar auf X als „Scheißblatt“ bezeichnete und der traditionsreichen Tageszeitung unverhohlen mit dem Entzug der staatlichen Presseförderung drohte. Sie hatte zuvor über Aufnahmen von Journalisten von „France Télévisions“ berichtet, die zeigen, wie FPÖ-Nationalratsabgeordnete bei einem „politischen Stammtisch“ im Hinterzimmer eines Gasthauses über die „machtgeile“ ÖVP vom Leder ziehen, von einem EU-Austritt schwärmen, über Flüchtlinge hetzen oder den Verfassungsgerichtshof als politisiert verunglimpfen.[3] Wie wenig die am Boden liegenden Konservativen dem entgegenzusetzen haben, hatte Stocker schon zuvor mit der Aussage gezeigt, er trage für die FPÖ, ihr Personal und deren Äußerungen „keine Verantwortung“. So wird praktizierte Verantwortungslosigkeit zur neuen Signatur der Bürgerlich-Konservativen, und zwar weit über Österreich hinaus.
[1] Nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Mai 2019 wurde Kickl auf Vorschlag des damaligen ÖVP-Bundeskanzlers Sebastian Kurz von Bundespräsident Van der Bellen als Innenminister entlassen.
[2] Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, Die Banalität des Autoritarismus. Wie halbloyale Demokraten die Demokratie zerstören, in: „Blätter“, 7/2024, S. 65-74.
[3] Colette M. Schmidt, FPÖ-Politiker in heimlicher Aufnahme: Abgeordnete nennen ÖVP „jämmerlich“ und Flüchtlinge „Gesindel“, derstandard.at, 14.1.2025.