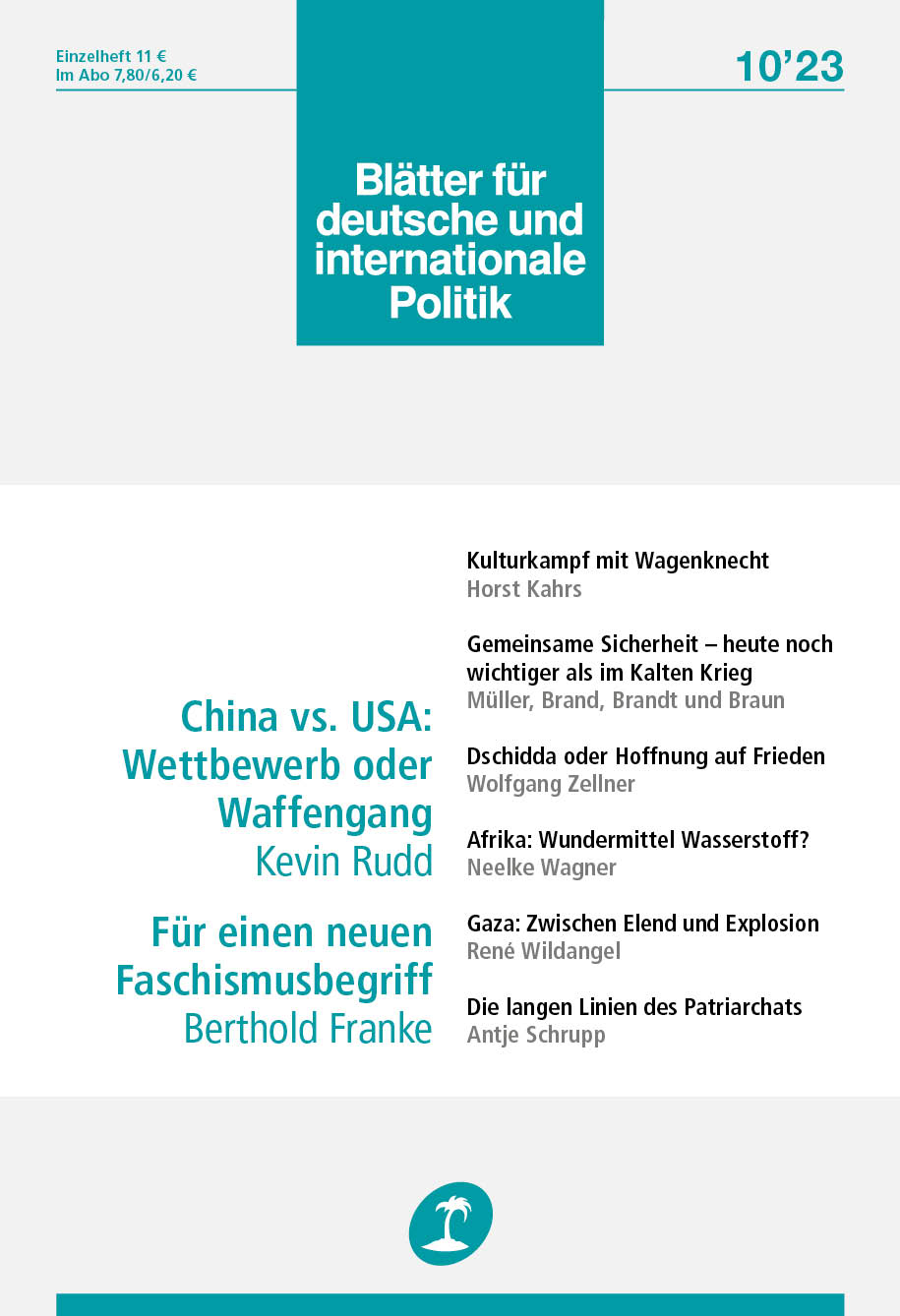Bild: Leonid Brreschnew mit Willy Brandt und Heinz-Oskar Vetter. Der Besuch des sowjetischen Staats- und Parteichefs Leonid Breschnew in Bonn im Mai 1973 war ein Schritt zur Entspannung des Ost-Westverhältnisses, 22.5.1973 (IMAGO / Klaus Rose)
Wer angesichts des Ukrainekriegs an das „Konzept der gemeinsamen Sicherheit“ anknüpfen will, habe die „grundlegenden Ursachen des Krieges nicht verstanden“, behauptet Reinhard Wolf in der Juli-Ausgabe der „Blätter“.[1] „Vorschläge für Waffenstillstände oder halbgare Kompromisse“ würden die „Auseinandersetzung allenfalls unterbrechen“. Wer zur Beendigung des Krieges nach Verständigung sucht, wird in dieser Denkweise als nervenschwach oder naiv angesehen. Stattdessen müsse die Ukraine „konsequent unterstützt (werden), solange ihre Gesellschaft sich wehren möchte“.
Der Autor meint mit seiner Kritik ausdrücklich auch den von uns initiierten Aufruf, den vor allem prominente Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter unterzeichnet haben.[2] Dieser fordert so schnell wie möglich einen Stopp der Kriegshandlungen, um den Weg zu Verhandlungen zu ebnen. Frieden könne in einer Welt, die für das Überleben der Menschheit auf Gegenseitigkeit angewiesen sei, nur auf der Grundlage des Völkerrechts und einer gemeinsamen Sicherheit geschaffen werden. Und das müsse Russland, das größte und ressourcenreichste Land der Erde, einschließen.
Das Kernmotiv unserer Initiative besteht darin, die verhängnisvolle Eskalationsdynamik des Krieges zu brechen.