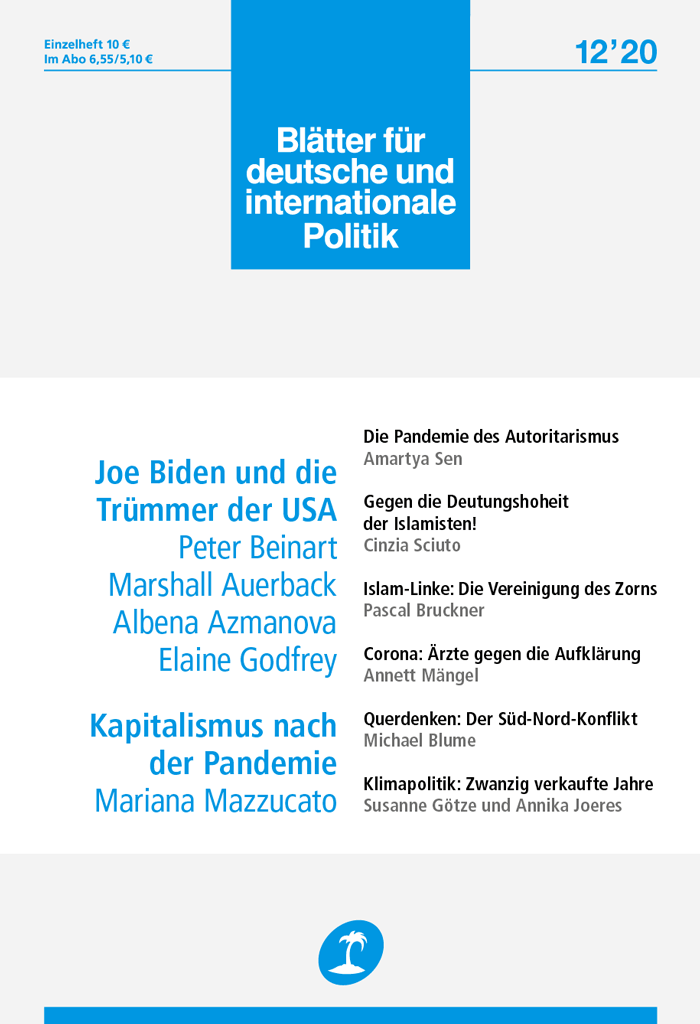Bild: imago images / Hans Lucas
In Polen kündigt sich dieser Tage ein fundamentaler Kulturwandel an. Die gesellschaftliche Polarisierung erreicht mit dem „Frauenstreik“ gegen die Reform des Abtreibungsrechts einen neuen Höhepunkt. Seit langem ist die polnische Gesellschaft tief gespalten in proeuropäisch liberal-progressive und konservativ-nationale Kräfte. Medienpropaganda und Hetzkampagnen der Regierung schüren diese Polarisierung jeden Tag. Und die Bevölkerung ist zunehmend frustriert über die brüderliche Feindschaft im eigenen Land. Dies zeigt sich auch im denkbar knappen Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Juli dieses Jahres, die der bisherige Amtsinhaber Andrzej Duda – unterstützt durch die regierende PiS-Partei (Prawo i Sprawiedliwość) – mit 51,03 Prozent der Stimmen nur knapp gewann. Von der Schwäche der Regierungskoalition zeugen ferner zahlreiche Skandale, innerparteiliche Kämpfe, der Umbau des Kabinetts und nicht zuletzt das Missmanagement der Corona-Pandemie.
Statt in dieser Krisensituation die Füße still zu halten, ging die PiS-Führung unter Jarosław Kaczyński in die Offensive und ließ das Familienplanungsgesetz von 1993 auf seine Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Dieses Gesetz ermöglichte Frauen in drei Fällen einen Schwangerschaftsabbruch: bei einer schweren Schädigung des Fötus, nach einer Vergewaltigung und wenn das Leben der Mutter gefährdet ist. Bereits vor einem Jahr hatten 119 ultrakonservative Abgeordnete seine Überprüfung gefordert. Bislang war die Regierung diesem Antrag jedoch aus Sorge vor Protesten nicht nachgekommen. Im Oktober verwies sie die entsprechende Entscheidung dann an das Verfassungsgericht, das seit der umstrittenen Justizreform mit regierungsnahen Richtern besetzt ist.
Die Entscheidung des Verfassungsgerichts vom 22. Oktober 2020 schränkt das ohnehin restriktive Abtreibungsrecht stark ein. Sie erklärt den Schwangerschaftsabbruch im Falle einer schweren Schädigung des Fötus mit einem Verweis auf den Grundsatz der Menschenwürde für verfassungswidrig. Im Jahr 2019 wurden jedoch 98 Prozent der legalen Abtreibungen in Polen aus diesem Grund durchgeführt. Im Kern kommt die Entscheidung des Verfassungsgerichts also einem nahezu kompletten Abtreibungsverbot gleich.
Die Wut der Frauen
Die öffentliche Empörung ist seither groß. 800 000 Menschen demonstrierten auf dem Höhepunkt der Proteste, vor allem junge Frauen. Dabei zielt ihre Wut sowohl auf das Abtreibungsverbot als auch die Politik der Regierung. Zwar gab es bereits einige Versuche der PiS, ein Totalverbot der Abtreibung durchzusetzen – etwa durch Bürgerbegehren fundamentalistisch-christlicher Organisationen. Diese scheiterten jedoch unter anderem am sogenannten Schwarzen Protest 2016. Die öffentliche Meinung ist eindeutig: Drei Viertel der polnischen Öffentlichkeit lehnen eine schärfere Regulierung sexueller und reproduktiver Rechte ab, fast 80 Prozent auch das Urteil des Verfassungsgerichts. Selbst das politische Lager der PiS-Partei ist hinsichtlich des faktischen Abtreibungsverbots gespalten. Zudem steht der Zeitpunkt der Entscheidung in der Kritik, denn sie fiel während der zweiten Coronawelle als das Gesundheitssystem beinahe kollabierte. Schließlich kritisieren die Protestierenden den Prozess der Entscheidungsfindung: Statt die politische Verantwortung in einem parlamentarischen Verfahren zu übernehmen, wählte die Regierung für die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes den „einfacheren“ Weg über das Verfassungsgericht.
Doch warum setzte Kaczyński das Abtreibungsverbot ausgerechnet jetzt auf die Agenda? Zum einen stand die Regierungskoalition im September kurz vor dem Bruch. Kaczyński selbst übernahm die Aufgabe des stellvertretenden Ministerpräsidenten, um Konflikte zwischen verfeindeten Ministern zu schlichten. Die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes sollte ihm helfen, die eigenen Reihen zu schließen und den harten Kern seiner Anhängerschaft zu mobilisieren. Zum anderen erwartete er offensichtlich, dass die Proteste dieses Mal wegen der Pandemie ausbleiben würden. Doch seine Kalkulation ging nicht auf. Die Wut und der Frust der letzten Jahre brachen aus den Menschen heraus und führten zu den größten Demonstrationen in Polen seit 1989. Ein Großteil der Bevölkerung unterstützt die Massenproteste, nur 43 Prozent lehnen sie ab.[1] Kaczyński jedoch unterschätzt die Situation noch immer. Am 27. Oktober rief er seine Anhänger dazu auf, die katholische Kirche, die polnische Identität und Tradition „um jeden Preis“ zu verteidigen.[2] Seine Rede kam einer Anstiftung zum Bürgerkrieg nahe und zeigte einen realitätsfernen Politiker. Selbst in den eigenen Reihen wachsen seither die Zweifel, ob Kaczyński noch immer ein genialer Großstratege ist. Die Zauberformel der PiS – Patriotismus und Loyalität zur Kirche mit Feindbildern gegenüber der LGBTiQ-Community, Genderfragen und des verdorbenen Westeuropas zu verflechten – scheint immer weniger zu greifen. Kaczyńskis Konstrukt wackelt, innerhalb weniger Tage verlor die PiS ein Viertel ihrer
Zustimmungswerte.[3]
Polnischer Kulturwandel
„Am Ende stürzen die Frauen den Diktator“, war auf einem Plakat zu lesen. Das könnte tatsächlich der Fall sein. Die Wucht, mit der die jüngere Generation unter der Führung erfahrener Aktivistinnen auf die Straßen drängt, ist nicht nur Ausdruck des Entsetzens über das Urteil des Verfassungsgerichtes. Hier brechen sich die Aggressionen der vergangenen fünf Jahre Bahn. „Wir haben es satt, dass uns die Regierenden, die Kirche oder sonstige Funktionäre in die Betten schauen und zwischen die Beine greifen“, ist zu hören. Den Protestierenden geht es um Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeit, Geschlechtergerechtigkeit und Gewissensfreiheit. Es geht aber auch um die Überwindung patriarchaler Strukturen und paternalistischer Kontrolle durch Institutionen politischer oder religiöser Provenienz. Die heutige Generation möchte das Spiel nicht mitspielen. Sie lehnt das Jahrzehnte währende Bündnis von Politik und katholischer Kirche ab, das die Regierenden jedweder politischen Richtung seit den 1990er Jahren gepflegt haben. Die Kirche hatte das Monopol im Bereich der Werte und begrenzte diesen stark auf die Sexualethik. Die Moralvorstellungen der katholischen Kirche zu den Themen Abtreibung, Verhütungsmitteln, Sexualkunde und ihre Feindschaft gegenüber der LGBTiQ-Community wurden absolut gesetzt. Abweichende Haltungen galten als nihilistisch.
Seit dem EU-Beitritt Polens im Jahr 2004 verschärften sich die gesellschaftlichen Gräben. Zu viele Probleme wurden unter Verweis auf die katholische Prägung Polens einfach hingenommen: die mangelnde Thematisierung von Geschlechterdemokratie, Sexualerziehung oder häuslicher Gewalt, die Einschränkung von Frauenrechten und die fehlende Sichtbarkeit von Frauen in öffentlichen Debatten.[4] Der polnische Staat drückte indes beide Augen zu und hoffte, dass die Kirche der Gesellschaft als eine Art Puffer in den schweren Zeiten der Transformation beistehe. Doch die Kirche missbrauchte ihre Position, die Tonlage verschärfte sich. Polen – ein katholisches Land. Dieses Mantra fungierte als Entschuldigung für viele Entwicklungen, die einer modernen Gesellschaft unwürdig sind. Das dominante Narrativ war: Polen ist das Bollwerk des Christentums im laizistischen Europa; hier setzt man auf traditionelle Familienvorstellungen, die radikal christlichen Werten entsprechen. Die Gesellschaft sollte dieses Narrativ hinnehmen – als Kulturcode aller Polen.
Ein neuer kultureller Code
Die gegenwärtigen Proteste verändern den kulturellen Code Polens fundamental. Zwar hat die katholische Kirche in Polen nach wie vor einen hohen Stellenwert, unantastbar ist sie aber nicht mehr. Dies liegt nicht zuletzt an den vielen Pädophilieskandalen. Der Kulturwandel, den die Protestierenden laut und zuweilen vulgär mit „Verpisst Euch“-Slogans einfordern, erwächst aus der grundlegenden Ablehnung des Bündnisses zwischen Kirche und Staat. Diese Säkularisierung bedeutet eine tiefgehende Veränderung. Jahrhundertelang definierte sich die polnische Gesellschaft über ihren Katholizismus, noch immer gelten 90 Prozent der polnischen Bevölkerung als katholisch. In keinem der vorherigen Proteste wurden Kirchen beschmiert und Gottesdienste gestört. Einige Beobachter vergleichen die „Frauenrevolution“ in Polen mit dem Wertewandel in Westeuropa. Und in der Tat: Mit schonungsloser Offenheit wird die Diskriminierung von Frauen angeprangert, die Doppelmoral aus Abtreibungsverbot und illegaler Praxis kritisiert, werden echte Gleichberechtigung und Wahlfreiheit eingefordert. Die junge proeuropäische Generation Polens zeigt dem etablierten Kulturcode auf unmissverständliche Art und Weise den erhobenen Mittelfinger. Polens junge Protestgeneration will einen laizistischen Staat. Und sie ist breit vernetzt: Sie bringt Frauenrechts- und Jugendklima-Bewegungen zusammen und bekommt vereinzelt sogar Unterstützung von Landwirten, Rockern und Fußball-Clubs.
Dabei transportiert der „Frauenstreik“ (#StrajkKobiet) nicht nur Wut oder stellt Forderungen zu reproduktiven Rechten. Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit war von Beginn an Teil seiner Agenda. Bisher stand die Mehrheit der polnischen Wählerinnen den Justizreformen relativ indifferent gegenüber. Die Entscheidung zum Abtreibungsgesetz offenbarte nun schlagartig die massiven Auswirkungen dieser Reform für alle Polen und Polinnen.
Doch die Zukunft der Protestbewegung ist offen. Angesichts des drohenden Lockdowns und staatsanwaltlicher Ermittlungen gegen einige Organisatorinnen bleibt abzuwarten, ob die Proteste in der jetzigen Form andauern. Wahrscheinlicher sind längerfristig angelegte, flexible Blockadeaktionen, wie sie zurzeit jeden Montag in Warschau stattfinden. Das Komitee des Allpolnischen Frauenstreiks fordert eine Neubesetzung der Gerichte und den Rücktritt der derzeitigen Regierung. „Wir befinden uns im Krieg mit der Regierung“[5], betont auch Marta Lempart, eine der Hauptanführerinnen der Proteste. Für viele junge Menschen auf der Straße stellt sich allerdings die Frage, ob die Kraft für einen Systemwechsel reicht. Bereits jetzt wird die Kritik laut, in dem Komitee fehlten gerade die jungen Stimmen, die das Herz der Protestbewegung ausmachen. Ein Abflauen der Proteste wird die Kulturrevolution jedoch nicht aufhalten.
Ein Spiel auf Zeit
Derweil spielt die Regierung – erschrocken ob der Kraft der Proteste – auf Zeit und hat die Entscheidung des Verfassungsgerichtes noch nicht im Gesetzesblatt veröffentlicht. Präsident Duda schlug bereits den Kompromiss vor, eine Abtreibung im Fall einer tödlichen und unheilbaren Missbildung eines Fötus doch zu erlauben. Dieser Schachzug manövriert die PiS allerdings gleich doppelt in die Falle: Er verdeutlicht die Begründetheit der Proteste. Zugleich schürt er die Wut der Pro-Life-Bewegung, die den Präsidenten nun als größten Verräter aller Zeiten brandmarkt und die unverzügliche Veröffentlichung des Urteils gerichtlich einklagen will.
Dabei richtet sich das politische Kalkül der PiS auch nach der Konföderationspartei (Konfederacja). Die (außer-)parlamentarische Stärke dieser ultrarechten und wirtschaftlich ultra-liberalen Oppositionspartei kann Kaczyński nicht mehr mit der üblichen Taktik „Teile und Herrsche“ kontrollieren. Die Konfederacja war bei einem Teil der Jugend schon immer gefährlich stark; durch ihren Präsidentschaftskandidaten Krzysztof Bosak gewann sie nun auch bei Unternehmern Unterstützung hinzu. Sie präsentiert sich als einzig wirklich „katholische“ Partei im Parlament. Über die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes wollte die PiS ihre diesbezügliche Vormachtstellung wieder ausbauen; mit der Nichtveröffentlichung des Urteils stehen ihre Glaubwürdigkeit und „christliche Loyalität“ nun wieder in Frage.
Kaczyński nähert sich zudem dem Ende seiner politischen Laufbahn. Seit dem letzten Wahlsieg versucht er sein Lebenswerk zügig zu zementieren und nimmt dafür auch gesellschaftliche Schäden in Kauf. Dabei scheinen ihm zwei Dinge wichtig: Erstens das Vermächtnis der konservativ-katholischen Wende als solches. Zweitens der Schutz seines politischen Erbes – des „souveränen Staates“ Polen, der wirtschaftlich stark und zivilisatorisch von der „westlichen Dekadenz“ verschont bleibt – vor dem Zugriff von Zbigniew Ziobro. Jener war als Justizminister und Generalstaatsanwalt in Personalunion der Vollstrecker aller gegen die Rechtsstaatlichkeit gerichteten Maßnahmen der Regierung. Zugleich wurde er jedoch vor Jahren wegen seiner Kritik am Kurs von Kaczyński aus der PiS verstoßen. Heute ist er der Vorsitzende der Splitterpartei Solidarisches Polen (Solidarna Polska), die sich in Koalition mit der PiS befindet. Doch wann immer die politische Karriere von Kaczyński tatsächlich enden wird, Ziobro wird aller Voraussicht nach versuchen, die Führung der PiS zu übernehmen. Bereits jetzt präsentiert er sich nicht nur in rechtlichen, sondern auch in gesellschaftspolitischen Fragen als der wahre Hardliner und Erbe.
Es bleibt abzuwarten, ob Kaczyńskis ideologische Verblendung tatsächlich so weit reicht, wegen der Rechtsstaatsklausel ein Veto gegen den EU-Haushalt einzulegen. Erneut könnte er unterschätzen, wie ausgeprägt proeuropäisch große Teile der Bevölkerung sind. Sein Veto käme in diesem Fall einem politischen Selbstmord gleich. Denn erneute, vielleicht noch heftigere Unruhen wären mit Sicherheit die Folge.
[1] Agnieszka Kublik, Kantar dla „Wyborczej“: wie¸kszość Polaków popiera protesty, https://wyborcza.pl, 29.10.2020.
[2] Anja Datan-Grajewsk, Kaczyński zu Polen: „Wir müssen die Kirche verteidigen. Um jeden Preis“, www.mdr.de, 28.10.2020.
[3] Polens Regierungspartei PiS verliert deutlich an Zustimmung, www.faz.net, 3.11.2020; Dominik Gołdyn, PiS traci poparcie w kolejnym sondaz˙u. Minimalna przewaga nad KO, https://wiadomosci.radiozet.pl, 1.11.2020.
[4] Agnieszka Graff, Swiat bez kobiet. Płeć w polskim z˙yciu publicznym, Wydawnictwo 2001.
[5] Interview mit Marta Lempart, „Wir sind im Krieg mit der Regierung“, www.zeit.de, 11.11.2020.