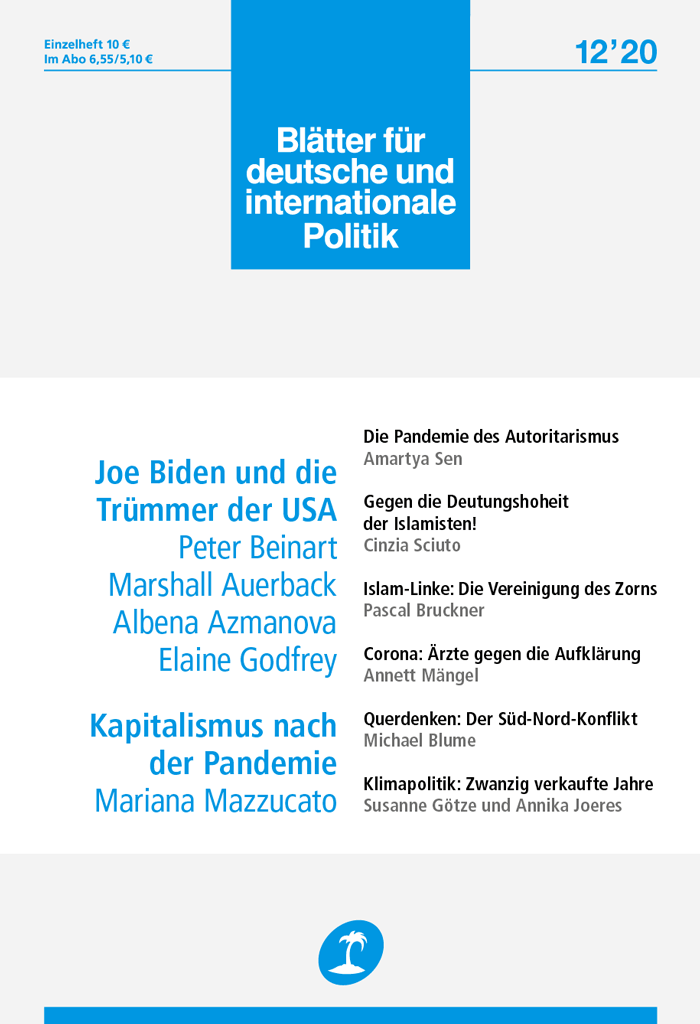Wie die deutsche Klimaschmutzlobby den Politikwechsel verhindert

Bild: hoffi99 / photocase.de
Vor gut fünf Jahren, am 12. Dezember 2015, wurde in Paris der Weltklimavertrag verabschiedet – ein historisches Ereignis. Das erste Mal in der Geschichte hatten sich 197 Staaten auf ein Dokument zur Eindämmung der globalen Erwärmung geeinigt. Durchaus in diesem Geiste beschloss Anfang Oktober das Europaparlament, bis 2030 60 Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen zu wollen, damit die EU das vereinbarte Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, überhaupt noch erreichen kann. Das verlangt enorme Kraftanstrengungen. Allerdings hinken die einzelnen Nationalstaaten bei der Umsetzung des Vereinbarten weit hinterher. Dieses Versagen in der Klimapolitik hat eine lange Tradition. Bis heute werden von den einflussreichen Lobbys im Zusammenspiel mit reaktionären Politikern entscheidende Fortschritte für den Klimaschutz verhindert. Das gilt nicht zuletzt für Deutschland, das bevölkerungsreichste Land der EU, dessen Einwohner pro Kopf mehr Treibhausgase produzieren als die meisten anderen Europäer.
Jüngster Tiefpunkt dieser Blockade waren die am 20. September 2019 von der Bundeskanzlerin und den Mitgliedern des Klimakabinetts verabschiedeten Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, die insbesondere den sogenannten Kohleausstieg „regeln“ sollten (und das in derart ungenügender Weise taten, dass die Ergebnisse unter dem Druck der Grünen wie der Ökoverbände, aber auch eines Teils der Bevölkerung, später nachgebessert werden mussten). Während die Große Koalition einen viel zu niedrigen CO2-Preis festlegte, wurde – so die Ironie der Geschichte – „im Ausgleich“ dafür die Pendlerpauschale für Autofahrer erhöht. Dabei standen damals die Zeichen der Zeit noch durchaus günstig für eine engagierte Klimapolitik: Greta Thunberg war gerade mit ihrem Segelboot in New York zum UN-Klimagipfel gefahren, der Klimawandel rangierte ganz oben auf den Titelseiten der Tagespresse, alles sah für einen kurzen Moment so aus, als würde sich endlich etwas bewegen – doch am 20. September 2019 wurden alle Hoffnungen auf eine weitergehende deutsche Klimapolitik vorerst beerdigt. Dabei war es, wie wir heute wissen, die vorerst letzte Chance auf einen großen Wurf. Denn bald danach kam die Coronakrise und damit verschwand das Klima-Thema bis auf weiteres von der Spitze der politischen Agenda.
Im selben Monat September, doch von der Öffentlichkeit nicht weiter bemerkt, veranstaltete das Bundeswirtschaftsministerium seine größte Feier des Jahres 2019: Urban Rid, der jahrzehntelang Abteilungsleiter war, wurde in den Ruhestand verabschiedet. 200 Personen versammelten sich aus diesem Anlass bei Häppchen und Getränken im Vestibül, dem mondänen Festraum im ersten Stock des Wirtschaftsministeriums. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hielt eine lange Lobesrede auf Rid und überreichte schließlich ein Bild: darauf ein gezeichnetes Schiff mit Rid im Matrosenanzug. „Der Lotse geht von Bord“, sagten die Festredner. Auf dem Bug gemalt die Reihe an Ministern als Kapitäne, deren wichtigster Gefolgsmann Rid war: Umweltminister Norbert Röttgen, Umwelt- und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU), die Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Brigitte Zypries (beide SPD).
Tatsächlich ist Urban Rid eine Schlüsselfigur für die deutsche Klimapolitik: Unter Kanzler Helmut Kohl arbeitete der Parteilose im Kanzleramt, dann als Abteilungsleiter im Umweltministerium und schließlich im Wirtschaftsministerium. Alle loben ihn als Mann, der zeit seines Lebens für die erneuerbaren Energien gekämpft hat. Auch der Berliner „Tagesspiegel“ beschrieb Urban Rid anlässlich seines Abschieds als „Energiewendemann“.[1]
Kollegen und Mitstreiter sehen ihn dagegen in einem anderen Licht: als einen Verhinderer und Bremser von Wind- und Sonnenenergie. Aber es ist nicht Rid persönlich, der den Klimaschutz torpediert hat. Der Neurentner Rid steht exemplarisch für die Arbeit der Merkel-Regierungen, sei es mit SPD oder FDP als Partner: Sie proklamieren die Energiewende, aber deckeln den Ausbau von klimafreundlichen Energien und verzögern den Kohleausstieg um Jahrzehnte; sie sprechen sich für eine Agrarwende aus, aber fördern konventionelle Großbetriebe; sie bewerben die Verkehrswende, aber subventionieren fossile Kraftstoffe wie Diesel und Kerosin.
Das ist kein Zufall. Die Regierungen haben immer betont, wie wichtig die Klimawende ist, und haben zugleich auf industrienahe Lobbys gehört. Diese hatten immer wieder Argumente, warum ehrgeizige Klimapolitik Jobs kostet, mehr Zeit braucht, zu kostspielig ist oder nur weltweit Sinn ergibt. Und die Ministerien, so berichten es uns verschiedene Mitarbeiter, verstehen sich stets als Anwalt ihrer Branche, als Anwalt der Autobauer im Verkehrsministerium, als Anwalt der Energiekonzerne im Wirtschaftsministerium, als Anwalt der Großbauern im Agrarministerium. „Wir helfen unserer Branche, wo wir nur können – so ist die Haltung. Und nicht: Wir helfen dem Klima, wo wir nur können“, beschreiben Mitarbeiter die Grundeinstellung.
„Wenn Sie wirksamen Klimaschutz machen wollen, machen Sie sich viele Gegner. Dann stehen da viele Vereinigungen und Organisationen auf der Matte, und Ihre Kabinettskollegen geben Ihnen den Rest. Wenn Sie Minister oder Kanzler sind, dann überlegen Sie sich genau, ob Sie sich mit weiteren ‚Baustellen‘ herumschlagen wollen und sich der Aufwand lohnt. Die meisten der verschiedenen betroffenen Ressorts haben sich immer dagegen entschieden.“ Das sagt der ehemalige Referatsleiter im Bundesumweltministerium, Wolfhart Dürrschmidt, der 20 Jahre lang Klimaschutzpolitik gemacht hat.[2] Ab Mitte der 2000er Jahre sei der Widerstand gegen den Klimaschutz gewachsen und die Regierung vor Lobbyinteressen zunehmend eingeknickt. Viele Politiker und ihre Zuarbeiter seien verantwortungslos und kurzsichtig. Und sie hätten den Klimaschutz in ihren Ministerien stets anderen, scheinbar drängenderen Themen geopfert – meist solchen, die mehr Wählerstimmen versprächen.
Die Ministerien als Bremser, der Bundestag als Umweltpionier
Die ersten besorgten Berichte über den Klimawandel kamen denn auch nicht von den Ministerien, sondern vom Deutschen Bundestag. Den Vorsitz in der ersten Enquetekommission zur „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ in den Jahren 1988 bis 1990 hatte der CDU-Politiker Bernd Schmidbauer, für die SPD war der spätere Staatssekretär im BMU, Michael Müller, der führende Kopf. Auch in den Reihen von SPD und CDU habe es damals noch richtig überzeugte Klimaschützer gegeben, erinnert sich Wolfhart Dürrschmidt, der damals im Umweltministerium im Referat „Klima und Energie“ arbeitete. Nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag hat die Klimaschutzpolitik aus der Taufe gehoben. Auch die Aktivitäten zu erneuerbaren Energien, etwa das Stromeinspeisungsgesetz 1990 und das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000, kamen aus dem Bundestag – gegen den Widerstand des innerhalb der Bundesregierung eigentlich dafür zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums. Das Resümee des allerersten Berichts über den Klimawandel in der Geschichte des bundesdeutschen Parlaments liest sich, als käme es aus einem aktuellen Polit-Papier: „Es zeichnet sich ab, dass die zu erwartenden Änderungen der Erdatmosphäre und des Klimas gravierende Folgen für die menschlichen Lebensbedingungen und für die Biosphäre insgesamt nach sich ziehen werden, die durch Vorsorgemaßnahmen nur noch teilweise verhindert werden können. Dramatische Entwicklungen können nicht ausgeschlossen werden.“[3] Die Tragweite des Klimawandels hatten Spitzenpolitiker und auch der Deutsche Bundestag also schon vor dem Fall der Mauer realisiert. Es folgen Empfehlungen, wie Deutschland seinen Treibhausgasausstoß verringern könnte: Zuallererst nennt die Kommission die Energieeffizienz, ein bis heute stark vernachlässigter Bereich. Schon hier heißt es: „Wirksame Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Schadstoffrückhaltung bei der Verbrennung fossiler Energieträger im Verkehrsbereich verdienen große Aufmerksamkeit.“[4] Energiesparen und Verkehr sollten dann in den folgenden 30 Jahren zu den Stiefkindern des Klimaschutzes werden. Die Empfehlungen der vorrangig von CDU- und SPD-Politikern gestellten Kommission fielen unter den Tisch.
1992 gründete sich dann die Enquetekommission „Schutz der Erdatmosphäre“ im vereinten Deutschland. Ihr erster Bericht trug schon den, wie vermutlich viele heutige Wirtschaftsvertreter und konservative Politiker sagen würden, „alarmistischen“ Titel „Klimaänderung gefährdet globale Entwicklung. Zukunft sichern – Jetzt handeln“. Der Bericht ist ein mahnender Appell von Politikern aller Couleur – unter Leitung eines CDU-Politikers –, endlich zu handeln. Sogar von einer CO2-Steuer und ordnungspolitischen Einzelmaßnahmen war schon die Rede. Und eine „mengenmäßige Begrenzung für CO2-Emissionen“ und „handelbare Zertifikate“, sprich einen Emissionshandel, solle es nur geben, wenn das nicht ausreiche.[5] Ein Emissionshandel wurde dann erst im Jahr 2005, ganze 13 Jahre später, auf europäischer Ebene eingeführt.
Der damalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer brachte zu jener Zeit bei mehreren Gelegenheiten die Einführung einer CO2-Steuer ins Spiel. Er sollte aber auch einer der wenigen CDU-Politiker bleiben. Bis ins Jahr 2019 hinein wehren sich Unionspolitiker gegen gesetzliche Umweltsteuern und Abgaben, und sie haben sie auch im Klimapaket 2019 verhindert. Manche Stimmen behaupten sogar, dass Töpfer vielen CDU-Mitgliedern viel zu progressiv gewesen sei und deshalb absichtlich durch die damals eher unbekannte Angela Merkel ersetzt worden sei.
1990 aber antwortete die schwarz-gelbe Bundesregierung auf eine Anfrage der SPD zur CO2-Steuer: „Nach Auffassung der Bundesregierung muss [...] entsprechend dem Verursacherprinzip die gesamte energetische Nutzung fossiler Energieträger einbezogen werden.“[6] Dazu zählte sie damals: Autofahrer, Kleingewerbetreibende, Mieter und Hausbesitzer, auch Kraftwerke und Industriefeuerungsanlagen.
Rio 1992 – die globale Zäsur
Die deutsche Delegation galt damals als besonders progressiv und wird noch heute für ihre Vorreiterrolle bei der berühmten „UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung“ in Rio de Janeiro im Jahr 1992 gelobt. Dort wurde die Klimarahmenkonvention beschlossen – das Dach für die seit 1995 jährlich tagenden Klimakonferenzen (COP, Conference of the Parties). Aufgrund des deutschen Engagements fand die erste Klimakonferenz 1995 in Berlin statt, und das UN-Klimasekretariat ist seit 1996 in Bonn angesiedelt. „Am Anfang gab es durch alle Parteien hinweg einen Konsens, dass wir konsequent und mit einem breiten Maßnahmenbündel gegen die Erderwärmung handeln müssen – ebenso wie es beim Ozonloch der Fall war“, sagt Ministerialrat a. D. Wolfhart Dürrschmidt. Der Konsens wäre damals möglich gewesen, weil die Abgeordneten ihre Verantwortung gesehen hätten. Und die Lobbyisten waren weitaus weniger aktiv als heute.
Wer die Berichte der ersten Klima-Enquetekommissionen von 1988 bis 1990 liest, versteht schnell, dass hier von einem fundamentalen Umbau der auf fossilen Brennstoffen basierenden Gesellschaft gesprochen wurde. Die Folgen dieser Berichte hätten viele Lobbyisten erst viel später realisiert, erzählt der parteilose Dürrschmidt. Am Anfang sei es noch sehr ruhig gewesen, weil niemand daran geglaubt habe, dass die erneuerbaren Energien wirklich ein nennenswertes Niveau erreichen würden. „Man hat Wind- und Solarkraft in den 1990er Jahren einfach nicht ernst genommen und gedacht, dass diese bei ein bis zwei Prozent stehen bleiben“, so Dürrschmidt.
Für die Energiewende wurde Deutschland weltweit berühmt. Doch vor allem der Lobby in der Energiebranche gelang es, das Ruder rumzureißen – zu Lasten des Klima- und Umweltschutzes. Andere Politikbereiche haben natürlich ebenso versagt, ihre Emissionen ausreichend zu senken, etwa das Agrarministerium oder das Verkehrsministerium. Gerade in diesem CSU-Ministerium hat die Klimaschmutzlobby erheblichen Einfluss: Diesel-Desaster, SUV-Boom, neue Autobahnen, Steuergeschenke für Diesel und über hundert Treffen von Autolobbyisten mit Spitzenpolitikern sind als mögliche Gründe zu nennen, warum die Emissionen im Verkehr unter Schwarz-Rot weiter gestiegen sind.
Aber immer noch ist die kohleschwere Energie der größte Emittent in Deutschland. Im Klimapaket steht dazu: „Die installierte Erzeugungskapazität aus Kohlekraftwerken im Markt soll bis 2030 auf insgesamt 17 Gigawatt reduziert werden und bis spätestens 2038 vollständig beendet werden.“[7] Ende 2017 lieferten die Kraftwerke noch 42 Gigawatt.[8]
Das bedeutet: Deutschland wird noch fast zwanzig Jahre den klimaschädlichsten aller Rohstoffe verbrennen. Braun- und Steinkohle sind laut Umweltbundesamt für rund 70 Prozent aller CO2-Emissionen in der Stromproduktion Deutschlands verantwortlich.[9] Trotzdem hat die Bundesregierung erst einen Ausstieg in knapp zwei Jahrzehnten geplant.
Wie die Lobby ab 2005 den Aufbruch stoppte
Dabei hatte mit Rot-Grün 1998 eigentlich der große Aufbruch zur Energiewende begonnen. Mit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – als Folgegesetz des Stromeinspeisegesetzes – im Jahr 2000 ging „die Post ab“. Innerhalb eines Jahrzehnts verdreifachte sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 6 auf knapp 18 Prozent.[10]
Nachdem Gerhard Schröder im Frühjahr 2005 Neuwahlen ausgerufen hatte, bekam die Bundesrepublik eine neue Regierung. Der Sozialdemokrat hatte sich verrechnet und verlor gegen die CDU-Kandidatin Angela Merkel. Damit waren die Grünen raus, und auch BMU-Referatsleiter Wolfhart Dürrschmidt bekam einen neuen Chef: Auf den Grünen Jürgen Trittin folgte der SPD-Mann Sigmar Gabriel. Für den neuen Minister stand der Klimaschutz allerdings nicht ganz oben auf der Agenda. Gabriel schien seinem eigenen Ministerium zu misstrauen. Er soll gedacht haben, dass dort nur grüne Überzeugungstäter säßen. So erzählen es verschiedene damalige Mitarbeiter. Auch Dürrschmidt sagt im Rückblick: „Im Umweltministerium gab es viele engagierte und sachkundige Leute, die aber keine Parteipolitik betrieben, sondern ihre Aufgaben im Umweltbereich ernst nahmen.“
Gabriel ersetzte als Erstes den damaligen Leiter der Abteilung Klimaschutz durch einen Mitarbeiter aus dem Kanzleramt: Urban Rid. Seine Ernennung ist bemerkenswert: Denn vor Gabriel bekleidete ein SPD-Genosse diese Stelle. Und normalerweise achten neue Minister darauf, auf wichtige Posten vor allem Mitglieder der eigenen Partei zu setzen. Nicht so in diesem Fall: Statt des SPD-Abteilungsleiters Dr. Hendrik Vygen, der unter Töpfer, Merkel und Trittin gedient hatte,[11] wurde der parteilose Urban Rid zum Klimaschutz-Chef im Bundesumweltministerium. In Folge der weiteren Umstrukturierungsmaßnahmen hatten es erfahrene Mitarbeiter zunehmend schwer, anspruchsvolle Maßnahmen zum Klimaschutz und zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu betreiben.
Rid machte sich mit seiner neuen Politik schnell Feinde unter den Fachleuten im BMU, die noch unter Umweltminister Trittin für eine zügige Energiewende stritten.[12] So sehen es zumindest einige Mitarbeiter des Umweltministeriums. Sie und einige Abgeordnete bezeichnen Urban Rid als Bremser und Karrieristen, der nicht auf Fachleute hören wollte. Urban Rid habe anfangs abschätzig über die Erneuerbaren geredet und Vertreter der Branche auch schon mal als „Futzis“ bezeichnet. Mit den großen Energieversorgern habe sich der Abteilungsleiter hingegen immer gut gestellt, heißt es von Insidern. „Urban Rid ist ein typischer Lobbymann, der immer eng mit den großen Energieversorgern war“, erklärt auch der parteilose Bundestagsabgeordnete Marco Bülow. Er trat 2018 aus der SPD aus – auch aus Protest gegen die katastrophale Klimaschutz- und Energiewendepolitik seiner Partei. Urban Rid wollte sich uns gegenüber nicht zu seiner Zeit im Ministerium äußern und reagierte abweisend auf unsere mehrfachen Anfragen.[13]
Manche unserer anonymen Quellen erklären, besonders im Wirtschaftsministerium herrschte und herrsche generell Angst vor dem großen Einfluss der Lobby von Kohle- und Atomenergie, und so würde deren Argumentation übernommen. Mit ihren PR-Maschinerien seien diese in der Lage, die Bürger gegen die Regierung aufzuwiegeln. Auch deshalb hätten Beamte wie Rid Angst, dass die Erneuerbaren zu schnell wüchsen und gegen den amtierenden Minister Stimmung gemacht werde, beispielsweise mit dem Argument, dass die Energiewende zu teuer werde. Deshalb habe sich der Abteilungsleiter Rid auch dafür stark gemacht, dass die Erneuerbaren nicht unbegrenzt ausgebaut werden könnten und sich die Solar- und Windbetreiber per Ausschreibung auf freie Kapazitäten bewerben müssten. Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärte, dass Urban Rid sich kaum für die komplexen Zusammenhänge der Energiewende interessierte: „Der Willen, sich etwas anzuhören, war begrenzt.“ Viele beschreiben ihn als Freund der Marktlösungen: Er sei durch und durch neoliberal gewesen, heißt es.
Sigmar Gabriel als Bremser
Wolfhart Dürrschmidt und auch von uns befragte Abgeordnete wie Marco Bülow verorten den Anfang vom Ende einer erfolgreichen Klimaschutzpolitik in Deutschland mit dem Amtsantritt von Sigmar Gabriel als Bundesumweltminister im Jahr 2005.
Gabriel holte sich nicht nur Urban Rid als Klimaschutz-Abteilungsleiter an Bord, sondern auch Staatssekretär Matthias Machnig. Machnig hatte Gerhard Schröders erfolgreichen Bundestagswahlkampf 1998 organisiert, er gilt als begnadeter Spindoktor. Machnig sei laut Marco Bülow und BMU-Mitarbeitern stark im alten System verhaftet gewesen – ein Freund der großen Energieversorger wie E.ON, EnBW, RWE oder Vattenfall. Im Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 geriet der Staatssekretär unter den Verdacht der Vorteilsnahme, weil er zunächst eine WM-Einladung von EnBW-Chef Utz Claassen angenommen haben sollte. Gegen Zahlung einer Geldbuße wurde das Verfahren jedoch eingestellt. Zu der Zeit verhandelte Machnig als BMU-Staatssekretär beispielsweise über den Emissionshandel mit den großen Energieversorgern.[14] „Mir eine Nähe zu den großen Energieversorgern anzuhängen ist absurd“, erklärt der ehemalige Staatssekretär auf Anfrage.[15] Über seine Zeit als Staatssekretär sagt er heute: Er sei jahrelang das „Scharnier“ zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium gewesen. Deshalb seien viele Klimaschutzinitiativen angestoßen worden. Allerdings, so räumt Machnig ein, seien nicht alle Ideen „durchgekommen“. Beispielsweise die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen. Vor allem das Finanz- und das Verkehrsministerium hätten solche progressiven Vorschläge abgebügelt, sagt Machnig, der Ende der 1990er Jahre auch Staatssekretär im Verkehrsministerium war.
Auch er kritisiert, wie zentrale Klimaschutzinstrumente – etwa der EU-Emissionshandel – umgesetzt wurden. Laut Machnig habe man beim Emissionshandel von Anfang an die Industrie begünstigt, statt sie wirklich dazu zu zwingen, CO2 einzusparen. „Der Druck der Lobbys war Anfang der 2000er Jahre unglaublich groß. Damals warnten sie vor einer ‚Deindustrialisierung Deutschlands‘.“ Später hätten sie mit der Wirtschafts- und Finanzkrise argumentiert. Das habe zu einer enormen Überausstattung der Unternehmen mit den Zertifikaten geführt, die sie eigentlich für jede Tonne zu viel ausgestoßenes CO2 dazukaufen müssen. Letztendlich habe das zu einem sehr niedrigen CO2-Preis pro Tonne und Zertifikat geführt. Deutschland sei einer der Treiber in der EU dafür gewesen, den Handel industriefreundlich zu gestalten, so Machnig rückblickend. Für andere Versäumnisse der schleppenden Energiewende macht Machnig hingegen die Regionalpolitik verantwortlich: Das Abwürgen der Energiewende habe nicht nur mit wirtschaftsfreundlichen Umweltministern wie Peter Altmaier zu tun, sondern auch mit den bürokratischen Hürden der Länder. Viele hätten gebremst. Dafür sei dann oft die Bundesregierung verantwortlich gemacht worden.
Während Machnig nach seiner Zeit in der Politik bei einem Start-up für erneuerbare Energien anheuerte,[16] versucht es sein einstiger Chef, Sigmar Gabriel, eher bei den großen Unternehmen. Zuerst sollte Gabriel Lobbyist für Siemens Alstom werden, deren Fusion er als Wirtschaftsminister selbst begleitet hatte.[17] Später hat die EU-Kommission diese Fusion für ungültig erklärt, und Gabriel erhielt schließlich doch keinen Posten im Verwaltungsrat.[18] Im Herbst 2019 aber war Gabriel, der ehemalige Umweltminister, als Präsident des Verbands der Automobilindustrie im Gespräch.[19] Sein Bundestagsmandat hatte er kurzerhand abgegeben. Im Januar 2020 schließlich wurde bekannt, dass Gabriel in den Aufsichtsrat der Deutschen Bank wechselt.
Gabriels Einknicken vor der Energielobby
Als Wirtschaftsminister knickte der SPD-Mann bei entscheidenden Gesetzen vor der alten Energielobby ein. Ein Beispiel ist die Klimaabgabe. Eigentlich wollte Sigmar Gabriel damit die alten und ineffizienten Braunkohlekraftwerke aus dem Markt drängen, also genau die Anlagen, die Deutschlands Klimaziele 2020 scheitern lassen. Auch Einrichtungen wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hielten das für eine gute Idee.[20] Die Energiekonzerne schalteten damals auf Gegenangriff: Der damalige RWE-Chef Peter Terium rief Hannelore Kraft (SPD) an, seinerzeit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin. Der Konzern hatte die Energiewende bis dahin weitgehend ignoriert. Die Braunkohle in alten Kraftwerken zu verstromen war ein Riesengeschäft. Viele, oftmals SPD-regierte Städte in NRW halten große Aktienpakete von RWE. Schon allein deshalb könnte Hannelore Kraft ein offenes Ohr für Terium gehabt haben. Anfang Juni 2015 traf sich Gabriel mit Gewerkschaftern und Kanzleramtschef Peter Altmaier von der CDU. Ergebnis dieses Treffens war die „Kohle-Reserve“ – das Gegenteil der ursprünglichen Idee des Kohleausstiegs. Die Konzerne sollten dafür entlohnt werden, dass sie sechs große Braunkohleblöcke für vier Jahre „bereithalten“, um sie bei theoretischen Stromengpässen anlaufen zu lassen. Erst danach sollten sie abgeschaltet werden.[21] Bis Oktober 2019 wurde die Sicherheitsreserve nicht einmal genutzt, kostet die Stromkunden aber 230 Mio. Euro pro Jahr.[22] Ein Beispiel ist das Braunkohlekraftwerk Buschhaus der Mibrag in Sachsen-Anhalt. Laut Medienberichten erhält der Kohlekonzern für die sogenannte Sicherheitsreserve rund 200 Mio. Euro – für vier Jahre Nichtstun.[23] Die Sicherheitsreserve sei nur ein „Trick“ von Gabriel gewesen, um den Kraftwerksbetreibern das Abschalten zu versüßen – und sich gleichzeitig nicht mit der EU anzulegen, die dies als Beihilfe hätte anfechten können. „In der Tat lassen sich die Braunkohlekonzerne dank ‚Abwrackprämie‘ den Ausstieg aus der Kohle mit Millionen vergolden, für Kraftwerke, die sowieso abgeschaltet worden wären. Am Ende müssen die Stromkunden die Zeche zahlen“, sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Energieabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Berliner Wirtschaftswissenschaftlerin forscht seit Jahren über die hohen Kosten, die der Klimawandel mit sich bringen wird – wenn nicht jetzt unsere Energie- und Verkehrssysteme endlich auf weitaus günstigere Alternativen umgestellt werden.
Einige Ex-Mitarbeiter erinnern sich, dass in den 2000ern die energieintensive Industrie und die vier großen Stromversorger besonders starken Lobbyismus gegen Klimaschutz betrieben. Ihre Profite hängen bis heute an Atom- und Kohlestrom und den Netzen, die sie für den Stromtransport betreiben. Die vier Energieriesen RWE, Uniper (eine Abspaltung von E.ON), E.ON und ENBW beherrschen bis heute den Energiemarkt – trotz zahlreicher kleinerer grüner Energieproduzenten, die mittlerweile dazugekommen sind. Gemeinsam setzten sie im Jahr 2018 über 100 Mrd. Euro um.[24]
Von Beginn an war die Lobby der milliardenschweren fossilen Riesen weitaus mächtiger als die der Erneuerbaren. Im Jahre 2014, als das Erneuerbare-Energien-Gesetz erneut verändert wurde, brachte es der Stromkonzern RWE laut einer Kleinen Anfrage der Linksfraktion auf insgesamt elf Treffen mit Regierungsvertretern, darunter zwei Abendessen und ein Hintergrundgespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD). Der Konzern E.ON kam sechs Mal mit hohen Regierungsvertretern zusammen, unter anderem auch mit der Kanzlerin, dem Wirtschaftsminister und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) konnte nur vier Treffen erreichen, allerdings kam er nie bis zur Kanzlerin.[25]
Als Sigmar Gabriel – nunmehr Wirtschaftsminister – die erneuerbaren Energien im selben Jahr 2014 wieder ins Wirtschaftsministerium holt, liegt die Energiewende endgültig wieder in den Händen jener, die sie lange verhindern wollten, erklären uns mehrere ehemalige Mitarbeiter. Und seitdem die Erneuerbaren-Abteilung unter dem wirtschaftsnahen Minister Altmaier arbeitet, muss sie ihren Chef immer wieder neu überzeugen, für den Klimaschutz zu handeln. „Die allermeisten bei uns haben die Dringlichkeit von Klimaschutz erkannt – aber auf Ministeriumsebene wird immer die schwächstmögliche Variante einer politischen Lösung gewählt“, klagt ein Mitarbeiter. Im Gegensatz zum BMU packe man das Thema Erneuerbare im Wirtschaftsministerium eben nicht von der Klimaschutzseite an.[26] Das Ministerium weigere sich, die externen Kosten von konventioneller Energie in seinen Berechnungen zu berücksichtigen. Dazu zählen etwa Kosten für Umsiedlungen für Braunkohleabbau, für Renaturierungen ehemaliger Abbaugebiete oder gesundheitliche Schäden durch Quecksilber durch das Verbrennen von Braunkohle. „Wir wurden misstrauisch beäugt“, sagt ein Mitarbeiter des Umweltministeriums, der sich plötzlich im Wirtschaftsministerium wiederfand. Sie seien wie Störenfriede in einer gut geölten Maschine behandelt worden.
Der Drehtüreffekt – raus aus der Politik und rein in die fossilen Lobbys
Bis heute haben die Energieriesen und interessengesteuerte Thinktanks einen besonders guten Draht ins Wirtschafts- und Verkehrsministerium. In manchen Fällen geben sich die Angestellten der Ministerien auch gar keine Mühe, das zu verschleiern. Thomas Bareiß, aktueller parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Abgeordneter für die CDU/CSU-Fraktion in Berlin, spricht sich in einem Facebook-Video der Initiative für Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) für deren Klimapolitik aus.[27] Das bedeutet: Ein eigentlich unabhängiger Vertreter des Volkes, in der Hierarchie direkt unter Wirtschaftsminister Peter Altmaier, macht Werbung für die Metallindustrie. Und für deren größtes Projekt 2019, die Bundesregierung von einer CO2-Steuer abzuhalten. Dass Bareiß ein Fan der INSM ist, ist kein Zufall. Er gehört auch dem parteiinternen „Berliner Kreis“ an, einer Gruppe, die sich selbst als klimawandelskeptisch versteht.
Wie eng die fossile Lobby mit einigen CDU-Mitgliedern verbunden ist, zeigt auch der ehemalige sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich. In seiner Zeit als Amtsinhaber galt er als „Mann der Kohle“ und leitete schließlich die Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, die über einen Kohleausstieg beriet und im Januar 2019 ihren Abschlussbericht vorlegte. Noch 2015 erklärte er: „Sachsen opfert keine Arbeitsplätze für Klimaziele“,[28] und man solle Atomstrom durch Braunkohle ersetzen.[29] Mittlerweile hat Tillich seine Vorliebe für die Kohle zum Fulltime-Job gemacht: Seit September 2019 arbeitet er als Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (MIBRAG). Medien schrieben, Tillich wolle sich seine industriefreundliche Haltung in der Kohlekommission „versilbern“ lassen.
Andere, wie der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende in NRW, Gregor Golland, haben einen Nebenjob beim Energieriesen RWE: Golland arbeitet in Teilzeit bei der RWE-Tochter innogy und erhält dafür nach eigenen Angaben bis zu 120 000 Euro.[30] Und auch Ex-Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat mittlerweile einen einträglichen Job bei dem Bergbaukonzern Saxony Minerals & Exploration AG mit bis zu 7000 Euro monatlich.[31]
Der enorme Lobbydruck auf die Ministerien und der träge, marktfreundliche Politikapparat führten schließlich dazu, dass die anfangs ehrgeizige Rhetorik beibehalten, Gesetze und Regulierungen aber verwässert wurden. Obwohl die erneuerbaren Energien über die Jahre stark anwuchsen, wurden weiterhin fossile Kraftwerke – darunter das Hamburger Steinkohlekraftwerk Moorburg (2015) und Wilhelmshaven (2014) – zugebaut und ein Parallelsystem geschaffen. Mitten in der Energiewende. Ende der Nullerjahre wurden die Investitionsentscheidungen gefällt, neun Steinkohleblöcke und vier neue Braunkohleblöcke von RWE und LEAG/Vattenfall zu errichten. Wären diese riesigen Blöcke nicht gebaut worden, hätten wir keine Kohlekommission gebraucht: Die älteren Kraftwerke wären bis 2038 von allein altersbedingt abgeschaltet worden. Doch um die Klimaziele zu erreichen, hätten erneuerbare Energien eben ausgebaut und zugleich Kohleenergie schrumpfen müssen. Stattdessen wollte die Bundesregierung Klima-Vorreiter spielen und gleichzeitig ihre fossilen Gewohnheiten pflegen, um die großen Stromversorger nicht zu verprellen. Den Preis dafür zahlen wir heute, mit enormen Summen an die Kohle-Riesen, doch einen noch weit höheren werden die jungen und die kommenden Generationen zahlen, wenn sie die dramatischen Umweltschäden ausbaden müssen.
Wertvolle Jahre, ja bald Jahrzehnte sind verflossen, ohne dass Kohle, Öl und Gas nennenswert teurer wurden. Nicht nur in Deutschland war die Antiklimalobby mit diesem Programm sehr erfolgreich. In kaum einem Land gibt es eine ehrgeizige klimapolitische Ordnungspolitik. Dafür gibt es jede Menge Anreizprogramme, freiwillige Kompensationsangebote, Ausschreibungsmodelle oder komplizierte Cap-and-Trade-Systeme. Dass die Länder aber bisher ihre Klimaziele gar nicht schaffen und kein Land der Erde mit seinen Maßnahmen „on track“ des Pariser 2-Grad- oder gar 1,5-Grad-Ziels ist, sagt viel darüber, welche Interessen sich hier schlussendlich durchgesetzt haben. Die neoliberalen Instrumente gegen den menschengemachten Klimawandel wie der Emissionshandel oder folgenlose Selbstverpflichtungen haben jedenfalls bisher nur äußerst schwache Ergebnisse geliefert.
„Die neoliberale Schule hat es verstanden, mit ihrer Denkschule die Welt zu erobern und mit ‚nudging‘ Prozesse anzustoßen. Da können Umwelt- und Klimaschützer noch viel lernen“, glaubt der US-amerikanische Politikwissenschaftler Lance Bennett.[32] „Die Frage ist deshalb auch, wie man den Klimaschutz so attraktiv macht wie die Heilsversprechen des Neoliberalismus.“
Oder wie es der Populismus- und Netzwerk-Experte Dieter Plehwe ausdrückt: „Paradoxerweise ist die Rechte inzwischen zu einer internationalen Partei geworden.“ Umso mehr müsse die Linke endlich von den Bemühungen der Rechten eines lernen – „nämlich sich grenzüberschreitend zu organisieren und zu koordinieren“.[33] Nur so wird der Kampf gegen die Klimawandelleugner und ihre mächtigen Lobbys erfolgreich sein können.
Der Beitrag basiert auf „Die Klimaschmutzlobby. Wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen“, dem neuen Buch der beiden Autorinnen, das vor kurzem im Piper Verlag erschienen ist.
[1] Nora Marie Zaremba und Jakob Schlandt, Schweigen statt Machtworte: Wie Peter Altmaier an der Energiewende verzweifelt, in: „Tagesspiegel“, 27.7.2019.
[2] Interview der Autorinnen mit Wolfhart Dürrschmidt im August 2019.
[3] Erster Zwischenbericht der Enquetekommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“, 2.11.1988, https://dipbt.bundestag.de.
[4] Erster Bericht der Enquetekommission „Schutz der Erdatmosphäre“, 31.3.1992, https://dip21.bundestag.de.
[5] Ebd., S. 100.
[6] Ankündigungen von Mitgliedern der Bundesregierung zur Einführung einer CO2-Abgabe/Klimaschutzsteuer, 30.10.1990, https://281dipbt.bundestag.de.
[7] Eckpunkte für das Klimaschutzprogramm 2030, www.bundesregierung.de.
[8] Abschlussbericht der Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“, www.bmwi.de, 2.1.2019.
[9] Hintergrund, Daten und Fakten zu Braun- und Steinkohlen, Dezember 2017, www.umweltbundesamt.de.
[10] Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland, März 2020, www.erneuerbare-energien.de.
[11] Dr. Hendrik Vygen arbeitete unter den Umweltministern Töpfer, Merkel und Trittin zunächst als Referatsleiter und später als Abteilungsleiter.
[12] Viele der von uns Interviewten wollen sich namentlich nicht nennen lassen. Sie arbeiten oder arbeiteten in Abteilungen des Bundesumweltministeriums oder des Wirtschaftsministeriums. Es sind vor allem Mitarbeiter, denen nach eigenen Aussagen eine ehrgeizige Klimapolitik und eine schnelle Energiewende wichtig sind. Die Parteizugehörigkeit spielt dabei keine Rolle.
[13] Mail von Urban Rid vom 21.10.2019.
[14] Staatssekretär Machnig zahlte Geldauflage, www.spiegel.de, 19.7.2006.
[15] Gespräch der Autorinnen mit Matthias Machnig am 29.10.2019.
[16] Matthias Machnig to support InnoEnergy’s role in transforming energy and automotive industries, 1.12.2018, www.innoenergy.com.
[17] Vorschläge für künftigen Verwaltungsrat von Siemens Alstom komplett, 15.5.2018, www.alstom.com.
[18] Telefonat mit Siemens-Pressestelle und E-Mail von Alstom am 14.10.2019.
[19] Sigmar Gabriel gilt als Favorit für den Job als Chef-Autolobbyist, www.spiegel.de, 27.10.2019.
[20] Effektive CO2-Minderung im Stromsektor: Klima-, Preis- und Beschäftigungseffekte des Klimabeitrags und alternativer Instrumente, DIW, 2015, www.diw.de.
[21] Jörg Staude, Benjamin von Brackel und Verena Kern, Wie der Kohleausstieg vereitelt wurde, www.klimaretter.info, 13.9.2017.
[22] Kleine Anfrage der Grünen von Februar 2018, https://dipbt.bundestag.de.
[23] Frank Johannsen, Mibrag kassiert Millionen für Geisterkraftwerk in Niedersachsen, in: „Leipziger Volkszeitung“, 5.3.2018.
[24] Umsatz der größten Energieversorger in Deutschland in den Jahren 2018 und 2019, https://de.statista.com.
[25] Vgl. die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Linkspartei, Drucksache 18/2078: Kontakte der Bundesregierung zur Energiewirtschaft im Rahmen der Marktliberalisierung der Ökostromförderung, dip21.bundestag.de, 3.9.2014.
[26] Dagmar Dehmer, Umweltministerium ohne erneuerbare Energien. Was wird aus der Energiewende?, in: „Der Tagesspiegel“, 16.12.2013.
[27] Siehe www.facebook.com/Marktwirtschaft/posts/1015656 5972170975, aufgerufen am 23.11.2019.
[28] Ministerpräsident Tillich im Interview: „Sachsen opfert keine Arbeitsplätze für Klimaziele“, in: „Dresdner Neueste Nachrichten“, 9.9.2015.
[29] Interview mit Ministerpräsident Tillich: „Atomstrom durch Braunkohle ersetzen“, www.bizz-energy.com, 5.4.3013.
[30] Vgl. ww.landtag.nrw.de/portal/WWW/Webmaster/GB_I/I.1/Abgeordnete/abgeordnetendetail.jsp?k=01557 und die Stufeneinteilung; sowie Roman Ebener, Kohle für Kohle: RWE und der Interessenkonflikt eines Abgeordneten, www.abgeordnetenwatch.de, 18.1.2017.
[31] Martin Reyher, Das sind die Nebeneinkünfte der Bundestagsabgeordneten, www.abgeordnetenwatch.de, 16.8.2019.
[32] Lance Bennett während seines Vortrags „The Political Organization of Disinformation about Climate Science“ am 9.8.2019 im IASS Potsdam.
[33] Dieter Plehwe, Social networks of influence in Europe – and beyond, in: Daphne Büllesbach, Marta Cillero und Lukas Stolz (Hg.), Shifting Baselines of Europe. New Perspectives beyond Neoliberalism and Nationalism, 2017.