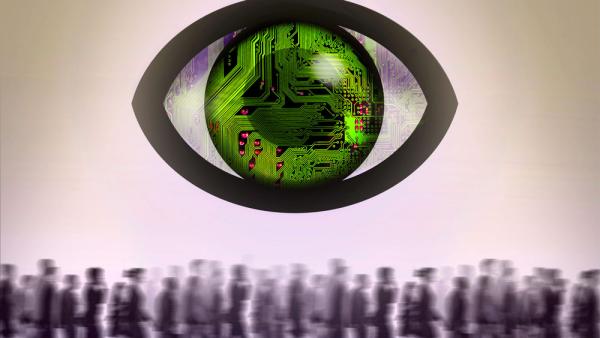Bild: Adolph Friedländer (1851-1904) - Public Domain (bearbeitet)
Australien führe einen Stellvertreterkrieg von globaler Tragweite, verkündete Ende Februar der dortige Finanzminister Josh Frydenberg, die ganze Welt blicke auf seinen Kontinent. Und tatsächlich hatte das Kräfteringen zwischen der liberal-konservativen Regierung in Canberra und den Techkonzernen des Silicon Valley internationale Bedeutung. Denn als erstes Land wollte Australien Google und Facebook per Gesetz dazu zwingen, ihre Werbeeinnahmen mit den traditionellen Medienunternehmen im Lande zu teilen.
Das am 24. Februar verabschiedete Gesetz sieht in der Tat ebendies vor. Gleichzeitig aber räumt die Regierung den Techkonzernen das Recht ein, bis spätestens Ende April eigene Vereinbarungen mit den Verlagen auszuhandeln. Damit ist es den Konzernen gelungen, ein mit dem neuen Kodex geplantes Schiedsverfahren, das ihre Macht erheblich beschnitten hätte, faktisch auszuhebeln. Der australische „Stellvertreterkrieg“ erbringt damit einmal mehr den Beweis, dass in Fragen der Regulierung nicht die Nationalstaaten, sondern die Internetkonzerne am längeren Hebel sitzen. Und da der Scheinsieg der australischen Regierung obendrein nun global Schule macht, hat diese dem Journalismus wie der Demokratie letztlich einen Bärendienst erwiesen. Wie aber konnte es – angesichts der lautstarken Ankündigung der australischen Regierung – zu dieser verhängnisvollen Niederlage kommen?
Tatsächlich treibt der Streit, der die australische Öffentlichkeit monatelang in Beschlag nahm, die globale Medienbranche seit über zehn Jahren um. Im Zentrum steht die Kritik der Verlage, dass Suchmaschinen und soziale Netzwerke von deren Produkten profitieren, indem sie kostenfrei auf Nachrichteninhalte verlinken oder diese zirkulieren lassen.
Die Medienhäuser sehen sich damit gleich zweifach benachteiligt, weil auch ihre Anzeigenkunden scharenweise zur digitalen Konkurrenz abgewandert sind. Konnten Zeitungsverlage im Jahr 1998 – also kurz nach dem Start von Googles Suchmaschine – noch fast die Hälfte der weltweiten Werbeausgaben für sich verbuchen, ist dieser Anteil seitdem kontinuierlich auf nunmehr acht Prozent geschrumpft. Insgesamt vier Fünftel des Werbekuchens gehen heute stattdessen an Facebook (28 Prozent) und an Google (53 Prozent).[1]
Zwar entgegnet Facebook auf solche Anschuldigungen stets, dass es seine Nutzerinnen und Nutzer allein im vergangenen Jahr rund 180 Mrd. Mal auf die Webseiten von Nachrichtenverlagen weitergeleitet habe; auf rund neun Mrd. US-Dollar schätzt das Unternehmen den Wert dieses Traffics.[2] Und auch Google betont, dass es in dem eigenen News-Angebot nur kurze Textauszüge, sogenannte Snippets, einblende und keine Anzeigen schalte. Um die Artikel in ganzer Länge zu lesen, müssten die Nutzer hier ebenfalls auf die Webangebote der Verlage zugreifen.
Allerdings verschweigen die Konzerne dabei mindestens zweierlei: Erstens kommen die meisten Verlage schon lange nicht umhin, selbst Anzeigen in den sozialen Netzwerken und Suchmaschinen zu schalten. Nur so können sie im erbitterten Kampf um die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer überhaupt noch bestehen. Und zweitens stellt bereits das Anzeigen von Snippets einen Eigenwert dar, etwa wenn sich Nutzer nur oberflächlich über die aktuellen Schlagzeilen informieren. Ein Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Parteien ist somit dringend erforderlich.
Als Tiger gesprungen…
Ursprünglich sah der im April 2020 vorgelegte australische Gesetzesentwurf daher vor, dass die Techkonzerne mit den Verlagen jeweils Lizenzgebühren aushandeln müssen, zu denen sie deren Inhalte nutzen bzw. auf diese verlinken können. Käme keine Einigung zustande, sollte, so der entscheidende Passus, ein staatliches Schiedsgericht verbindlich deren Höhe festlegen.
Gegen den Entwurf regte sich aus zwei unterschiedlichen Richtungen Protest. Zum einen warnten Nutzerinnen und Bürgerrechtsorganisationen vor einer „Linksteuer“, die das Grundprinzip des World Wide Web tatsächlich auf den Kopf stellen würde. Dessen Erfinder, Tim Berners-Lee, wandte sich daher bereits Mitte Januar höchstpersönlich an den Wirtschaftsausschuss des australischen Senats: Die Regierungspläne drohten, „das Netz weltweit unbrauchbar zu machen“, mahnte er eindringlich. Die Möglichkeit, frei zu verlinken, sei „grundlegend dafür, wie das Web funktioniert, wie es bis heute gediehen ist und wie es in den kommenden Jahrzehnten weiterwachsen wird.“[3]
In weit größere Aufregung versetzte der Gesetzesvorschlag zum anderen die Techkonzerne: Lege im Falle einer gescheiterten Verhandlung ein staatlich verordnetes Schiedsgericht die Höhe der Lizenzgebühren fest, werde das Ergebnis für die Konzerne unkalkulierbar, mahnte Facebook-Kommunikationschef Nick Clegg.
Weil das Gesetz anderen Regierungen als Blaupause dienen könnte, liefen die beiden Tech-Giganten dagegen Sturm. Vor allem Facebook ließ seine Muskeln spielen: Mitte Februar sperrte der Konzern für mehrere Tage sämtliche australische Medien in seinem sozialen Netzwerk. Dem Bann fielen allerdings nicht nur die Seiten der Nachrichtenverlage, sondern auch von Ministerien, Behörden und zahlreichen NGOs zum Opfer. Zensiert wurden dabei unter anderem Warnungen vor Sturzfluten im Bundesstaat Queensland sowie vor Waldbränden in Westaustralien.
Offenkundig scherte sich Facebook nicht darum, dass sein Erpressungsversuch akut Menschenleben gefährdete. Der Konzern wollte ein Exempel statuieren – ohne ein allzu großes Geschäftsrisiko einzugehen: Mit rund 25 Millionen Einwohnern ist Australiens Medienmarkt vergleichsweise klein, insbesondere wenn man ihn der globalen Facebook-Community aus knapp drei Milliarden Nutzerinnen und Nutzern gegenüberstellt. Zudem machen Nachrichteninhalte insgesamt nur vier Prozent aller Facebook-Postings aus.
Das Kalkül ging auf: Der Teil-Blackout offenbarte zwar erbarmungslos die Abhängigkeit der staatlichen Kommunikationsinfrastruktur von den Digitalkonzernen. Um deren Macht zu beschränken, hätte die australische Regierung daher um so energischer eine umfassende und radikale kartell-, steuer- und medienrechtliche Reform in Angriff nehmen können – und müssen. Stattdessen aber entschied sie sich in letzter Minute dafür, ausgerechnet das Schiedsverfahren aufzuweichen und damit dem eigenen Gesetzesvorschlag die Zähne zu ziehen.
Schmieren statt regulieren
Offenbar wollte es sich Canberra nicht restlos mit dem mächtigen US-Unternehmen verscherzen. Doch kaum hatte die Regierung diesem ein Schlupfloch geboten, kündigte Facebook an, dieses nun nutzen zu wollen, um „Verlage zu unterstützen“ – allerdings nur solche, „die wir aussuchen“.
Google hatte da bereits erste Deals mit australischen Verlagen abgeschlossen. Der Suchmaschinenanbieter ist auf die Vollständigkeit seines Angebots dringend angewiesen. Würde er dieses auch nur vorübergehend beschneiden, könnten Nutzer buchstäblich per Mausklick zu Microsofts Suchmaschine Bing wechseln. Google entschied sich daher frühzeitig, zweigleisig zu fahren: Zum einen lobbyierte der Konzern massiv gegen das australische Gesetzesvorhaben. Je näher aber die Verabschiedung des Kodex rückte, desto deutlicher signalisierte er auch seine Bereitschaft, für Nachrichteninhalte zu zahlen – allerdings ebenfalls nur zu den eigenen Bedingungen. Die Verlage ködert der Konzern mit einer aus ihrer Sicht gewaltigen Summe: Rund eine Mrd. US-Dollar will Google in den kommenden drei Jahren für die Lizenzierung ihrer Nachrichteninhalte ausgeben. Im Gegenzug müssen die Medienhäuser vertraglich zusichern, das staatlich verordnete Schiedsverfahren nicht in Anspruch zu nehmen.
Schmieren statt regulieren, lautet somit die Devise. Über das nötige „Kleingeld“ verfügen die Tech-Giganten zur Genüge. Im vergangenen Jahr verbuchte Googles Mutterkonzern Alphabet einen Umsatz in Höhe von fast 183 Mrd. US-Dollar, bei Facebook waren es knapp 86 Mrd. Dollar. Die angebotenen Lizenzgebühren nehmen sich da wie „Peanuts“ aus. Worauf die Konzerne indes um keinen Preis verzichten wollen, ist Macht – und zwar nicht nur die Macht, die auf ihren Plattformen angehäuften Datenberge zu verwerten, sondern auch jene Macht, ihre Geschäftspraktiken eigenmächtig zu gestalten und durchzusetzen. Diese Macht haben sie sich nun einmal mehr gesichert.
Rupert Murdoch: Der lachende Dritte
Zu allem Überfluss verkaufen sowohl Facebook als auch Google ihr Schmiergeld auch noch als philanthropische Zuwendung zur Rettung des Journalismus und der Demokratie. Das aber verweist auf den lachenden Dritten in der Runde: Rupert Murdoch. Der 90jährige Medienmogul und gebürtige Australier gilt als finanzstarker Unterstützer des australischen Premierministers Scott Morrison und zugleich als treibende Kraft hinter dem „Media News Bargaining Code“.[4] Sein Konglomerat News Corp ist das bei weitem größte der drei Medienunternehmen, die den australischen Markt dominieren.
Gerüchten zufolge bekommt News Corp von Google in den nächsten drei Jahren umgerechnet etwa 65 Mio. Euro. Im Gegenzug erhält der Internetkonzern für den gleichen Zeitraum Zugang hinter die Paywall der Murdoch-Blätter in Australien, aber auch des „Wall Street Journals“, der „New York Post“ sowie der britischen „Times“. Deren Artikel werden im Rahmen der Initiative „Google News Showcase“ prominent in den verschiedenen Angeboten des Internetkonzerns präsentiert. Den Medienunternehmen verspricht Google dadurch eine höhere Reichweite und zusätzliche Einnahmen.
Mit „Facebook News“ schuf Facebook jüngst ein ganz ähnliches Angebot. Mitte März einigte sich das Netzwerk mit News Corp ebenfalls auf eine Lizenzvereinbarung, wonach 17 Millionen australische Facebook-Nutzer ebenfalls für drei Jahre Zugriff auf dessen Nachrichtenbeiträge erhalten.
Auf den ersten Blick ergibt sich für die Internetkonzerne und die Verlage eine Win-win-Situation. Tatsächlich aber hängen die Verlage nun noch mehr am Tropf der Tech-Multis – zumal völlig offen ist, zu welchen Konditionen die Vereinbarungen nach drei Jahren fortgesetzt werden. Und dass ausgerechnet Rupert Murdoch mit dem frischen Geld Qualitätsjournalismus fördert, darf getrost bezweifelt werden: Derzeit geht eine Untersuchungskommission des australischen Parlaments der Frage nach, ob der Murdoch-Konzern „Rassismus als Geschäftsmodell“ betreibe und gezielt Rufmordkampagnen lanciere.[5] Und erst im vergangenen Mai stellte News Corp die Druckausgaben von mehr als hundert Lokal- und Anzeigenblättern ein, hunderte Journalistinnen und Journalisten verloren daraufhin ihren Job. Dabei hatte der Konzern für das Vorjahr noch einen Gewinn in Höhe von 155 Mio. US-Dollar vermeldet.
Lehren für Europa?
Doch damit nicht genug: Das australische Schauspiel wiederholt sich nun fast eins zu eins in anderen Teilen der Welt – aktuell auch in der EU.
Deren Mitgliedstaaten müssen bis zum 7. Juni eine vor knapp zwei Jahren im EU-Parlament beschlossene Urheberrechtsrichtlinie umsetzen. Diese sieht, ähnlich wie der Kodex in Australien, ein Leistungsschutzrecht vor, wonach Google, Facebook und Co. mit Verlegern und anderen Rechteinhabern Lizenzvereinbarungen aushandeln müssen, bevor sie deren Inhalte nutzen dürfen.[6] Und wie in Australien haben die Internetkonzerne längst auch in Europa bilaterale Verhandlungen mit den Verlagen aufgenommen, um eine rechtlich verbindliche Regulierung möglichst vorab auszuhebeln.
Bereits als sich das europäische Leistungsschutzrecht vor drei Jahren abzeichnete, begannen Facebook und Google damit, Redaktionen und Journalismus-Organisationen mit mehreren hundert Mio. US-Dollar pro Jahr zu „fördern“.[7] Derzeit bauen sie zudem auch in Europa ihre Nachrichtensektionen aus. Hierzulande sind bereits fast alle großen Tages- und Wochenzeitungen sowohl bei „Google News Showcase“ als auch bei „Facebook News“ vertreten – angefangen von „Zeit“, FAZ und „Spiegel“, über „Stern“ und „Handelsblatt“ bis hin sogar zur „taz“.[8] Noch im Mai soll das deutsche Angebot live gehen – just einen Monat vor jenem Stichtag, an dem Bundestag und Bundesrat die EU-Richtlinie zum Urheberrecht spätestens umsetzen müssen.
Statt also für eine Reform einzutreten, die die Macht der Techkonzerne endlich nachhaltig beschneidet, hängen sich somit auch die hiesigen Verlagshäuser an deren Finanztropf. Und auch wenn die Details der Kooperationsvereinbarungen nicht öffentlich bekannt sind, darf man von einem getrost ausgehen – nämlich dass die teilnehmenden Medienhäuser künftig die Füße stillhalten und keine weiteren Lizenzforderungen an Google und Facebook stellen.[9] Zahnlose Tiger finden sich somit nicht nur in Australien, sondern auch bei uns in Europa.
[1] Vgl. C. P. Chandrasekhar, Australia to make big tech pay for the news they link and direct users to, https://frontline.thehindu.com, 12.3.2021.
[2] Vgl. https://about.fb.com, 1.3.2021.
[3] Treasury Laws Amendment, Bill 2020, Submission 46, www.aph.gov.au, 18.1.2021.
[4] Vgl. Damien Cave, Google Is Suddenly Paying for News in Australia. What About Everywhere Else?, www.nytimes.com, 17.2.2021.
[5] Vgl. Marion Rae, This is democracy working: News Corp Aust, www.canberratimes.com.au, 19.2.2021.
[6] Vgl. Julia Reda, EU: Das Ende des Internets, wie wir es kennen?, in: „Blätter“, 12/2018, S. 21-24.
[7] Vgl. Ingo Dachwitz und Alexander Fanta, Medienmäzen Google, www.otto-brenner-stiftung.de, 26.10.2020.
[8] Die „Süddeutsche Zeitung“ und der Springer-Konzern, Erfinder des Leistungsschutzrechts, sind bislang bei keinem dieser Angebote vertreten. Vor allem Springer will sich weiterhin „mit Nachdruck für eine wirkungsvolle Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinie einsetzen“. Die Verlagswelt ist derzeit somit gespalten.
[9] Vgl. Christian Meier, Eine Milliarde: Wie Google versucht, deutsche Verlage zu vereinnahmen, www.welt.de, 5.10.2020.