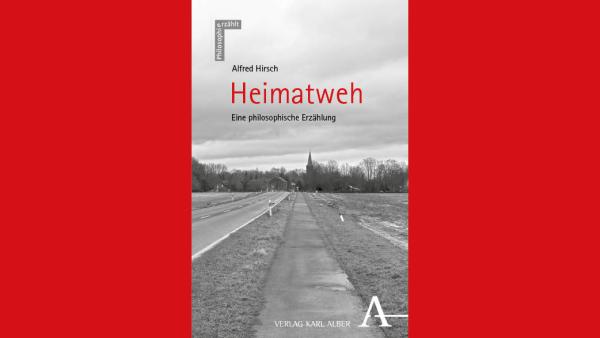Max Otte und das »Neue Hambacher Fest«

Bild: Ein Mann in traditioneller bayerischer Tracht nimmt beim »Neuen Hambacher Fest« am »Patriotischen Marsch« teil, 5. Mai 2018 (IMAGO / Pacific Press Agency)
Deutschland ist als republikanisch „verspätete Nation“ wahrlich nicht mit demokratischen Leuchttürmen gesegnet. Einer der wichtigsten unter ihnen ist zweifellos das Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße, auf dem sich 1832 die junge Demokratiebewegung konstituierte. Ausgerechnet dort findet seit 2018 das „Neue Hambacher Fest“ statt, bei dem sich unter offensiver Bezugnahme auf das historische Ereignis einmal im Jahr selbsternannte Patriot*innen treffen, um die demokratischen Institutionen unter Beschuss zu nehmen. Die dortigen Reden sind geprägt von Ressentiments gegen Einwanderung, Euro und EU sowie die Corona-Maßnahmen.
Initiiert und maßgeblich organisiert wird das „Neue Hambacher Fest“ seit 2018 von dem Ökonomieprofessor Max Otte, dem neuen Vorsitzenden der „WerteUnion“. Bekannt wurde er als „Crash-Prophet“, da er die Finanzkrise 2007/2008 vorausgesagt hatte. Otte ist CDU-Mitglied, aber bekennender AfD-Wähler und war drei Jahre Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung, ist jedoch im Januar dieses Jahres von diesem Amt zurückgetreten. Bei den „Neuen Hambacher Festen“ werden primär Reden gehalten, es wird scharf polemisiert und diffamiert, aber es wird auch Gitarre gespielt und festlich gegessen. Letztes Jahr wurde Vera Lengsfeld dort mit dem Preis für „Bürgersinn und Zivilcourage“ geehrt. Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin, ehemalige Grünen- und ehemalige CDU-Bundestags-Abgeordnete sympathisiert heute mit der AfD und ist als Corona-Leugnerin aufgefallen. Mit ihrem ostdeutschen Hintergrund agiert sie auf dem „Neuen Hambacher Fest“ als Zeitzeugin, die gerne bestätigt, dass im heutigen Deutschland angeblich Diktatur, Unterdrückung und Zensur herrschen – ganz wie einst in der DDR.
Viele Redner*innen auf dem Fest stehen der AfD nahe, sind in der Desiderius-Erasmus-Stiftung aktiv und publizieren in rechten Verlagen. Die Partei war dort mehrfach prominent vertreten: 2018 beispielsweise hielt Jörg Meuthen dort eine Rede, 2020 war Tino Chrupalla zu Gast.
Wäre das „Neue Hambacher Fest“ lediglich ein solitäres Ereignis, könnte man es mit Fug und Recht vernachlässigen. Es ist jedoch Teil einer größeren Strategie der Neuen Rechten, Demokratie umzudeuten und dafür zentrale Erinnerungsorte deutscher Demokratiegeschichte zu vereinnahmen – insbesondere Orte der 1848er Revolution.
Das Hambacher Fest von 1832 gilt als entscheidendes historisches Ereignis, das den Weg für die Demokratie in Deutschland geebnet hat. Eine bürgerliche Oppositionsbewegung, die unter anderem von den Publizisten und Journalisten Philipp Jakob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth initiiert wurde, protestierte damals zusammen mit Kaufleuten, Winzern, Ärzten und Studenten gegen Zensur und für Pressefreiheit. Darüber hinaus forderte sie Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Bürgerrechte in einem geeinten deutschen Nationalstaat. Zum Hambacher Fest kamen etwa 30 000 Menschen, darunter Handwerker, Bauern und Kleinbürger, sowie Frauen, die dezidiert als „freie Genossinnen des freien Bürgers“ Teil des demokratischen Aufbruchs werden sollten.[1] Da das Hambacher Fest für Völkerverständigung und Solidarität stand, war die Einbindung unterschiedlicher Nationalitäten – allen voran von Polen und Franzosen – wichtig; einige Teilnehmende sprachen sich für einen europäischen Völkerbund aus. Neben der polnischen Flagge wurde auf dem Hambacher Fest von 1832 eine schwarz-rot-goldene Flagge gehisst – der Ursprung unserer heutigen Nationalflagge. Nach dem Hambacher Fest wurden die Initiatoren verfolgt und vor Gericht gestellt. Einige von ihnen gehörten aber der ersten Deutschen Nationalversammlung 1848 in der Frankfurter Paulskirche an.[2]
Umdeutung des Hambacher Festes
Der Organisator des „Neuen Hambacher Festes“ stellt sich direkt in diese Tradition und proklamiert den Slogan „Wir sind Hambach“.[3] Auch der Titel der Veranstaltung ist ein direkter Verweis: Max Otte hat „Neues Hambacher Fest“ als Marke auf dem Patentamt eintragen lassen, wogegen die Stiftung Hambacher Schloss derzeit klagt. Otte zitiert außerdem gerne und ausführlich aus den historischen Reden. Dies verleiht seinem Anliegen Authentizität und gibt seinen nationalistischen Positionen den Anstrich eines altmodischen Patriotismus, wie er sich beispielsweise in einer Rede von Siebenpfeiffer findet: „Dies der Gedanke des heutigen Festes […] – der Gedanke, der Tausende von ausgezeichneten deutschen Bürgern auf dieser Höhe versammelt und den Millionen andere Deutsche mitempfinden, der Gedanke der Wiedergeburt des Vaterlandes. Und solcher Gedanke schallt von dieser Bergruine […], in alle Gauen des zerrissenen […] Gesamtvaterlandes hinüber!“
Otte nutzt die Referenz auf Hambach 1832 zum einen, um seine Ziele zu erläutern und ihnen Legitimität zu verschaffen: Damals wie heute gehe es um „nationale Einheit, Freiheit und Volkssouveränität“. Dafür bezeichnet er das Hambacher Fest von 1832 als eine „zutiefst patriotische Veranstaltung“, ein „Nationalfest der Deutschen“ – und als solches möchte er auch das „Neue Hambacher Fest“ verstanden wissen. Zum anderen nutzt er die direkten Vergleiche mit Hambach 1832, um Kritik an der gegenwärtigen Demokratie zu äußern. So herrschten damals wie heute „dunkle Zeiten“, in denen „der Rechtsstaat und die sozialen, wissenschaftlichen und kulturellen Errungenschaften bedroht“ seien[4] und die Obrigkeit die „Presse, die Meinungsfreiheit knebeln“ würde. Wer sich „dem Konformitätsdruck“ widersetze, werde „schikaniert, geächtet, in seiner beruflichen Existenz vernichtet oder […] – im schlimmsten Falle – sein Leben verlieren“, so Otte 2019.[5] Diese Behauptungen untermauert er gerne mit den Steinen, die ihm bei der Veranstaltung des „Neuen Hambacher Festes“ in den Weg gelegt worden seien. So hätten Tontechniker*innen und Gastwirt*innen in der Umgebung aus Angst vor Repressalien kurzfristig abgesagt. Zudem habe die Schloss-Stiftung die Teilnehmerzahl begrenzt, obwohl sicher tausende Leute mehr gekommen wären. Auch in der Opferrolle sieht sich Otte den Revolutionären von 1832 gleichgestellt.
Die geschichtlichen Bezüge dienen dabei einem doppelten Zweck: Erstens können die Rechtspopulist*innen so behaupten, dass sie nicht mehr in einer vollwertigen Demokratie leben – und zweitens, dass sie selbst die „wahren Demokrat*innen“ im Geiste von 1832 seien. Indem sie mit dem Hambacher Fest das Ursprungsereignis der 1848er-Revolution vereinnahmen, stellen sich die Rechtspopulist*innen direkt in die Tradition der damaligen revolutionären Demokrat*innen. Und indem sie sich als deren Nachfolger darstellen, präsentieren sie ihre politischen Positionen als Teil einer ursprünglichen demokratischen Tradition, um sie auf diese Weise gegen Einwände abzusichern. Mehr noch: Sie erheben so den Anspruch, die deutsche demokratische Tradition gegen die Bundesregierung zu verteidigen und überhaupt erst wieder zur Geltung zu bringen.
Die Homogenität des Volkes als antidemokratische Vorstellung
Die repräsentative Demokratie wird auf diese Weise „im Namen der Demokratie“ angegriffen. Dieser populistische Angriff auf Demokratie wird in Form eines Deutungskampfes um historische demokratische Traditionen und Demokratiekonzeptionen ausgetragen. Das führt zu einer paradoxen Situation, wie Philip Manow schreibt: Denn die Deutungskämpfe weiterlaufen zu lassen, kann ebenso eine Gefahr für die Demokratie sein wie sie zu unterbinden. Lässt man sie weiterlaufen, gibt man populistischen Demokratiekonzeptionen und stark polarisierenden Positionen eine große Bühne. Dann besteht die Gefahr, „dass die Feinde der Demokratie im Namen der Demokratie die Demokratie kapern könnten“. Manow sieht aber ebenso ein Risiko, wenn man die anderen als antidemokratisch ausschließt und damit den Diskurs verweigert, denn das widerspricht der Offenheit der Demokratie. Außerdem bestätigt es scheinbar die Anklage der Populist*innen, dass ihre Meinung unterdrückt würde und ihre Gegner*innen die eigentlichen Antidemokrat*innen seien. Diese Situation erfordert es, sehr präzise nachzuweisen, „wo und wie genau der beständige Appell an die Volkssouveränität eigentlich ins Antidemokratische kippt“.[6]
Die Vereinnahmung der Geschichte für die eigene Demokratiekritik ist ein bekanntes Instrument von Populist*innen und Neuen Rechten, wie die Historiker*innen Andreas Audretsch und Claudia Gatzka schreiben: „Neue rechtspopulistische und rechtsextremistische Bewegungen“ verfolgten die „Gesamtstrategie“, durch die Umdeutung und Instrumentalisierung von Geschichte „die Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern, ihre basalen Werte in Frage zu stellen und durch neue Werte zu ersetzen“.[7] Genau das versuchen die Initiator*innen des „Neuen Hambacher Festes“ mit ihrem Bezug auf die Geschichte des Hambacher Festes von 1832.
Dabei wird die offen formulierte Zielsetzung, die Veranstaltung zu einem „Nationalfest“ zu machen, auf den jährlichen Treffen in verschiedener Hinsicht ausgelegt: Zunächst richtet sich die Empörung hauptsächlich gegen die Migration und Flucht nach Europa seit dem Sommer 2015: Unverhohlen wird die „Umvolkung“ der deutschen Bevölkerung als ein angeblicher Plan der EU beschrieben, der durch „Replacement“ und „Resettlement“ von Geflüchteten erfolgen solle.[8] Die klassischen rechten Themen – Gegnerschaft zur EU, zum Euro und zur Aufnahme von Geflüchteten – tragen dazu bei, die Forderung nach der Einheit von Demokratie und Nation mit einiger Dringlichkeit zu untermauern.
Die Festrednerin und Preisträgerin Vera Lengsfeld sieht dementsprechend vor allem im „Islamismus“ den Feind, den man nicht ignorieren dürfe – das sei „brandgefährlich“ und „potentiell tödlich“. Denn die Sicherheit der Frauen sei in Gefahr, denen sogar die Polizei rate, nicht mehr alleine auf die Straße zu gehen.[9] Der teilnehmende Journalist Imad Karim – selbst einst aus dem Libanon eingewandert – schlägt einen ähnlichen Ton an: „Falsche Toleranz, ‚verordnete‘ Fremdenliebe und Mystifizierung des Islam werden dafür sorgen, dass Deutschland, so wie wir es heute lieben und ehren, bald nicht mehr zu erkennen sein wird.“[10]
Diese Fremden- und Islamfeindlichkeit versucht der emeritierte Juraprofessor Johann Braun als ein demokratietheoretisches Argument zu präsentieren. Er schreibt, das Ziel des „Neuen Hambacher Festes“ sei es, die nationale Einheit und politische Freiheit zu erhalten, während es 1832 um deren „Erringung“ gegangen sei. Was 1832 erst erstritten werden sollte, sähen heutige Patriot*innen in besonderer Weise gefährdet. Nicht nur die EU und der Euro gefährdeten die nationale Einheit und politische Freiheit, sondern vor allem die Aufnahme von Geflüchteten und der Zuzug von Migrant*innen. Gerade die Einwanderung aus islamisch geprägten Ländern erzeuge ein Problem für die Demokratie: Demokratie sei nämlich nur da möglich, wo sich die Menschen als „Teile eines Ganzen“ fühlten, nicht aber da, „wo man im politischen Gegner primär den ‚Fremden‘ erblickt, der dieses Ganze prinzipiell ablehnt und durch eine Ordnung völlig anderen Zuschnitts ersetzen möchte.“
Braun bezieht sich hier offensichtlich auf die Auseinandersetzung mit dem politischen Islam, den er als „politischen Gegner“ betrachtet, der die gesamte Ordnung ablehnt und durch eine völlig andere ersetzen möchte. Der politische Islam, so folgert Braun, steht der Demokratie im Wege, weil er das Gefühl zerstöre, Teil eines Ganzen zu sein. Dieses Gefühl werde erzeugt durch „eine gemeinsame Abstammung, Sprache, Geschichte, Religion, Kultur usw.“[11] Fehle es aber an „Homogenität des Demos“, gefährde das die Demokratie, weil die unterlegene Minderheit sich dann als „existenzieller Widerpart“ empfinde und dadurch keine gemeinsame Basis für die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen bestehe. Nach Brauns Ansicht gefährden Einwanderer*innen und Migrant*innen also die notwendige Homogenität des Volkes. Er beruft sich an dieser Stelle auf Jean-Jacques Rousseau, der bereits die Notwendigkeit, sich als Teil eines Ganzen zu fühlen, als eine Voraussetzung für Demokratie beschrieben habe.
Tatsächlich geht Brauns Vorstellung von Rousseau aber auf Carl Schmitt zurück. Schmitt benennt „die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation“ bzw. die nationale Homogenität als das, was die notwendige Gleichheit in der Demokratie erzeuge. Zugleich muss das, was Ungleichheit erzeugt – also das Fremde –, ausgeschlossen werden, wie Schmitt schreibt: „Die politische Kraft einer Demokratie zeigt sich darin, dass sie das Fremde und Ungleiche, die Homogenität Bedrohende zu beseitigen oder fernzuhalten weiß. […] Seit dem 19. Jahrhundert besteht sie [die Gleichheit] vor allem in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Nation, in der nationalen Homogenität.“[12] Während Schmitts Ziel vorrangig die Erzeugung von Homogenität durch „Beseitigung“ ist, verweist Braun eher auf das „Fernhalten“ von Fremden, also auf die Abwehr von Veränderung. Man könnte dies für konservativ halten, der Kontext zeigt aber, dass es hier um eine antidemokratische Programmatik der Homogenitätserzeugung geht.
Freiheit statt Sozialstaat
Eine etwas anders gelagerte Kritik kommt von Markus Krall, einem regelmäßigen Redner auf dem „Neuen Hambacher Fest“ und vielfachem Buchautor. Er sieht die Demokratie in Gefahr, da der Volkswille durch die Institutionen – insbesondere Parlament, Parteien und Medien – nicht mehr repräsentiert werde. Die Demokratie sei durch korrupte Parteien und propagandistische Medien gekapert worden. Krall fordert daher Volksabstimmungen nach schweizerischem Vorbild, die dem Volkswillen direkten Ausdruck verleihen würden. Auch in dieser durchaus gängigen Kritik an repräsentativer Demokratie und der Forderung nach mehr direkter Demokratie erkennt man das Potential zum Antidemokratischen. Denn Krall geht davon aus, dass der Volkswille unmittelbar vorhanden und evident ist und nicht erst gebildet werden muss. Würde man das Volk in einem Plebiszit nach seiner Meinung fragen, wäre also klar, wofür oder wogegen es sei. Das Volk habe nämlich „mehr Durchblick“ als die gesetzgebende Instanz und würde daher – logischerweise – gegen „Massenmigration“ oder die Mitgliedschaft in der EU stimmen.[13]
In just dieser Vorstellung, dass es eine „unmittelbare und spontane Auffassung des Volksausdrucks“ gebe, sieht der Historiker und Demokratietheoretiker Pierre Rosanvallon den Kernpunkt einer populistischen Demokratietheorie. Dieser Auffassung zufolge könne sich der Volkswille nur spontan äußern, wenn der „Sieg über die Feinde des Volkes“ errungen wurde – durch Ausschluss und Beseitigung der „Fremden“. Die Behauptung eines unmittelbaren und unzweifelhaften Volkswillens ist laut Rosanvallon im Kern antidemokratisch, weil sie suggeriert, dass es keinen Verständigungsprozess braucht, um eine öffentliche Meinung zu bilden. Das heißt, Elemente der Deliberation und die Notwendigkeit zur Einbeziehung vielfältiger Perspektiven werden ausgeschlossen. Schließlich benötige der Volkswille auch keine vermittelnden Instanzen, wie Medien, für die Bildung einer öffentlichen Meinung.[14]
Ganz so idealtypisch zeigt sich das bei Markus Krall allerdings nicht. Er beurteilt die aktuelle Lage zwar so, dass die Medien die Meinung des Volkes propagandistisch verzerren würden, formuliert aber eine Strategie, wie eine alternative Medienmacht erzeugt werden könne: durch die Schaffung von Think-Tanks und die Nutzung eigener Medien sowie in einem letzten Schritt durch die Beeinflussung der klassischen Medien.[15] Was den Ausschluss von „Fremden“ angeht, geht Krall allerdings einen Schritt weiter: Er kritisiert nicht nur stark die Einwanderung, sondern plädiert in seinem Vorschlag einer Wahlrechtsreform obendrein für den Ausschluss von Empfänger*innen von Sozialhilfe und anderen staatlichen Transferleistungen. Solange man Geld vom Staat erhalte, solle man nicht wählen dürfen. Krall begründet dies allerdings eher ökonomisch und rationalistisch – also weniger im Sinne der Einheit von Demokratie und Nation als vielmehr im Sinne eines angeblichen Bündnisses der Transferempfänger*innen mit den von ihnen gewählten Abgeordneten: Die Transferempfänger*innen würden von Leistungen profitieren, über die sie vorher selbst – per Wahl der Abgeordneten – entschieden hätten. Außerdem habe man die Wahl, wählen zu gehen oder Leistungen vom Staat zu erhalten. Die Freiheit, die Wahl zu haben, könne auch ein Anreiz sein, dass weniger Menschen Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Hier kommt Kralls Antisozialismus zum Vorschein, den er mit Lengsfeld und anderen teilt und unter dem er schlicht die Gegnerschaft zum umverteilenden Sozialstaat versteht.
Diesem empfundenen Sozialismus setzt Krall die Freiheit entgegen. Sein Verständnis von Freiheit ist dabei stark auf die Sicherung von Eigentum und Familie ausgerichtet. Freiheit würde entstehen durch den Schutz und die Förderung von Ehe und Familie, Eigentum, Individualität (hierunter ist vor allem der Schutz der Privatsphäre gemeint), Religion (christlich-jüdischer Prägung) sowie Kunst, Kultur und Musik. So wie Krall das beschreibt, garantieren diese Freiheitsrechte aber nicht die individuelle Freiheit, sondern sichern eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung. Ein Beispiel: Ehe und Familie dienen bei ihm nicht dem Streben nach individuellem Glück, sondern bilden einen Baustein der Gesellschaft. Eigentum soll geschützt werden, um den Kernbaustein der Gesellschaft – die Familie – zu behausen, zu beschützen und zu ernähren. Dieses Verständnis von Freiheitsrechten verweist auf eine weitere Parallele zu den Schriften von Carl Schmitt.
Auch bei Schmitt gewähren die Freiheitsrechte nicht in erster Linie individuelle Freiheit, sondern begründen „die soziale Struktur einer individualistischen Ordnung“. Ihm dienen die Freiheitsrechte also in erster Linie zur Sicherung einer gesellschaftlichen Ordnungsstruktur, für die zur Not individuelle Freiheiten geopfert werden dürfen – was seine Theorie als Legitimationsressource für populistische Angriffe auf die Demokratie so attraktiv macht.[16] Wie bei Schmitt geht es bei Krall auch nicht um die individuellen Freiheitsrechte an sich, sondern um die Sicherung einer gesellschaftlichen Ordnung – und zwar einer neoliberalen, die auf konservativen Werten beruht. Für die können dann zur Not auch wieder individuelle Freiheiten oder Grundrechte geopfert werden – beispielsweise das Wahlrecht bestimmter Bevölkerungsgruppen.
Diskursverweigerung bedeutet Demokratieverweigerung
Letztlich stellt sich die Frage, welche Demokratiekonzeption hinter der Meinung, wir seien heute wieder auf dem Weg in eine „Diktatur“, gepaart mit dem Aufruf zu einer „Bürgerlichen Revolution“ steckt. Die auf dem „Neuen Hambacher Fest“ beschworene „Diktatur“ besteht einerseits im vermeintlich sozialistischen Umverteilungsstaat, andererseits in der angeblichen Unterdrückung von Meinungsfreiheit durch „political correctness“. Die Rede von der Diktatur gehört zur Krisenrhetorik und soll Angst verbreiten. Auf die Frage, wohin es führen würde, wenn die Politik so weitermache wie bisher, antwortete Otte 2018: „Direkt in die Katastrophe, das Ende des Bürgertums, das Ende der Mittelschicht, das Ende der Freiheit und wahrscheinlich das Ende des Friedens in Europa.“[17]
Allerdings kommt die „Revolution“, die das verhindern soll, vergleichsweise zahm daher. Krall beispielsweise schlägt zivilen Ungehorsam vor, der in erster Linie dazu dienen soll, den Besitz zu bewahren. So sollten vom Dieselfahrverbot Betroffene sich dazu verabreden, auf einem Autobahnkreuz im Kreis zu fahren, immer rechtsherum. Schon 80 Fahrzeuge würden ausreichen, um ein Autobahnkreuz komplett zu blockieren, mit 800 Autos ließe sich der gesamte Verkehr rund um Stuttgart lahmlegen.[18] Auch andere vorgeschlagene Methoden bewegen sich eher im rechtsstaatlichen Rahmen, wie das Klagen vor Gericht oder das Nutzen alternativer Medienkanäle. In den Strategien, wie auf die drohende Diktatur zu reagieren sei, lassen sich also keine antidemokratischen Tendenzen erkennen. Jedoch verweist die starke Krisen- und auch Kampfrhetorik auf eine antidemokratische Diskursverweigerung. Denn das Ziel dieser Rhetorik ist nicht Verständigung, sondern Diffamierung, Angstmache und Übertreibung.
Der Bezug auf das Demokratische des Hambacher Festes ist also durchaus als Tarnung für das Nationalistische zu verstehen und reiht die Initiator*innen des „Neuen Hambacher Festes“ in die Reihe jener Neuen Rechten ein, die ihre antidemokratischen Vorstellungen hinter einer demokratischen Fassade verstecken. Bewusst beziehen sie sich dabei auf eine historische Zeit, die vor dem Nationalsozialismus liegt und in der Begriffe wie „Vaterland“ noch unschuldig waren, weil sie noch nicht im Zusammenhang mit den späteren Verbrechen des deutschen Nationalstaats standen. Es wäre daher eine Untertreibung, diese Veranstaltung als „nationalkonservativ“ zu beschreiben, wie es beispielsweise der Mainzer Historiker Andreas Rödder getan hat.[19] Denn das übersieht die eigentliche nationalistische Bestrebung: erst einmal etwas Erhaltenswertes zu schaffen, das dann (konservativ) erhalten werden kann. Es liegt näher, die Veranstaltung in die Strategie der Neuen Rechten einzuordnen.
Vor diesem Hintergrund wäre es fahrlässig, das „Neue Hambacher Fest“ nicht als antidemokratische Veranstaltung ernstzunehmen. Die ständige Diffamierung von Politiker*innen und Medienvertreter*innen macht den politischen Gegner zum Anderen, mit dem keine Demokratie mehr möglich ist, und ist eine Diskursverweigerung. Diskursverweigerung aber bedeutet Demokratieverweigerung. Die nationalistische Forderung nach Fremdenabwehr und der angestrebte sozialstaatsfeindliche Wahlrechtsentzug heißt, die Demokratie nur als Verwirklichungsraum der vorpolitischen Nation zu begreifen. Indem aber die Nation der Demokratie übergeordnet wird, kippt der Protest gegen Zuwanderung, Sozialstaat und Anti-Corona-Maßnahmen ins Antidemokratische. Damit ist der von Philip Manow geforderte Nachweis erbracht und die Paradoxie aufgelöst: Wer Max Otte den Zugang zum Schloss verwehrt, handelt nicht antidemokratisch, sondern stellt sich gegen eine nationalistische Deutung der Demokratie, die nicht nur der aktuell vorherrschenden, sondern grundlegend jeglicher Auffassung von Demokratie widerspricht.
[1] Wilhelm Kreutz, Zur Vorgeschichte. Neustadt, das Hambacher Fest und seine Nachwirkungen, in: Markus Raasch (Hg.), Volksgemeinschaft in der Gauhauptstadt. Neustadt an der Weinstraße im Nationalsozialismus, Münster 2020, S. 61-70.
[2] Wilhelm Bleek, Der Vormärz. Deutschlands Aufbruch in die Moderne, München 2019, S. 164-170.
[3] Max Otte, Vorwort von Prof. Dr. Max Otte, in: Max Otte (Hg.), Neues Hambacher Fest 2019, Köln 2019, S. 7-12.
[4] Ebd., S. 9 und S. 8.
[6] Philip Manow, (Ent-)Demokratisierung der Demokratie. Ein Essay. Berlin 2020, S. 15, S. 140 und S. 17.
[7] Andreas Audretsch und Claudia Christiane Gatzka (Hg.), Schleichend an die Macht. Wie die Neue Rechte Geschichte instrumentalisiert, um Deutungshoheit über unsere Zukunft zu erlangen, Bonn 2020, S. 18.
[8] Johann Braun, Hambacher Feste. Nationale Einheit und Freiheit gestern und heute, Köln 2019, S. 48.
[9] Zit. nach Braun, Hambacher Feste, a.a.O.
[10] Zit. nach Otte, Neues Hambacher Fest, a.a.O., S. 28.
[11] Braun, Hambacher Feste, a.a.O., S. 8-9, S. 49 und S. 78.
[12] Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlin 81996, S. 14.
[13] Markus Krall, Die Bürgerliche Revolution. Wie wir unsere Freiheit und unsere Werte erhalten, Stuttgart 2020, S. 232-233.
[14] Pierre Rosanvallon, Das Jahrhundert des Populismus. Geschichte, Theorie, Kritik, Hamburg 2020, S. 36 und S. 41-42.
[15] Krall, Die Bürgerliche Revolution, a.a.O., S. 167.
[16] Tim Reiß, Lässt sich Carl Schmitts Verfassungsverständnis entnazifizieren? Oder: Carl Schmitts doppeldeutiger Begriff des „bürgerlichen Rechtsstaats“, in: „Leviathan“, 4/2019, S. 474-497, S. 481 und S. 475.
[17] Max Otte, „Gnadenlos enger Meinungs- und Medienmainstream“. Interview, www.neues-ham-
bacher-fest.de, 2018.
[18] Krall, Die Bürgerliche Revolution, a.a.O., S. 173.
[19] Andreas Rödder, Max Otte veranstaltet „Neues Hambacher Fest“: Politische Mitte muss offensiver für Hambach streiten (Interview), www.swr.de.