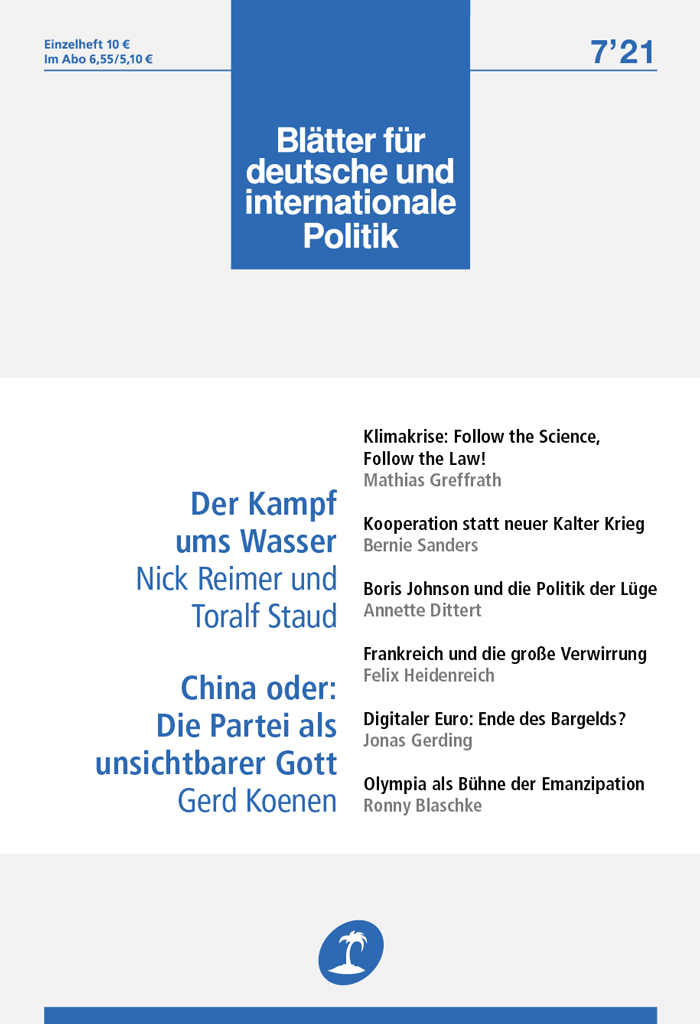Bild: IMAGO / Christian Ohde
Den meisten Medien war es kaum mehr als eine Randnotiz wert: Ende Mai einigte sich die Europäische Zentralbank (EZB) auf wichtige Eckpunkte ihres Konzepts für einen „Digital Euro“. Zwar wird es nach Schätzungen von Notenbankchefin Christine Lagarde noch mindestens vier Jahre dauern, bis die EU ihre eigene Digitalwährung einführt. Doch schon jetzt schlägt die Union mit ihren Plänen ein neues Kapitel der Geldpolitik auf – dessen Folgen wir alle im Alltag spüren werden. Seit Jahren zeichnet sich in vielen Ländern der Eurozone ab, dass die Nutzung von Bargeld deutlich nachlässt – zugunsten von digitalen Bezahlweisen. Die Corona-Pandemie beschleunigte das Tempo dieses Wandels noch einmal deutlich: Immer mehr Menschen lassen sich mittlerweile auf digitale Finanzdienste ein. Sie bestellen online, zahlen mit PayPal, Klarna und den Online-Services ihrer Banken. Und auch in Geschäften kramen immer weniger Kunden Scheine und Münzen hervor, sondern zücken ihre Chipkarte oder das Smartphone. Und da obendrein der Bitcoin und andere dezentral, jenseits von staatlicher Kontrolle organisierte Kryptowährungen in den vergangenen Wochen gewaltige Kursschwankungen verzeichneten, wächst nicht nur in Brüssel das Interesse an einer stabilen digitalen Zahlungsoption.
Zugleich weiß Lagarde sehr wohl, auf welch sensibles Terrain sie sich begibt. Gerade in der Bundesrepublik, der Bastion der treuen Anhänger des Bargelds, wecken die EZB-Pläne die Befürchtung, zukünftig nicht mehr mit den vertrauten Banknoten zahlen zu können. „Wir glauben, dass der digitale Euro das Bargeld nicht ersetzen wird“, wiederholte Lagarde daher gleich mehrmals in ihrer gewohnt ruhigen Art, als sie das Vorhaben im vergangenen November erstmals öffentlich skizzierte. „Aber ich vermute, dass er kommen wird.“[1]
Bargeld 2.0: China als Vorreiter
Trotz der demonstrativen Gelassenheit Lagardes steht bei dem Projekt Digital Euro indes weit mehr auf dem Spiel als „nur“ die Einführung einer komfortablen Zahlungsmethode – und zwar zum einen die Hoheit der Zentralbank über die Geldpolitik. Lagarde selbst verweist in dieser Hinsicht auf „Diem“, das ursprünglich von Facebook als „Libra“ initiierte Projekt einer privaten Kryptowährung, die dem herkömmlichen Finanzsystem in Zukunft Konkurrenz machen könnte.[2] Zum anderen ist der digitale Euro auch eine Antwort auf die politische Frage nach dem Stellenwert des Euros im globalen Währungsgefüge. Denn andernorts sind Staaten schon weiter: Die Bahamas führten im vergangenen Oktober eine digitale Version ihrer Währung ein, Schweden testet Ähnliches mit der Krona. Und auch Ecuador, die Ukraine, Kambodscha und El Salvador wollen eine eigene Digitalwährung erproben. Vor allem aber die Volksrepublik China ist bei dieser Entwicklung ganz vorne mit dabei.[3] Die dortige Zentralbank arbeitet bereits seit fünf Jahren an einer eigenen Digitalwährung. In zahlreichen Metropolen des Landes ist der digitale Yuan bereits im Umlauf, unter anderem in Shanghai, Shenzhen und Qingdao.[4]
Ein weiteres Pilotprojekt mit dem digitalen Yuan wurde im Dezember 2020 in Suzhou durchgeführt, einer Zehn-Millionen-Stadt im Osten Chinas. Von den Behörden wurde der Test als Hongbao vermarktet, als Roter Umschlag, wie in China Geschenkaktionen vor allem rund um die Feiertage genannt werden. Die Gewinner erhielten 200 Yuan, umgerechnet etwa 25 Euro, die diese innerhalb von zwei Wochen ausgeben konnten. Dafür mussten sie eine App der Zentralbank herunterladen, in der, wie auf Banknoten auch, der einstige Staatsführer Mao Zedong vor rotem Hintergrund und dem Nationalemblem abgebildet ist. Um zu bezahlen, müssen die Nutzer mit dem Smartphone nur den QR-Code des Händlers scannen oder dieser den der Nutzer. Ähnliches sind sie im technologieaffinen China bereits von anderen digitalen Zahlungsdiensten gewohnt, mit denen viele Chinesinnen und Chinesen schon heute Taxifahrer bezahlen, Stromgebühren überweisen oder Rechnungen gemeinsam mit Freunden begleichen. Bargeld spielt in großen Teilen Chinas heute kaum noch eine Rolle.[5]
Bislang allerdings wirkt der digitale Yuan noch nicht ausgereift genug, um eine rundum attraktive Alternative im Alltag zu bieten. Dienste wie Alipay und WeChat Pay sind da bereits viel weiter, bieten etliche und teils nutzerfreundlichere Funktionen, als es Menschen in Europa von ihren Finanzdienstleistern gewohnt sind. Womöglich wird die chinesische Zentralbank die Rolle des App-Entwicklers auch gar nicht für immer einnehmen wollen, sondern anstelle dessen auf Privatunternehmen als Partner setzen.
Auch wenn die aktuelle App des Pilotprogramms über die Zentralbank läuft, deuten Patente von Banken und Technologieunternehmen bereits darauf hin, dass auch Privatfirmen zunehmend in das System eingebunden werden. Das dürfte der nationalen Digitalwährung einen weiteren Schub verleihen. Fest steht: Bis der digitale Yuan vollends ausgerollt wird, dürfte er noch einige Veränderungen erfahren.[6] Doch wie genau er in Zukunft aussehen wird, darüber weiß man bislang wenig, bekannt ist bisher nur das Design der aktuellen Pilotprojekte. China hat kein Whitepaper veröffentlicht, so dass Beobachter mühsam über beantragte Patente ableiten müssen, wie der digitale Yuan am Ende gestaltet sein könnte. Was sich bislang abzeichnet, ist eine digitale Zentralbankwährung unter strikter staatlicher Kontrolle, die den Bürgern wenig Privatsphäre lassen dürfte. Um kriminelle Aktivitäten verfolgen zu können, möchte sich der Staat etwa vorbehalten können, über Banken Zugriff auf Nutzerdaten zu bekommen. Vieles weitere, etwa wie groß die Summen sind, über die die Bürgerinnen und Bürger eines Tages verfügen können, lässt die Zentralbank noch im Unklaren.
Umrisse einer europäischen Digitalwährung
Wie im Vergleich dazu der digitale Euro funktionieren wird, ist ebenfalls noch offen. Bekannt ist aber schon jetzt, dass dieser ebenfalls als sogenannte Central Bank Digital Currency (CBDC) von der Zentralbank rein digital ausgegeben wird – parallel zum bestehenden Zahlungsmittel und deshalb in der Regel auch mit dem gleichen Wert.
Über die Menge der in Umlauf gebrachten digitalen Währung entscheidet demnach allein die Zentralbank – ganz anders also als beim „traditionellen“ Geld, mit dem bislang Onlinekäufe, Kartenzahlungen und Überweisungen getätigt werden. Dieses sogenannte Giralgeld geben private Geschäftsbanken an ihre Kunden aus, ohne sich dafür von der Zentralbank in gleicher Menge Geld beschaffen zu müssen. Man könnte auch sagen: Sie kreieren Geld per Knopfdruck. Nur einen Teil der gehandelten Summe müssen sie gegenüber der Zentralbank als Kapital vorhalten.
Ob die Zentralbanken die geplante Digitalwährung zukünftig über eine eigene App herausgeben, sie die Geschäftsbanken als Schnittstelle zum Endkunden einspannen oder ob sie das Ganze am Ende wie eine Kryptowährung über die Blockchain abwickeln – all das ist ihrem Gestaltungsspielraum überlassen.[7]
Allerdings zeichnet sich schon jetzt ab, dass mit einer Zentralbank-App wohl eher nicht zu rechnen ist.[8] So wird in einem Bericht der High-Level Task Force on Central Bank Digital Currency der EZB die „Zusammenarbeit mit Marktteilnehmern“ als eine Grundvoraussetzung für die Einführung eines Digital Euro bezeichnet: „Während das Eurosystem immer Kontrolle über die Ausgabe des digitalen Euros behalten wird, wären beaufsichtigte Intermediäre am besten geeignet, zusätzliche nutzerorientierte Dienste anzubieten und neue Geschäftsmodelle aufzusetzen […]. Ein Modell, bei dem der Zugang zum digitalen Euro über den privaten Sektor vermittelt wird, ist daher vorzuziehen“, heißt es dort.[9] Offenbar sollen also Geschäftsbanken in das System eingebunden und die Geldmengen für jeden Nutzer gedeckelt werden, um Verwerfungen auf den Finanzmärkten zu vermeiden.
Auf den ersten Blick wirkt es nicht so, als könnte der digitale Euro eine große Disruption auf den Finanzmärkten auslösen. Man wird weiterhin bar und wie gewohnt online mit dem gewöhnlichen Euro bezahlen können – hätte aber von nun an einen weitere Zahlungsoption. Alternativ zu PayPal, Kontokarten und Bargeld könnte der Geldtransfer im Online-Shop oder an der Supermarktkasse dann mit digitalen Euros abgewickelt werden, beispielsweise über die Finanzapp der Geschäftsbank, vielleicht aber auch über Kontokarten. In der Finanzapp könnte dann beispielsweise neben dem Girokonto, dem für die Kreditkarte und anderen Konten ein weiteres erscheinen, das digitale Euros beinhaltet. Laut EZB bestätigt eine solche Vorgehensweise auch die Ergebnisse einer Konsultation von Bürgern, Behörden, Unternehmen und Organisationen der Zivilgesellschaft. Diese bekamen die Möglichkeit, in einem Fragenkatalog Stellung zum digitalen Euro zu beziehen; die Ergebnisse stellte die EZB im März vor. Nicht nur Unternehmen, sondern auch „eine große Mehrheit“ von 73 Prozent der antwortenden Bürger sahen darin Platz für Intermediäre.[10]
Datenschutz und Privatsphäre?
Besonders auffällig ist der Wunsch der Befragten nach Privatsphäre und Datenschutz. 43 Prozent nannten dies als wichtigste Anforderung an den digitalen Euro, noch weit vor Sicherheit, die nur 18 Prozent als wichtigste Eigenschaft ansahen.[11] Das ist vor allem deshalb nachvollziehbar, weil mit Bargeld bezahlt werden kann, ohne dabei die Identität preiszugeben – etwa beim Kauf von Medikamenten in der Apotheke, bei intimen Produkten im Erotikshop oder beim Zahlen von Trinkgeld und der Nachbarschaftshilfe. Lange galt das Argument, dass es jedem freistünde, Online-Zahlungen oder Überweisungen zu tätigen, bei denen Transaktionsdaten gespeichert werden.
Mit der zunehmenden Ausbreitung digitaler Dienste schwindet diese Wahlfreiheit allerdings. Der digitale Euro sollte daher das Vehikel sein, das Bargeld mit seinen positiven Eigenschaften einer „anonymen“ Währung in das digitale Zeitalter zu überführen. Datenschützer wie die des Vereins Digitalcourage halten das gar für eine zentrale Bedingung.[12] Denn gerade in Zeiten des Überwachungskapitalismus, wie die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff die Allgegenwart der datengetriebenen Technologiefirmen nennt, müsse es für Bürgerinnen und Bürger alternative Zahlungsdienste geben, bei denen der Staat als Garant der Privatsphäre auftritt.[13]
Doch schon jetzt ist absehbar, dass über diesen Punkt noch heftig gestritten werden wird. Denn die EZB machte bereits klar, dass das Prinzip der Anonymität, „nicht nur wegen rechtlicher Verpflichtungen in Bezug zu Geldwäsche und Terrorfinanzierung, sondern auch, um die Anzahl der Nutzer der digitalen Euros einzuschränken“, wohl verworfen werden müsse. Die Zentralbank verweist in diesem Zusammenhang auf die Regulierung der herkömmlichen digitalen Zahlungsdienste, bei denen beispielsweise „Know Your Customer“-Regeln gelten. Und so deutet sie schon heute die Suche nach einem Kompromiss an: „Der Ansatz zur Privatsphäre könnte selektiv sein, das heißt, der Systembetreiber könnte nur bei bestimmten Arten von Transaktionen erlauben, dass sie ohne die Registrierung des Zahlenden und des Empfängers durchgeführt werden.“ Bei größeren Summen wäre dann eine Identifizierung verpflichtend, so die EZB.[14]
Die Zukunft der Geldpolitik
Darüber hinaus zeichnet sich noch ein weiterer Streitpunkt ab. Denn derzeit gewinnt die altmodisch anmutende Praxis, Geldscheine daheim sprichwörtlich unter der Matratze aufzubewahren, angesichts der von immer mehr Banken verhängten negativen Zinsen wieder größere Bedeutung. Wenn auf dem Konto der Wert sinkt und Kapitalmarktanlagen zu riskant erscheinen, sehen manche im Horten von Bargeld die letzte Option. Die Möglichkeit, digitales Geld ohne Angst vor Wertverlust anzusammeln – für viele Bürger wäre dies vermutlich ein attraktives Angebot. Dagegen läuft allerdings der Dachverband der Finanzwirtschaft Sturm, der sein Geschäftsmodell bedroht sieht: Die Einführung eines digitalen Euro dürfe „nicht die Gefahr von Bank-Runs im Krisenfall erhöhen. Sonst könnte die Einführung zu deutlich höheren Gefahren für die Finanzstabilität führen mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaft insgesamt“, schreibt die Deutsche Kreditwirtschaft.[15] Als Schnittstellen zum Kunden ließen sich die Privatbanken gerne einbinden – aber nur, wenn die Menge digitaler Euros gedeckelt sei, die Bürger ansparen dürfen. Die EZB hat in ihrem Diskussionspapier hierzu noch keine Details definiert. Allerdings nennt sie bereits als eine der Anforderungen an den digitalen Euro die „Möglichkeit, die zirkulierende Geldmenge zu kontrollieren“. Die Digitalwährung müsse so gestaltet sein, dass sie nicht als Investment dienen und zur Umschichtung von Bankeinlagen führen könne.[16]
Zu diesem Zweck bringt die EZB negative Zinssätze ins Spiel. In einem Meinungsbeitrag stellte der Vorsitzende der Task-Force zum digitalen Euro, Fabio Panetta, klar, dass die EZB auch den digitalen Euro als Instrument der Geldpolitik versteht: „Die Ausgabe einer nullverzinsten digitalen Zentralbankwährung ohne eingeschränkten Zugriff und Menge würde das Ende der Negativzinspolitik bedeuten.“[17] Panetta schlägt daher eine Zweiteilung vor: Erst bei Einlagen über einer Höhe von beispielsweise 3000 Euro könnte der Zins ins Negative kippen und eine Art Strafgebühr für jeden weiteren digitalen Euro fällig werden. Erspartes jenseits des gesetzten Limits würde an Wert verlieren. Der digitale Euro wäre damit unattraktiv für Sparer, die große Summen nicht auf Girokonten bei Privatbanken parken oder in deren Anlageprodukte investieren möchten. Das dürfte zwar den Dachverband der Finanzwirtschaft beruhigen, allerdings gerät die EZB damit in Konflikt mit den Geschäftsbanken. Deren Verband lehnt einen digitalen Euro ab, der als Vehikel diene, „um den Handlungsrahmen der Geldpolitik entscheidend auszuweiten. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn eine über die Lagerhaltungskosten des Bargelds hinausgehende negative Verzinsung des digitalen Euro ermöglicht würde.“ Sie plädieren stattdessen dafür, die überschüssigen Summen des digitalen Euro einfach automatisch auf die klassischen Kundenkonten zu übertragen.[18]
Bei einem möglichen Deckel von 3000 Euro hieße das: Wenn ein Nutzer 2500 Euro auf seinem Account mit digitalen Euros besitzt und 1000 digitale Euros überwiesen bekommt, könnten nur 500 digitale Euros eingezahlt werden – die restlichen 500 digitale Euros gingen als ganz gewöhnliche Euros auf das normale Girokonto des Nutzers. Hier beginnen die kniffligen Details der Ausgestaltung. Denn damit klar ist, wie hoch überhaupt der Kontostand eines Nutzers mit digitalen Euros ist, müssten die Zahlungsgeräte von Käufer und Verkäufer übers Internet miteinander kommunizieren. Das jedoch macht es schwierig, eine weitere Eigenschaft des Bargelds in die digitale Welt zu überführen: die Möglichkeit, jederzeit und überall damit zu bezahlen, beispielsweise im Alltag, wenn es mal kein Netz gibt.
Die EZB nennt auch Extremsituationen wie Cyberangriffe, Naturkatastrophen und Pandemien, in denen sich die Digitalwährung bewähren müsse. Mit anderen Worten: Sie muss offline-fähig sein – eine Eigenschaft, über die etwa Smart Cards oder Finanzapps grundsätzlich verfügen, da sie per NFC-Technologie auch ohne Internetverbindung mit anderen Geräten in unmittelbarer Nähe kommunizieren können.[19]
Die EZB vor einer kategorischen Entscheidung
Die EZB steht somit vor einer kategorischen Entscheidung: Möchte sie flexibel ab einem bestimmten Limit Einzahlungen digitaler Euros durch Negativzinsen bremsen? Dann müsste sie Endgeräte, mit denen Geldzahlungen getätigt werden, bestenfalls übers Internet miteinander kommunizieren lassen. Oder entschließt sich die EZB für eine statische Offline-Version des digitalen Euro? Dann kann sie diesen nicht als Mittel ihrer Geldpolitik nutzen, um etwa mit Negativzinsen Bürger zum Geldausgeben zu animieren.
Fest steht: Die perfekte Lösung für alle wird es nicht geben. Aus freiheitsrechtlicher Sicht wäre die Offline-Variante des digitalen Euro die bessere Wahl. Nutzer könnten sich dann darauf einstellen, dass der digitale Euro über die Eigenschaften des Bargelds verfügt – aber eben nicht viel mehr als das: „Ein digitaler Euro, der nur in offline nutzbar ist, würde wahrscheinlich keine fortschrittlichen Funktionalitäten haben“, schreibt die EZB.[20] Das letzte Wort ist aber auch hier noch nicht gesprochen. Möglicherweise wird es Kompromisse geben, beispielsweise eine Art Prepaid-System, für das Nutzer nicht ständig online sein müssen. Auch die Frage nach der Technologie für die Infrastruktur des digitalen Euro ist noch zu klären. Vieles deutet auf ein Account-basiertes System hin, eines mit klassischen Nutzerkonten wie das der Geschäftsbanken – nur, dass am Ende alles auch zentral über die EZB verrechnet wird. Hin und wieder taucht auch der Begriff Distributed Ledger Technologies in dem EZB-Bericht auf, das Stichwort Blockchain ein anderes Mal. Beide Begriffe verweisen auf ein dezentrales System, bei dem Bürger ohne Umweg über Geschäftsbanken und die EZB direkt Geld transferieren können, ähnlich wie es auch Kryptowährungen wie der Bitcoin oder der Diem machen. Eine solche Umsetzung gilt jedoch als unwahrscheinlich.
Noch in diesem Sommer dürfte der EZB-Rat darüber entscheiden, ob ein digitaler Euro getestet und am Ende auch eingeführt wird. Auch er wird nicht alle Details der neuen Digitalwährung definieren, sondern nur eine „formale Untersuchung mit Blick auf eine mögliche Einführung eines digitalen Euros“ in die Wege leiten; zwei Jahre könnte dies etwa dauern.[21] Und auch dann wird nicht von heute auf morgen eine digitale Zentralbankwährung flächendeckend umgesetzt. Das Beispiel China zeigt, dass es dafür erst Pilotprogramme und weitere Auswertungen braucht.[22]
Umso wichtiger wird die Debatte über den digitalen Euro in den kommenden Jahren sein – vor allem, um dafür zu sorgen, dass die Digitalwährung nicht primär Kapitalinteressen dient, sondern jenen der Bürgerinnen und Bürger. Nur so wird der Digital Euro am Ende auch breite Akzeptanz in der europäischen Bevölkerung finden – und zugleich sichergestellt, dass die privaten Daten aller beim täglichen Einkauf möglichst sicher sind.
Die EZB hat die historische Chance, das Bargeld mit seinen schützenswerten Eigenschaften ins digitale Zeitalter zu überführen. Denn auch wenn es EZB-Präsidentin Lagarde anders kommuniziert: Das physische Bargeld, wie wir es kennen, könnte schon bald der Vergangenheit angehören – schlicht, weil es im Alltag perspektivisch an Relevanz verlieren wird. Für dieses Szenario braucht es eine überwachunsgsfreie Alternative: den digitalen Euro als eine Art Bargeld 2.0.
[1] ECB Forum on Central Banking 2020 – Policy Panel, European Central Bank, www.youtube.com, 13.11.2020
[2] Vgl. dazu Daniel Leisegang, Facebook: Mit Libra mal kurz die Welt retten?, in: „Blätter“, 8/2019, S. 21-24.
[3] Raphael Auer, Giulio Cornelli und Jon Frost, Rise of central bank digital currencies: drivers, approaches and technologies, in: „BIS Working Papers“, Bank for International Settlements, August 2020.
[4] Frank Tang, China digital currency: Shanghai, Hainan among regions added to e-yuan trials, in: „South China Morning Post“, www.scmp.com, 13.4.2021.
[5] Jonas Gerding und Jiawen Le, Der Kampf um den Euro wird digital, in: „t3n“, Februar 2021, S. 70 ff.
[6] Vgl. Sarah Allen et al., Design Choices for Central Bank Digital Currency: Political and Technical Considerations, Global Economy & Development Working Paper 140, Brookings Institution, Juli 2020, S. 84.
[7] Vgl. Allen et al., a.a.O.
[8] Vgl. Report on a digital Euro, European Central Bank, Oktober 2020, S. 4. Diesen Vorstoß begrüßt auch die Deutsche Kreditwirtschaft, der Bundesverband der Privatbanken. Vgl. Die Deutsche Kreditwirtschaft, EZB-Konsultation zum digitalen Euro vom 12. Oktober 2020, 12.1.2021, S. 3.
[9] Vgl. Report on a digital Euro, European Central Bank, Oktober 2020.
[10] Eurosystem report on the public consultation on a digital Euro, April 2021, S. 19.
[11] Ebd., S. 10.
[12] Vgl. Gerding/Le, a.a.O., S. 70 ff.
[13] Vgl. Shoshana Zuboff, Der dressierte Mensch. Die Tyrannei des Überwachungskapitalismus, in: „Blätter“, 11/2018, S. 101-111 sowie dies., The Age of Surveillance Capitalism, New York 2019.
[14] Report on a digital Euro, European Central Bank, Oktober 2020, S. 27.
[15] Die Deutsche Kreditwirtschaft, EZB-Konsultation zum digitalen Euro, a.a.O., S. 2.
[16] Report on a digital Euro, European Central Bank, Oktober 2020, S. 18.
[17] Ulrich Bindseil und Fabio Panetta, Central bank digital currency renumaration in a world with low or negative nominal interest rates, www.voxeu.org, 5.10.2020.
[18] Die Deutsche Kreditwirtschaft, EZB-Konsultation zum digitalen Euro, a.a.O., S. 2.
[19] Report on a digital Euro, a.a.O., S. 14.
[20] Vgl. Report on a digital Euro, a.a.O., S. 31.
[21] Eurosystem report on the public consultation on a digital Euro, April 2021, S. 2
[22] Philipp Sandner, The Future of Payments in a DLT-based European Economy: A Roadmap, www.forbes.com, 15.12.2020.