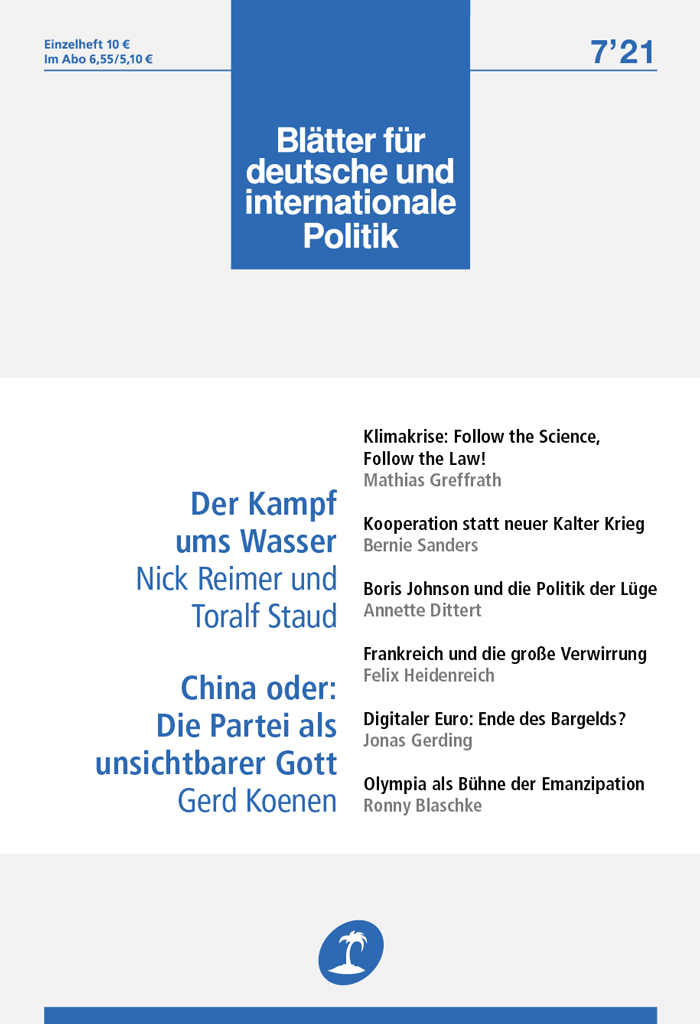Bild: US-Präsident Joe Biden während einer Pressekonferenz nach dem NATO-Gipfel in Brüssel 14.6.2021, (IMAGO / Le Pictorium)
Die USA stehen heute vor beispiellosen globalen Herausforderungen: Klimawandel, Pandemien, die Verbreitung von Atomwaffen, massive wirtschaftliche Ungleichheit, Terrorismus, Korruption, Autoritarismus. Aber all diese Herausforderungen teilen wir mit der Welt. Sie können nicht von einem einzelnen Land im Alleingang gelöst werden. Vielmehr machen sie eine verstärkte internationale Zusammenarbeit nötig – darunter mit China, dem bevölkerungsreichsten Land der Erde.
Es ist daher besorgniserregend und gefährlich, dass in Washington zunehmend ein Konsens entsteht, demzufolge die Beziehungen zwischen den USA und China ein ökonomisches und militärisches Nullsummenspiel sind. Setzt sich diese Ansicht durch, wird ein politisches Umfeld entstehen, in dem eben jene dringend benötigte Kooperation immer schwieriger zu erreichen ist.
Bemerkenswert ist, wie schnell sich die herkömmliche Auffassung zu dieser Frage geändert hat. Noch vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten, im September 2000, unterstützten es die amerikanischen Unternehmer und die Führungen beider großer Parteien vehement, China den Status „dauerhafter normaler Handelsbeziehungen“ (PNTR) zu verleihen. Damals bestanden die US-Handelskammer, die National Association of Manufacturers, die kommerziellen Medien und fast jeder establishmentnahe Außenpolitikexperte in Washington darauf, der PNTR-Status sei notwendig, um die US-Unternehmen durch den Zugang zu Chinas wachsendem Markt wettbewerbsfähig zu halten. Außerdem würde die Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft mit der Liberalisierung der chinesischen Politik im Hinblick auf Demokratie und Menschenrechte einhergehen.
Diese Position galt als offensichtlich und zwingend korrekt. Den PNTR-Status zu verleihen, argumentierte der Ökonom Nicholas Lardy von der zentristischen Brookings Institution im Frühjahr 2000, wäre „eine wichtige Unterstützung für Chinas Führung, die erhebliche wirtschaftliche und politische Risiken eingeht, um die Forderungen der internationalen Gemeinschaft nach substanziellen zusätzlichen Wirtschaftsreformen zu erfüllen.“[1] Den Status zu verweigern hingegen „hieße, dass US-Unternehmen nicht von den wichtigsten Verpflichtungen profitieren würden, die China eingegangen ist, um ein Mitglied der Welthandelsorganisation zu werden“. Etwa zur selben Zeit drückte es der Politikwissenschaftler Norman Ornstein vom konservativen American Enterprise Institute unverblümter aus: „Der amerikanische Handel mit China ist eine gute Sache für Amerika und für die Entfaltung der Freiheit in China“, behauptete er. „Das scheint offensichtlich oder sollte es sein.“[2]
Nun, ich hielt es nicht für offensichtlich, weshalb ich die Opposition gegen dieses desaströse Handelsabkommen mit organisierte. Wie auch vielen arbeitenden Menschen war mir schon damals klar: Erlaubt man es US-Unternehmen, die Produktion nach China zu verlagern und dort Arbeiter zu Hungerlöhnen anzuheuern, würde dies einen Unterbietungswettbewerb in Gang setzen, der zum Verlust gut bezahlter, gewerkschaftlich geschützter Arbeitsplätze in den USA und zu niedrigeren Löhnen für amerikanische Arbeiter führen würde. Und genauso kam es auch. In den folgenden zwei Jahrzehnten gingen in Amerika etwa zwei Millionen Jobs verloren, über 40 000 Fabriken schlossen und die Arbeiter litten unter stagnierenden Löhnen – während die Unternehmen Milliarden verdienten und die Führungskräfte reich belohnt wurden. Donald Trump gewann die Präsidentschaftswahl 2016 teilweise, indem er seine Kampagne gegen die US-Handelspolitik richtete und sich mit seinem verlogenen und spalterischen Populismus die wirtschaftlichen Nöte vieler Wähler zu Nutze machte.
Währenddessen haben sich Freiheit, Demokratie und Menschenrechte in China natürlich nicht entfaltet. Vielmehr wurden sie massiv eingeschränkt, da China sich in eine autoritärere Richtung bewegt hat und auch auf der Weltbühne zunehmend aggressiv auftritt. Nun ist das Pendel der herkömmlichen Auffassung in Washington umgeschwungen: vom übergroßen Optimismus über die Möglichkeiten des uneingeschränktes Handels mit China zu einer viel zu harten Haltung gegenüber der Bedrohung durch das reichere, stärkere und autoritärere China, das aus diesem verstärkten Handel hervorging.
Im Februar 2020 schrieb der Brookings-Analytiker Bruce Jones, dass „Chinas Aufstieg – in die Position der zweitgrößten Ökonomie der Welt, des größten Energieverbrauchers und des Landes mit dem zweitgrößten Verteidigungsbudget – die globalen Angelegenheiten durcheinandergebracht hat.“ Daher sei die „Auseinandersetzung mit den neuen Realitäten der Großmachtrivalität die Herausforderung für amerikanische Staatskunst in der kommenden Zeit.“[3] Vor wenigen Monaten verglich mein konservativer Kollege, der republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas, die Bedrohung durch China mit jener durch die Sowjetunion während des Kalten Krieges: „Erneut steht Amerika einem mächtigen totalitären Widersacher gegenüber, der nach der Kontrolle über Eurasien strebt und die Weltordnung umgestalten will“, argumentierte er. Und so wie Washington nach dem Zweiten Weltkrieg die nationale Sicherheitsarchitektur der USA umorganisierte, um sich auf den Konflikt mit Moskau vorzubereiten, schrieb Cotton, „müssen heute Amerikas langfristige wirtschaftliche, industrielle und technologische Anstrengungen auf den neusten Stand gebracht werden, um der wachsenden Bedrohung durch das kommunistische China gerecht zu werden.“ Und erst vergangenen Monat sagte Kurt M. Campbell, der Koordinator für den Indopazifik im Nationalen Sicherheitsrat der USA, dass „die Phase, die man als eine der Bindung [an China] beschreiben könnte, zu einem Ende gekommen ist“ und künftig „das vorherrschende Paradigma Wettbewerb sein wird“.[4]
Unablässige Panikmache
Vor zwanzig Jahren lag das wirtschaftliche und politische Establishment der USA mit Blick auf China falsch. Heute hat sich der Konsens verändert, aber er ist erneut falsch. Statt wie zuvor die Vorzüge von freiem Handel und Offenheit gegenüber China zu rühmen, trommelt das Establishment nun zu einem neuen Kalten Krieg und präsentiert China als existenzielle Bedrohung für die Vereinigten Staaten. Schon nutzen dies Politiker und Vertreter des militärisch-industriellen Komplexes als neusten Vorwand für immer größere Verteidigungsbudgets.
Es ist wichtig, diesen neuen Konsens in Frage zu stellen – so wie es das schon beim alten war. Die chinesische Regierung hat sich gewiss vieler politischer Maßnahmen und Praktiken schuldig gemacht, die ich ablehne und die alle Amerikaner ablehnen sollten: der Diebstahl von Technologien, die Unterdrückung von Arbeitnehmerrechten und der Presse, die Repression in Tibet und Hongkong, das bedrohliche Verhalten gegenüber Taiwan und das grauenhafte Vorgehen gegenüber den Uiguren.
Die USA sollten auch über Chinas aggressive globale Ambitionen besorgt sein. Diese Fragen sollte Washington nachdrücklich in bilateralen Gesprächen mit der chinesischen Regierung und in multilateralen Institutionen wie dem UN-Menschenrechtsrat ansprechen. Dieser Ansatz wäre glaubwürdiger und effektiver, wenn die Vereinigten Staaten auch gegenüber ihren Verbündeten und Partnern eine konsistente Position zu den Menschenrechten vertreten würden.
Wenn wir unsere Außenpolitik jedoch als Nullsummenspiel einer globalen Konfrontation mit China betreiben, wird dies nicht zu einem besseren Verhalten Chinas führen. Vielmehr wäre es politisch gefährlich und strategisch kontraproduktiv. Der plötzliche Drang zu einer Konfrontation mit China hat einen sehr aktuellen Vorläufer: den globalen „Krieg gegen den Terror“. Im Gefolge der Attacken vom 11. September 2001 kam das politische Establishment der USA schnell zu dem Schluss, dass der Antiterrorismus zum Hauptaugenmerk der US-Außenpolitik werden müsse. Fast zwei Jahrzehnte und sechs Billionen US-Dollar später zeigt sich deutlich, dass die nationale Einheit ausgenutzt wurde, um eine Reihe endloser Kriege zu beginnen. Diese erwiesen sich als enorm kostspielig in menschlicher, ökonomischer und strategischer Hinsicht und ließen in der US-Politik Fremdenfeindlichkeit und Fanatismus anwachsen – deren Hauptleidtragende die amerikanischen Muslime und die arabischen Communities waren. Es kann daher nicht verwundern, dass das Land heute – in einem Klima unablässiger Panikmache vor China – eine Zunahme an anti-asiatischen Hassverbrechen erfährt. Derzeit sind die Vereinigten Staaten gespaltener als je zuvor in ihrer jüngsten Geschichte. Aber die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahrzehnte sollten uns gelehrt haben, dass die Amerikaner der Versuchung widerstehen müssen, die nationale Einheit mit Feindseligkeit und Angst zu schmieden.
Demokratie revitalisieren, Armut bekämpfen
Die Regierung von Präsident Joe Biden hat den Aufstieg des Autoritarismus zu Recht als erhebliche Bedrohung der Demokratie identifiziert. Doch der primäre Konflikt zwischen Demokratie und Autoritarismus wird nicht zwischen Ländern ausgetragen, sondern in ihrem Inneren – auch in den USA. Und wenn sich die Demokratie dabei durchsetzt, dann wird sie das nicht auf einem traditionellen Schlachtfeld tun, sondern indem sie zeigt, dass sie den Menschen tatsächlich bessere Lebensumstände bieten kann als der Autoritarismus. Deswegen müssen wir die amerikanische Demokratie revitalisieren und das Vertrauen der Menschen in die Regierung wiederherstellen, indem wir uns den lange vernachlässigten Bedürfnissen arbeitender Familien zuwenden. Wir müssen Millionen gut bezahlter Jobs schaffen, dabei unsere zerfallende Infrastruktur wieder aufbauen und den Klimawandel bekämpfen. Wir müssen die Krisen angehen, denen wir uns in der Gesundheitsversorgung, dem Wohnen, der Bildung, dem Strafrecht, der Einwanderung und auf so vielen anderen Gebieten gegenüber sehen. Wir müssen dies nicht nur tun, weil es uns China oder anderen Ländern gegenüber wettbewerbsfähiger machen wird, sondern weil es den Bedürfnissen der Amerikaner besser gerecht wird.
Ein gerechteres globales System
Obschon die Hauptsorge der US-Regierung der Sicherheit und dem Wohlstand der Amerikaner gilt, sollten wir auch anerkennen, dass unsere Sicherheit und unser Wohlstand in unser hochgradig vernetzten Welt mit Menschen überall verbunden sind. Daher liegt es in unserem Interesse, mit anderen wohlhabenden Ländern daran zu arbeiten, den Lebensstandard weltweit anzuheben und die groteske wirtschaftliche Ungleichheit zu verringern, die überall von autoritären Kräften ausgebeutet wird, um politische Macht zu erlangen und die Demokratie zu untergraben.
Die Biden-Regierung hat eine globale Mindeststeuer für Unternehmen vorgeschlagen. Das ist ein guter Schritt, um den Unterbietungswettbewerb zu beenden. Aber wir müssen noch größer denken: Ein globaler Mindestlohn würde weltweit die Rechte der Arbeiter stärken, Millionen Menschen die Chance auf ein anständiges, würdiges Leben eröffnen und es den multinationalen Konzernen erschweren, die Bedürftigsten dieser Welt auszubeuten. Um armen Ländern, die sich in die Weltwirtschaft integrieren, dabei zu helfen, ihre Lebensstandards anzuheben, sollten die Vereinigten Staaten und andere reiche Länder ihre Investitionen in nachhaltige Entwicklung erheblich erhöhen.
Damit die Amerikaner gedeihen können, müssen andere auf der Welt die USA als ihren Verbündeten sehen: Ihre Erfolge sind unsere Erfolge. Biden tut genau das Richtige, indem er der globalen Impfstoffallianz Covax vier Mrd. Dollar zur Verfügung stellt, 500 Mio. Impfstoffdosen mit der Welt teilt und die Aufhebung des Patentschutzes unterstützt, damit die armen Länder selbst Impfstoffe produzieren können. China verdient Anerkennung für die Schritte, die es bei der Bereitstellung von Impfstoffen unternommen hat, aber die USA können mehr tun. Wenn Menschen irgendwo auf der Welt die amerikanische Flagge sehen, sollte sie an Paketen mit lebensrettender Hilfe befestigt sein und nicht an Drohnen und Bomben.
Um wahre Sicherheit und wahren Wohlstand für die arbeitenden Menschen in den Vereinigten Staaten wie in China zu schaffen, bedarf es eines gerechteren globalen Systems, das menschliche Bedürfnisse über die Gier der Konzerne und den Militarismus stellt. Die USA werden diese Ziele nicht erreichen, indem sie weitere Milliarden an Steuergeldern an die Unternehmen und das Pentagon aushändigen, während gleichzeitig der Fanatismus entfacht wird.
Die Amerikaner dürfen nicht naiv sein, wenn es um Chinas Repression, seine Missachtung der Menschenrechte und seine globalen Ambitionen geht. Ich glaube fest daran, dass die Amerikaner ein Interesse daran haben, globale Normen zu stärken, die die Rechte und Würde aller Menschen respektieren – in den USA, in China und weltweit. Ich fürchte jedoch, dass der wachsende überparteiliche Druck für eine Konfrontation mit China diese Ziele zurückwerfen wird und in beiden Ländern autoritäre, ultranationalistische Kräfte stärken könnte. Er wird auch die Aufmerksamkeit von den gemeinsamen Interessen beider Länder ablenken: dem Kampf gegen wirklich existenzielle Bedrohungen wie den Klimawandel, Pandemien und die Zerstörung, die ein Atomkrieg hinterlassen würde.
Es wird nicht leicht, mit China eine Beziehung zu beiderseitigem Nutzen zu entwickeln. Aber wir können Besseres erreichen als einen neuen Kalten Krieg.
Copyright: Council on Foreign Relations, Übersetzung: Steffen Vogel
[1] Nicholas R. Lardy, Permanent Normal Trade Relations for China, www.brookings.edu, 10.5.2000.
[2] Norman J. Ornstein, Killing PNTR in May Will Haunt Democrats Come November, www.aei.org, 17.4.2000.
[3] Bruce Jones, China and the return of great power strategic competition, www.brookings.edu, Februar 2020.
[4] Peter Martin, Biden’s Asia Czar Says Era of Engagement With China Is Over, www.bloomberg.com, 26.5.2021.