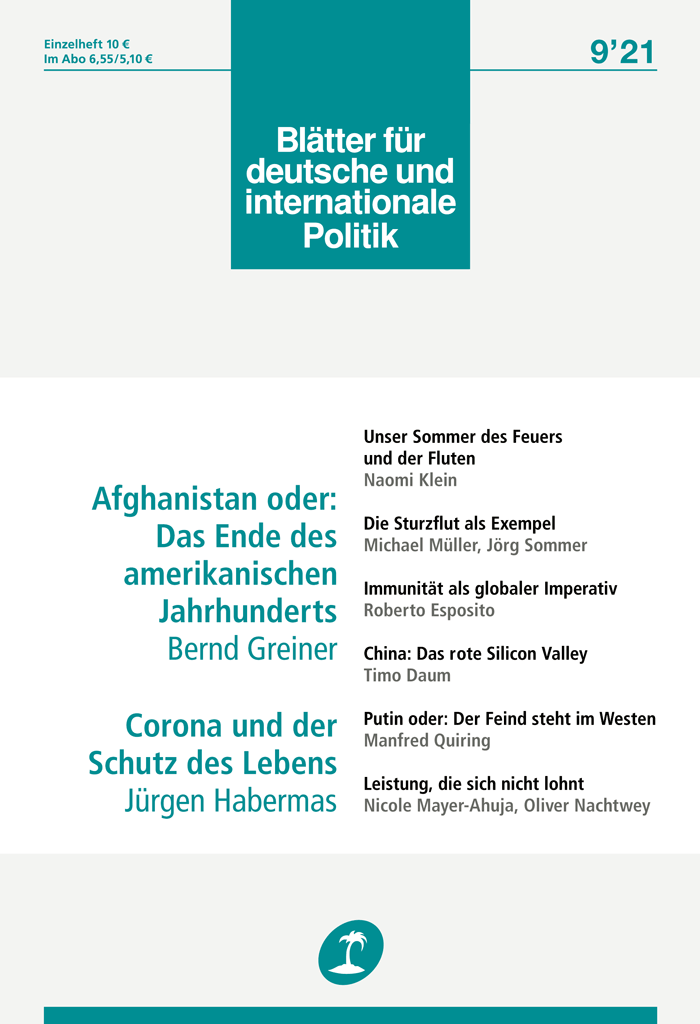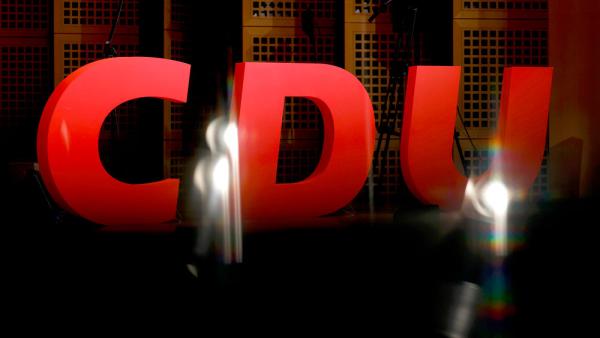Bild: Bundeskanzlerin Angela Merkel verlässt den Plenarsaal des Deutschen Bundestages, 25.8.2021 (IMAGO / Achille Abboud)
Dramatischer könnten die Vorzeichen kaum sein, unter denen am 26. September die Bundestagswahl stattfindet und zugleich die politische Ära Angela Merkels endet. Hatten die meisten Beobachter noch vor kurzem angenommen, die bald eineinhalb Jahre dauernde Coronakrise werde im Mittelpunkt des Wahlkampfs stehen, haben uns die vergangenen Wochen und Monate eines Schlechteren belehrt. Erst kam die dramatische Sturzflut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und dann auch noch der Siegeszug der Taliban und das historische Scheitern der Nato-Mission in Afghanistan. Damit sind alle großen Themen aufgerufen, die die Merkel-Ära im engeren Sinne – sprich: ihre Kanzlerschaft – geprägt haben, aber auch ihre Ära im weiteren Sinne, nämlich die zurückliegenden 30 Jahre seit dem Fall der Mauer und Merkels Eintritt in die Politik.
An erster Stelle steht dabei die Klimapolitik, die Merkel bereits in ihrer Zeit als Umweltministerin unter Helmut Kohl von 1994 bis 1998 zu verantworten hatte. Zweitens aber betrifft dies die Frage der internationalen Beziehungen, mit Nine Eleven als dem großen Einschnitt nach 1989. Damit einher geht schließlich drittens die Frage nach der Rolle Europas und Deutschlands in der neuen Unübersichtlichkeit einer multipolaren Welt.
Auf allen drei Feldern hat sich die Lage in den Merkel-Jahren erheblich verschlechtert. Besonders eklatant ist dies auf dem Feld der Umweltpolitik. Drei Jahre nach der historischen UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro von 1992 fungierte Merkel als Gastgeberin des ersten Rio-Folge-Gipfels in Berlin. „Es geht um die Erhaltung unserer einen Welt. Wir sitzen alle in einem Boot“, lautete damals ihre Botschaft. Die Industrieländer müssten als erste beweisen, „dass wir unserer Verantwortung zum Schutz des globalen Klimas nachkommen.“[1] Und zwei Jahre später schrieb Merkel in ihrem Buch „Der Preis des Überlebens“: „Wer behauptet, wirksamer Umweltschutz sei zum Nulltarif zu haben, gaukelt den Menschen etwas vor. International wird es nur möglich sein, andere Länder zum Handeln zu bewegen, wenn wir in den Industrieländern wirklich an unserem Lebensstil etwas ändern“.[2]
Ein Vierteljahrhundert später kann von grundlegender Veränderung unseres Lebensstils ebenso wenig die Rede sein wie von einem Vorangehen Deutschlands. Während ihrer Kanzlerschaft sei „nicht ausreichend viel passiert“, um den weltweiten Temperaturanstieg bis auf zwei Grad zu begrenzen, gestand Merkel unlängst ein. Keinesfalls zufällig geschah dies auf ihrer letzten Sommerpressekonferenz – schließlich muss sich die Kanzlerin nun keiner Wiederwahl mehr stellen.
Die Klimaentwicklung zeigt in besonderem Maße, dass die Politik dieser klugen Physikerin der Macht vor allem durch eines gekennzeichnet war: eine immense Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln. Damit aber steht die Kanzlerin nicht allein. Schließlich wussten wir alle oder konnten zumindest alle um die immer kritischer werdende Lage wissen. Merkel war somit der perfekte Ausdruck, ja das Sinnbild einer Epoche und einer Gesellschaft, die nach dem vermeintlichen glücklichen „Ende der Geschichte“ (Fukuyama) vor allem eines wollte – von der Politik in Ruhe gelassen werden. Verdrängung war das Leitmotiv der vergangenen 30 Jahre. „Nach uns die Sintflut“, lautete die zynische Devise. Als dann erste Südseeinseln Land-unter meldeten, wurde daraus „Neben uns die Sintflut“. Und erst in diesem Jahr scheint die Realität bei uns angekommen zu sein, erkennen wir endlich: „Bei uns die Sintflut.“
Hier besteht ein direkter Zusammenhang zur Coronakrise: Wie die jüngste Flutkatastrophe ist sie ein, wenn auch besonders dramatischer, Ausdruck der existenziellen Krise im Mensch-Natur-Verhältnis – einer Krise, die mehr und mehr den Charakter einer Katastrophe annimmt:[3] Denn während bei uns aus Rinnsalen reißende Wassermassen werden, verbrennen nur wenige hundert Kilometer weiter, in Griechenland, der Türkei und Südfrankreich, hunderte Hektar Wald. Mittlerweile müssen wir uns darauf einstellen, niemals wieder sorglose Sommer erleben zu können, sondern Jahr für Jahr mit neuen Katastrophen konfrontiert zu werden – und zwar ohne Aussicht auf baldige Besserung angesichts der bereits jetzt in der Atmosphäre befindlichen und zudem weiter steigenden CO2-Konzentration.
Auch in der Außenpolitik könnte mit dem fluchtartigen Abzug des Westens aus Kabul eine zwanzigjährige Verdrängung an ihr Ende gekommen sein. Wenn am 11. September, dem 20. Jahrestag der Anschläge auf das World Trade Center, die Fahne der Taliban über dem Regierungssitz in Kabul wehen wird, steht dies für das Scheitern des Westens und das Ende der US-dominierten Weltordnung.[4]
Dies ist in ein fundamentaler Einschnitt speziell für die Bundesrepublik. Jahrzehntelang waren die USA für uns, ungeachtet ihrer sonstigen Weltpolitik, tatsächlich der benevolente, wohlwollende Hegemon, erfolgte die deutsche Politik stets im sicheren Gefolge der Amerikaner. Nun aber lautet die neue Position der USA „Rette sich, wer kann“. „America first“ ist auch Joe Bidens Leitmotiv. Wiederaufbau und Nationbuilding finden nicht mehr im Ausland, sondern nur noch zuhause statt, schon um ein Comeback der Republikaner bei den Zwischenwahlen in einem Jahr zu verhindern.
Damit sind für Deutschland fundamentale Fragen aufgerufen: Bedeutet der Rückzug der Amerikaner die Preisgabe jeglicher demokratie- und menschenrechtsorientierter Politik? Und was muss die europäische Antwort auf diese Lage sein?
Auch hier war die direkte Reaktion der Kanzlerin beredt: Anstatt angesichts des Scheiterns in Afghanistan die Frage der deutschen Verantwortung grundsätzlich zu thematisieren, stellte sie umgehend auch den Bundeswehreinsatz in Mali infrage. Man fühlte sich an die Reaktion nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima erinnert: Auch hier agierte Merkel, wahltaktisch motiviert, allein reaktiv, sich den neuen Realitäten anpassend.
Diese Position kennzeichnet die gesamte Merkelsche Kanzlerinnenschaft: Vom Ende her zu denken, bedeutete bei Merkel eben nicht, den Ereignissen voraus zu sein und deshalb den Menschen möglicherweise auch etwas zuzumuten, ob in der Klima- oder Außenpolitik, sondern in erster Linie von den zukünftigen Wahlergebnissen her zu agieren, mit der Strategie der „asymmetrischen Demobilisierung“ und ihrem einschläfernden Leitmotiv: „Sie kennen mich“.
Das gilt auch für die vielleicht größte Baustelle der Merkelschen Ära, die Europa-Politik. Zu Beginn ihrer Amtszeit verschärfte sie durch ihre Austeritätspolitik die Griechenlandkrise und sorgte damit für deren Ausdehnung auf die gesamte Euro-Zone. So erst wurde aus einer Finanz- und Bankenkrise schließlich eine europäische Staatsschuldenkrise. Wie in der Klimapolitik wurden dabei die auch von deutschen Banken und Anlegern hervorgerufenen Risiken und Kosten externalisiert, nämlich in den Süden Europas. Und auch in ihrer letzten Legislatur versagte die Kanzlerin, indem sie Emmanuel Macron mit seinen visionären Plänen zur Revitalisierung der EU am langen Arm verhungern ließ.
Am Ende der Merkel-Ära ist somit ein dreifaches Scheitern zu bilanzieren: auf dem Feld der Klima-, der Welt- und der Europa-Politik. Umso mehr stellt sich die Frage, wie es der Kanzlerin gelingen konnte, den Nimbus der erfolgreichen Krisenmanagerin aufzubauen und die bis heute mit Abstand beliebteste Politikerin im Land zu sein.
In erster Linie ist dies dem unausgesprochenen Pakt der Bevölkerung mit einer Politikerin zuzuschreiben, die mit dem Einverständnis der Mehrheit den Status quo verwaltete, zu Lasten der Zukunft, aber ohne dass es – jedenfalls in der Gegenwart – wehtat.
Daneben liegen charakterliche Eigenschaften Merkels Erfolg zugrunde. Anders als Gerhard Schröder, ihrem Vorgänger und heutigen Handlungsreisenden Wladimir Putins, wird man Merkel keinerlei Eitelkeit oder die Instrumentalisierung des Amtes zu eigenen Zwecken nachsagen können.
Nicht zuletzt aber beruhte ihr Erfolg auf dem, was Nancy Fraser als „progressiven Neoliberalismus“ bezeichnet. Auf der einen Seite war die Kanzlerin ausgesprochen anpassungsbereit an einen kulturell progressiven, eher grün-liberalen gesellschaftlichen Trend. Symptomatisch dafür war die Art und Weise, wie sie das Thema der gleichgeschlechtlichen Ehe vor dem Wahlkampf 2017 regelrecht handstreichartig abräumte, sprich: zu geltendem Gesetz machte, nur um ihre Wiederwahl nicht zu gefährden. Ökonomisch betrachtet war Merkels Politik dagegen alles andere als progressiv, sondern stand für die neoliberale Entlastung der Starken und eine erhebliche Vertiefung des Gefälles zwischen Arm und Reich.[5]
Die Gefahr des Weiter-So
Was steht vor diesem Hintergrund am kommenden 26. September auf dem Spiel? Mit Armin Laschet kandidiert, mehr noch als Merkel, der Inbegriff eines progressiven Neoliberalismus: gesellschaftlich tolerant und offen, ökonomisch wirtschaftsliberal – qua Unions-Wahlprogramm mit Steuersenkungen bei gleichzeitigem Beharren auf der schwarzen Null – und zudem als Mann des Kohlelandes Nordrhein-Westfalen unvermindert fossilistisch. Dieses Programm eines unverminderten „Weiter so“ geht an den wahren Problemen des Landes radikal vorbei. Was heute Not tut, ist ein präventiver, vorbeugender Staat und eine weitsichtige, nicht bloß reaktive Außen- und Europapolitik.
Das Versagen in der Hochwasserkatastrophe ist dabei symptomatisch für einen nur nachsorgenden Staat, der damit immer mehr an seine Grenzen stößt. Einen Hochwasserentschädigungsfonds auch für künftige Katastrophen einzurichten, um auf diese Weise den Bürgerinnen und Bürgern den Wiederaufbau ihrer Eigenheime zu garantieren, gaukelt die Sicherheit eines Vollkaskostaates vor, ohne diese langfristig wirklich garantieren zu können. Denn an der grundsätzlichen Gefährdungslage ändert sich durch den Ersatz der Schäden rein gar nichts. Das haben die wiederkehrenden Überschwemmungen der zurückliegenden 20 Jahre gezeigt. Worauf es daher heute ankommt, ist ein völlig neues Staatsverständnis. Statt bloßer Schadensbehebung muss der Staat endlich wirksame Krisenvorsorge treffen. „Keine Experimente“, das alte Unions-Motto, kann daher gerade nicht die richtige Antwort auf die katastrophale Lage sein.
Das gilt nicht weniger mit Blick auf die Weltpolitik und die Rolle Europas. Schon fordern Vertreter der realistischen Schule angesichts der Bilder aus Kabul eine radikale Umkehr. „Das Projekt einer regelbasierten Weltordnung kann man abschreiben“, so ihr Vordenker Herfried Münkler.[6] „Der Traum von der Durchsetzung universeller Normen und Werte ist, zumindest auf globaler Ebene, ausgeträumt. Wer ihn jetzt noch weiterträumt, ist kein politischer Visionär, sondern ein Illusionist, der Vorstellungen lanciert, die andere ins Verderben stürzen.“[7]
Münkler hat zweifellos Recht, wenn er darauf hinweist, dass in den politischen Auseinandersetzungen einer „Weltordnung ohne Hüter“ nationale Interessen und ihr Ausgleich eine noch größere Rolle spielen werden als bereits bisher. Wenn er darüber hinaus jedoch die Abkehr von der bisherigen UN-orientierten deutschen Außenpolitik fordert, geht er einen entscheidenden, delegitimierenden Schritt zu weit. Denn damit spricht er diesen Institutionen de facto ihre Existenzberechtigung ab. Das Projekt einer regelbasierten Weltordnung – die Errungenschaft des 20. Jahrhunderts – leichthändig abzuschreiben und stattdessen China, wie Münkler es fordert, zum Maßstab einer neuen Realpolitik zu machen, weil es Politik gerade nicht mit einem Werteexport verbinde (was man ob des erfolgreichen Exports der Konfuzius-Institute durchaus bezweifeln kann), wäre gerade aus interessengeleiteter Sicht für den Westen verheerend.[8] Münklers Einteilung der Welt des 21. Jahrhunderts in fünf große Blöcke – dominiert von den USA, der Europäischen Union, China, Indien und Russland – enthält dagegen die Züge einer neuen globalen Großraumordnung, die nur noch durch eines gekennzeichnet ist, das „Interventionsverbot für raumfremde Mächte“ (Carl Schmitt).
Hier zeigt sich der schmale Grat zwischen illusionsloser Beschreibung der Realität und deren gefährlicher Legitimation, auf dem auch die vermeintlichen Realisten balancieren. Stattdessen wird es auf eine Doppelstrategie ankommen: Zum einen gilt es, neue interessengeleitete Allianzen und Formate zu fördern. Gerade in der Klimapolitik existieren hier durchaus Chancen, weil ein gemeinsames Interesse auch der Großmächte an der Bekämpfung der Erderwärmung besteht. Zum anderen aber kommt es, gerade ob des Scheiterns in Afghanistan, weiter darauf an, an den rechtlich geronnenen Errungenschaften der Vereinten Nationen festzuhalten. Schließlich haben sich fast alle Staaten darauf verpflichtet. Wer die UN-Ordnung dagegen aufgibt, negiert damit die letzten Instanzen und Kodifikationen derer, die nichts haben, worauf sie sich ansonsten berufen können – und verspielt damit auch westliche Interessen.
Fatal ist zudem in jedem Falle eines: Diese, für die Zukunft Deutschlands so eminent wichtigen Fragen kommen in einem medial hochgradig kandidatenfixierten Wahlkampf fast gar nicht zur Sprache. Ob von daher die kommende Regierung den wohl größten Herausforderungen in der Geschichte der Republik überhaupt gerecht werden kann, steht auf einem ganz anderen Blatt.
[1] Zit. nach Georg Ismar, So oft änderte Angela Merkel ihre Klimapolitik, www.tagesspiegel.de, 19.9.2019.
[2] Zit. nach Tobias Heimbach, www.businessinsider.de, 20.9.2019.
[3] Vgl. die Beiträge von Naomi Klein und Michael Müller mit Jörg Sommer in dieser Ausgabe.
[4] Vgl. den Beitrag von Bernd Greiner in dieser Ausgabe.
[5] Vgl. den Beitrag von Nicole Mayer-Ahuja und Oliver Nachtwey in dieser Ausgabe.
[6] Interview mit Herfried Münkler, in: „Handelsblatt“, 21.8.2021.
[7] Herfried Münkler, Die Afghanen wollten nicht sterben, damit die Amerikaner gut aussehen, in: „Die Welt“, 19.8.2021.
[8] So Herfried Münkler in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, 19.8.2021.