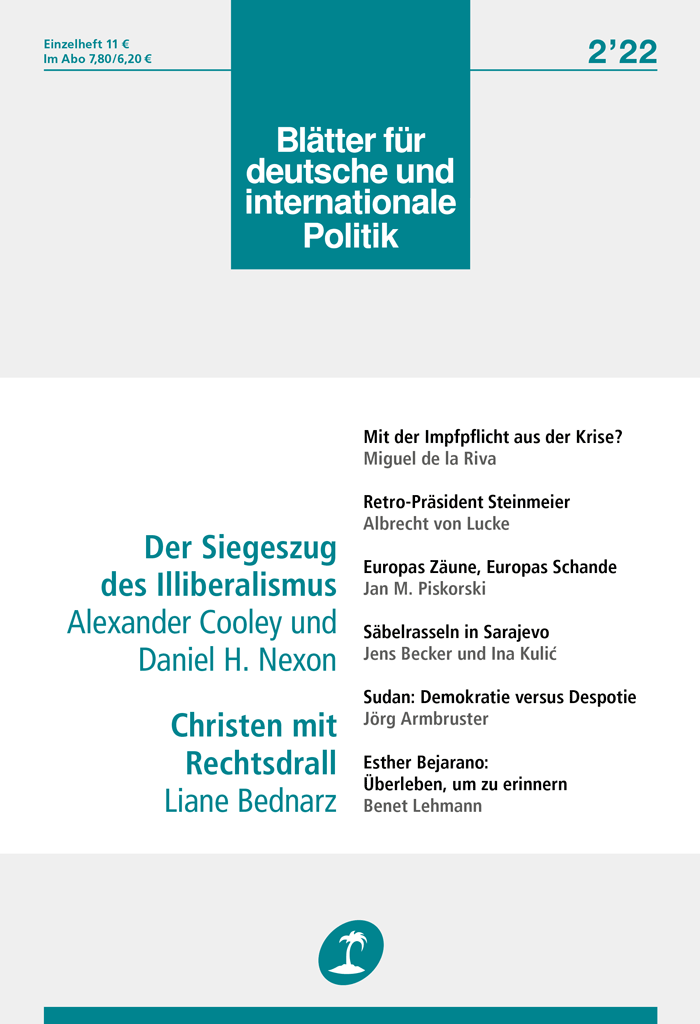30 Jahre Bosnienkrieg und die Wiederkehr des Ethnonationalismus

Bild: Festumzug anlässlich anlässlich des Jahrestages der Republika Srpska in Banja Luka (Bosnien-Herzegowina), 9. Januar 2021 (IMAGO / Pixsell)
Jahrelang schien es ruhig in Bosnien-Herzegowina. Dieser trügerische Eindruck bestärkte die internationale Öffentlichkeit und Politik in ihrem gepflegten Desinteresse am westlichen Balkan im Allgemeinen und dem internationalen Protektorat Bosnien-Herzegowina im Besonderen. Das hat sich im Dezember 2021 schlagartig geändert. Seither forciert Milorad Dodik die Aufspaltung des fragilen Staatsgebildes. Dodik ist der führende politische Repräsentant der Republika Srpska (RS), die neben der bosnisch-kroatischen Föderation eine der beiden Entitäten der bosnischen Gesamtföderation mit insgesamt drei Präsidenten, drei Regierungen, drei Parlamenten und einem ausgeklügelten ethnischen Proporzsystem bildet. Nun will er seine serbische Teilrepublik von Bosnien-Herzegowina loslösen und dazu alsbald RS-weit eigene Gerichte, Steuergesetze und Streitkräfte einrichten. Dodik kokettiert zudem mit einem Anschluss an Serbien. Käme es zur Abspaltung der RS, würde dies das Daytoner Friedensabkommen von 1995 torpedieren. Es sieht vor, die territoriale Integrität des Landes zu wahren und Grenzveränderungen entlang ethnischer Linien zu sanktionieren.[1]
Dreißig Jahre nach Beginn des Krieges um Bosnien-Herzegowina im April 1992, der rund 100 000 Menschen das Leben kostete und zwei Millionen in die Flucht trieb, dominieren damit erneut die gleichen alten ideologischen Grundmuster die Agenda: Ethnisierung und Chauvinismus.