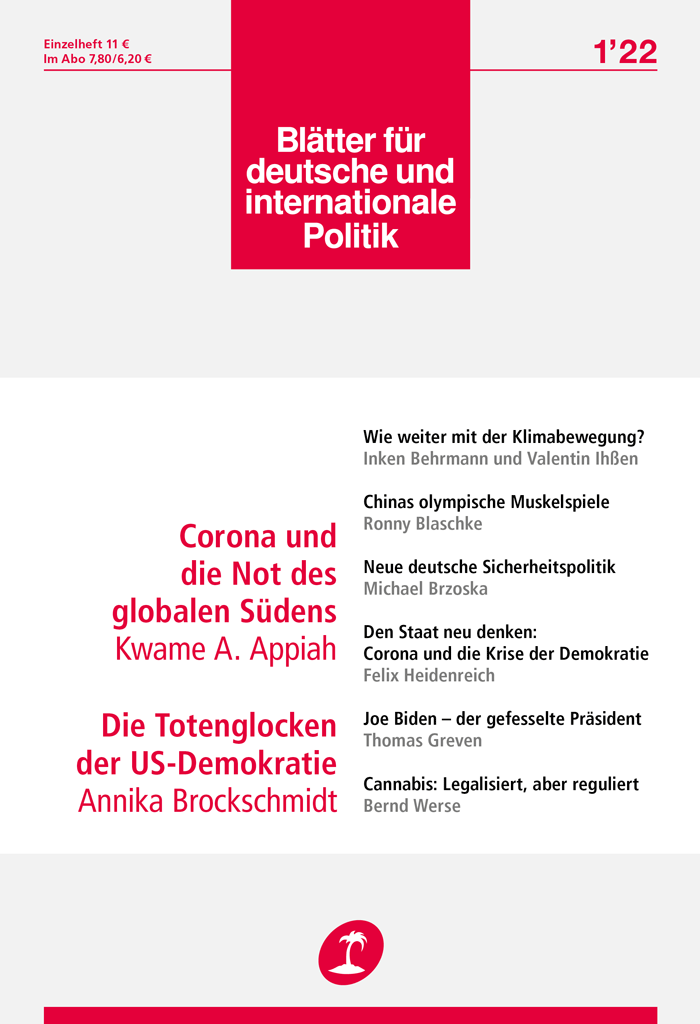Bild: Esteban Lopez / Unsplash
Nun haben wir es schwarz auf weiß: Laut ihrem Koalitionsvertrag will die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP eine „kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften“ legalisieren. Besonders überraschend kommt dieser Schritt nicht: Bündnis 90/Die Grünen haben die Forderung bereits seit langem auf der Agenda, seit 2015 steht sie ebenfalls im Parteiprogramm der FDP. Und auch in der SPD hatte sich zuletzt einiges getan: Immer mehr Parteivertreter sprachen sich für einen solchen Schritt aus; im vergangenen Jahr folgte dann ein Papier der Bundestagsfraktion mit der Überschrift „Cannabis – Neue Wege gehen!“, das lokale Modellprojekte für eine kontrollierte Abgabe forderte und den Besitz geringer Mengen zu einer Ordnungswidrigkeit herabstufen wollte. Letzteres fand sich dann auch im sozialdemokratischen Wahlprogramm zur Bundestagswahl wieder. Wie aber sollte eine Liberalisierung von Cannabisverkauf und -konsum hierzulande bestenfalls aussehen – in rechtlicher wie in praktischer Hinsicht? Und auf welche Erfahrungen anderer Länder könnte sich die Bundesregierung dabei stützen?
Mehr als vier Millionen Deutsche konsumieren Schätzungen zufolge gelegentlich oder regelmäßig Cannabis.[1] Sie begehen damit jedes Mal eine Straftat. Denn laut geltendem Betäubungsmittelgesetz steht der Besitz von Cannabis hierzulande grundsätzlich unter Strafe. Bei geringen Mengen kann zwar auf die Verfolgung verzichtet werden. Tatsächlich aber leiten die Ordnungsbehörden im Falle eines Cannabisfundes immer Strafverfahren ein. Diese werden freilich – je nachdem, an welche Staatsanwaltschaft die Betroffenen geraten – häufig eingestellt. Doch gerade bei „Wiederholungstaten“ fallen Strafen zumeist höher aus und können weitere Konsequenzen wie etwa Jobverlust, Führerscheinentzug sowie Probleme mit der Familie, den Nachbarn oder Arbeitgebern nach sich ziehen.
In manchen Ländern hat man – quasi als Zwischenschritt zur Legalisierung – die Entkriminalisierung des Besitzes geringer Cannabismengen eingeführt. Allen in diesen Ländern bestehenden Regelungen zur Entkriminalisierung ist gemein, dass Konsumierende nicht länger strafrechtlich verfolgt werden, Produktion, Import und Verkauf der Drogen aber weiterhin illegal bleiben.
Bei einer Herabstufung zu einer Ordnungswidrigkeit, wie von der SPD vorgeschlagen und selbst von der bisherigen Bundesdrogenbeauftragten Daniela Ludwig (CSU) vor einiger Zeit wohlwollend diskutiert,[2] fiele die Verpflichtung zur Verfolgung weg. Es würde also nicht automatisch eine Anzeige erstattet und ein Verfahren angestoßen. Allerdings wäre, wie bei jeder anderen Ordnungswidrigkeit wie beispielsweise Verstößen gegen das Tempolimit, dann noch immer ein Bußgeld fällig.
In dieser Form wird bereits seit geraumer Zeit in der Schweiz und in Tschechien der Cannabiskonsum gehandhabt; dort werden jedoch mitunter Geldbußen von umgerechnet bis zu mehreren hundert Euro fällig. Portugal hat mit der Entkriminalisierung geringer Mengen aller illegalen Drogen gute Erfahrungen gemacht. Die positiven Auswirkungen zeigen sich dort in erster Linie in der sogenannten harten Drogenszene, deren Situation zudem mit flankierenden Hilfsangeboten deutlich verbessert wurde.[3]
Allen Regelungen zur Entkriminalisierung ist gemein, dass die Konsumierenden zwar vom Strafrecht entlastet wurden, Produktion, Import und Verkauf der Drogen aber illegal bleiben. Bei einer Legalisierung wird hingegen auch dies erlaubt. Häufig werden die Niederlande als Beispiel für eine „Legalisierung“ genannt. Tatsächlich aber gehen die niederländische Politik und Ordnungsbehörden einen Sonderweg: Produktion und Import von Cannabis sind vollständig verboten, allerdings wird der Verkauf kleiner Mengen von maximal fünf Gramm in den sogenannten Coffeeshops toleriert. Die Belieferung bleibt somit in krimineller Hand, weshalb zum einen keinerlei Produktsicherheit gegeben ist, zum anderen günstige Bedingungen für eigentlich verbotene Unternehmen geschaffen wurden, die teilweise auch in anderweitigen Drogenhandel und sonstige kriminelle Aktivitäten verwickelt sind. Etwas Ähnliches sollte hierzulande unbedingt vermieden werden.
Einen anderen Weg haben vor einigen Jahren diverse US-Bundesstaaten, Kanada und Uruguay eingeschlagen: Sie setzen auf eine vollständig regulierte Legalisierung des Cannabismarktes, wenn auch unter jeweils unterschiedlichen Vorzeichen: Während in US-Bundesstaaten wie etwa Colorado der Verkauf seit 2012 von privaten Firmen betrieben wird, setzt Uruguay auf nichtkommerzielle Lösungen wie Eigenanbau, „Cannabis Social Clubs“, in denen Konsumierende gemeinsam Hanf anbauen, sowie einen streng staatlich regulierten Verkauf in Apotheken.[4] Allerdings dauerte es in Uruguay mehrere Jahre, bis im Land produziertes Cannabis zur Verfügung stand, und die Lieferprobleme halten weiter an – wohl auch weil von Beginn an ein sehr niedriger Preis von umgerechnet rund 1,20 Euro pro Gramm festgelegt wurde. In den meisten US-Bundesstaaten, in denen Cannabis legalisiert wurde, zeigt sich hingegen eher eine Überkommerzialisierung: In den dortigen Verkaufsläden wird zumeist eine breite Palette an Produkten angeboten, die von Extrakten mit extrem hohem Wirkstoffgehalt bis zu THC-haltigen Süßigkeiten reicht.
In Kanada wurde die regulative Ausgestaltung den Provinzen und Territorien überlassen. Daher gibt es dort eine breite Spanne an Vertriebsmodellen, die von streng kontrollierten, staatlichen Verkaufsstellen bis zu ausschließlich kommerziellen Shops reicht. Dort, wo nur auf Letztere gesetzt wurde, hat sich seit der Legalisierung ein Trend zu steigendem Konsum fortgesetzt.[5] Kein Anstieg zeigte sich indes in den kanadischen Provinzen mit eher strengen Regeln. Insgesamt ist in Kanada im Übrigen nur ein geringer Anstieg des Konsums unter Jugendlichen und Heranwachsenden zu verzeichnen.
Ohnehin zeigt sich in allen drei Staaten, dass die wohl größte Befürchtung der Prohibitionsbefürworter, nämlich ein deutlicher Anstieg des Konsums bei Jugendlichen, nicht eingetreten ist: Dies trifft sowohl auf Uruguay als auch auf die US-Bundesstaaten mit legalem Cannabisverkauf zu.[6] Allerdings ist der Konsum in den meisten US-Bundesstaaten auch nur im Privaten oder in dafür eigens vorgesehenen, kommerziell betriebenen Räumen erlaubt. Touristen konnten zunächst nur bei teuren Cannabis-Touren in Bussen oder Limousinen legal Cannabis konsumieren. Seit Anfang 2020 ist dies auch in lizenzierten sogenannten marijuana hospitality businesses möglich. In mehreren kanadischen Bundesstaaten hingegen ist es erlaubt, Cannabis auch in der Öffentlichkeit zu konsumieren, sofern niemand davon gestört wird.
Legalisiert, reguliert und kontrolliert
Wenn die Bundesregierung nun tatsächlich ebenfalls den Weg der Legalisierung anstatt nur einer Entkriminalisierung geht, hätte dies nicht nur aus Sicht der Konsumierenden Vorteile: Zuallererst müssten sich Polizei und Justiz fortan nicht mehr mit rechtlich fragwürdigen Bagatelldelikten beschäftigen, was unter anderem zu gewaltigen Einsparungen von schätzungsweise rund 1,3 Mrd. Euro pro Jahr führen würde.[7] Knapp zwei Drittel aller Drogen-Ermittlungsverfahren hierzulande leitet die Polizei laut Bundeskriminalamtsstatistik wegen Cannabis ein, etwa 75 Prozent davon sogar wegen des reinen Eigenbedarfs. Gerade diese Drogendelikte werden auf vielen Polizeidienststellen auch deshalb geschätzt, weil die Beamten damit ohne großen Aufwand die durchschnittliche Aufklärungsquote erhöhen können. Dies erklärt in Teilen auch den Widerstand der Polizeigewerkschaften gegen eine Cannabislegalisierung.[8] Um ihre Forderungen zu unterstreichen, wurden aus diesen Organisationen zuletzt geradezu absurde Argumente genannt, etwa die Erwartung, dass die Kriminalität aufgrund der Legalisierung steigen oder (Waffen-)Gewalt zunehmen könnte.[9]
Der Staat könnte zum Zweiten aus einem bislang unregulierten Markt indirekte Steuern und Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in Höhe von rund 3,5 Mrd. Euro im Jahr einnehmen.[10] Diese Mittel könnten dann künftig unter anderem in Präventionsprojekte fließen. Diese sollten insbesondere Jugendlichen glaubhafter die Risiken des Cannabiskonsums[11] vermitteln, anstatt aufgrund der bestehenden Kriminalisierung eine Totalabstinenz zu predigen – was angesichts der hohen „Probierraten“ unter Jugendlichen eine weitgehend unrealistische Forderung ist. Zudem würden drittens, wenn sich ein problematischer Konsum eingestellt hat, Hemmschwellen abgebaut, Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen – die bislang aufgrund der drohenden Verfolgung auch bei erkanntem Beratungsbedarf im Zweifel nicht aufgesucht werden.
Natürlich würde der Schwarzmarkt mit einer Legalisierung von Cannabis nicht sofort verschwinden. Erfahrungen aus Kanada lassen aber hoffen, dass dieser nur in einer Übergangszeit fortbesteht: Denn obwohl es dort zuvor eine breit ausgebaute und preislich konkurrenzfähige illegale Cannabisindustrie gab – mit weitaus niedrigeren Preisen als hierzulande –, ist der Anteil der legalen Käufe in den drei Jahren seit der Legalisierung auf rund 70 Prozent gestiegen.[12] Der Grund dafür liegt auf der Hand: Bei legalem Cannabisverkauf erhalten die Konsumierenden ein sichereres Produkt mit geprüfter Qualität. Auf dem aktuellen Schwarzmarkt wissen sie hingegen zum einen nicht, wie viel Wirkstoff im Produkt enthalten ist – von Legalisierungsbefürwortern wird dies gerne damit verglichen, in einer Kneipe „ein Glas Alkohol“ zu bestellen und nicht zu wissen, ob ihnen nun eine Weinschorle oder Whisky kredenzt wird. Zum anderen kann illegal produziertes Cannabis auf vielfältige Arten verunreinigt sein und unter anderem Düngerrückstände, aufgesprühte, beschwerende Stoffe oder synthetische Wirkstoffe enthalten. Seit vergangenem Jahr häufen sich Berichte über im Straßenverkauf erhältliches „CBD-Gras“, dem synthetische Cannabinoide zugesetzt wurden – Substanzen, die anders als Cannabis schwere, im Extremfall lebensbedrohliche Nebenwirkungen erzeugen können.[13] Für die Konsumierenden ist derzeit schlicht nicht erkennbar, was sie auf dem Schwarzmarkt erstehen – ein Problem, das in noch gravierenderer Form ebenfalls sogenannte harte Drogen betrifft. Bei einem legalen Markt stellt sich diese Problematik nicht – vielmehr kann man Bedingungen dafür schaffen, wie Konsumierende an geprüfte Ware aus gut kontrolliertem Anbau gelangen.
Empfehlungen für die Legalisierung in Deutschland
Was also wäre der neuen Bundesregierung anzuraten, wenn sie sich auf den Weg einer legalen Cannabis-Regulierung in Deutschland machen möchte?[14]
Zunächst sollte Cannabis auch hierzulande nur in Fachgeschäften verkauft werden. Im Unterschied zu den bisher legalen Drogen schlägt ohnehin kaum jemand ernsthaft vor, Cannabis etwa in Supermärkten oder Tankstellen zu verkaufen. Aber auch Apotheken sind nicht geeignet, Cannabis zu Rauschzwecken zu verkaufen, ebenso wenig wie für Bier und Spirituosen – sie verkaufen Medikamente und keine Genussmittel. Zudem spricht bereits der Jugendschutz dagegen: So könnten Kinder oder Jugendliche, die aus gutem Grund Zutritt zu Apotheken haben, Verkaufsgespräche über unterschiedliche Cannabissorten mitbekommen. Generell ist es eine fragwürdige Vorstellung, dass Pharmazeuten, deren Expertise in der Bekämpfung bzw. Linderung von Krankheiten liegt, detaillierte Informationen über berauschende Wirkungen oder Geschmacksrichtungen von Cannabis geben sollen.
Diese Fachgeschäfte benötigen eine Lizenz, so dass Kommunen deren Zahl steuern können. Die Geschäfte sollten auch Konsum vor Ort anbieten können, ähnlich wie die niederländischen Coffeeshops, sofern dadurch keine Dritten, etwa Anwohnerinnen und Anwohner, gestört werden. Damit könnte eine soziale Einbindung des Konsums gefördert werden. Verkauft werden darf ausschließlich an volljährige Personen, deren Alter mit Hilfe von Ausweiskontrollen festgestellt wird. Unter gegenwärtigen Bedingungen sollten zudem nicht mehr als 10 Gramm Cannabisprodukte auf einmal an die Kunden verkauft werden.
Das Personal in den Fachgeschäften sollte darin geschult sein, sowohl über die verkauften Produkte als auch – wenn nötig – über bestehende Hilfsangebote zu beraten. Ausführliches Informationsmaterial zu Beratungsangeboten, den Wirkungen der Droge und den Risiken des Cannabiskonsums sollte in den Fachgeschäften sichtbar ausliegen. Hier besteht ein wichtiger Unterschied zu Alkohol und Zigaretten, die bekanntlich quasi überall verkauft werden dürfen, ohne dass das Verkaufspersonal irgendwelche Expertise über Risiken oder Hilfsangebote vorweisen muss.
Auf den angebotenen Produkten müssen Angaben zu Herkunft, Produktionsdatum sowie THC- und CBD-Gehalt gemacht werden.[15] Wie bei anderen Lebens- und Genussmitteln sollte die Qualität zudem stichprobenartig von den zuständigen Ämtern geprüft werden. Dies garantiert, dass das Cannabis frei von Streckmitteln oder giftigen Stoffen ist. Außerdem sollten bei den Kontrollen die angegebenen Wirkstoffmengen sowie die Haltbarkeit der Produkte überprüft werden – das stellt sicher, dass die Konsumierenden wissen, was sie zu sich nehmen, und Überdosierungen vermieden werden.
Neben Hanfblüten sollte auch der Verkauf von Haschisch und anderen Konzentraten möglich sein. Die Produzenten im Inland werden dafür lizenziert und ihre Produktionsstätten stichprobenartig kontrolliert. Lizenzen sollten dabei sowohl an Unternehmen, die in größerem Stil Cannabis als „Massenprodukt“ anbauen, als auch an Kleinproduzenten, die zum Beispiel Bio-Ware anbieten, vergeben werden. Import aus anderen Ländern – auch traditionellen Produktionsländern – sollte möglich sein, sofern dort zukünftig entsprechende offizielle Regulierungen bestehen. Für die Kontrolle der Produktionsstätten sind die Importeure zuständig. Jugendliche, die wiederholt mit Eigenverbrauchsmengen auffallen, sollten nicht bestraft, sondern zu Präventionsschulungen verpflichtet werden. Lediglich der kommerzielle Verkauf von Cannabis an Jugendliche mit Gewinnerzielungsabsicht sollte bestraft werden. Erziehungsberechtigte, die Jugendlichen ab 14 Jahren den Konsum in der Öffentlichkeit ermöglichen, begehen eine Ordnungswidrigkeit, wird sogar Kindern der Konsum ermöglicht, eine Straftat. Werbung für Cannabisprodukte und -marken sollte in der Öffentlichkeit verboten und ausschließlich in Fachgeschäften und Fachzeitschriften erlaubt sein.
Die Besteuerung der Cannabisprodukte sollte nach THC-Gehalt gestaffelt sein, damit risikoarme Konsumformen bevorzugt werden. Sie sollte so gestaltet werden, dass der Staat einerseits gute Einnahmen generieren kann wie bei anderen Genussmitteln und keine Schleuderpreise entstehen, aber andererseits das Schwarzmarktniveau nicht wesentlich überschritten wird. Nur so kann der Schwarzmarkt für Cannabis verdrängt werden.
Nicht zuletzt sollte der Eigenanbau von Cannabis legalisiert werden, solange dieser sich auf die Deckung des eigenen Konsums beschränkt und damit den Jahresbedarf einer Person nicht überschreitet. Damit würde regelmäßig Konsumierenden mit geringem Einkommen eine Möglichkeit zur günstigen Versorgung geboten. Im Rahmen dieses privaten Eigenanbaus sollten auch Anbauclubs wie in Spanien oder Uruguay möglich sein, in denen die Mitglieder gemeinsam anbauen und die Ernte unter sich aufteilen. Im Zuge dessen sollte auch das in Deutschland geltende Verbot von Hanfsamen aufgehoben und eine regulierte Produktion von Saatgut ermöglicht werden.
Wie alle psychoaktiven Substanzen ist Cannabis mit spezifischen Risiken assoziiert. Zieht die Bundesregierung jedoch in ihrem Bestreben, Cannabis zu legalisieren, aus den Erfahrungen und Leitlinien anderer Länder die richtigen Konsequenzen, wäre dies nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft als Ganzes von Vorteil. Vor allem aber würden damit nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung von den Risiken von Bestrafung und Stigmatisierung befreit. Und nicht zuletzt bringt die Prohibition auch bei anderen illegalen Drogen erhebliche Nachteile und Risiken mit sich, weshalb auch für diese – nach dem Vorbild Portugals – legale Regulierungsmodelle zumindest zu erwägen sind.
[1] Nicki-Nils Seitz u.a., Kurzbericht Epidemiologischer Suchtsurvey 2015, Tabellenband: Konsum illegaler Drogen, multiple Drogenerfahrung und Hinweise auf Konsumabhängigkeit und -missbrauch nach Geschlecht und Alter im Jahr 2018. München 2019, www.esa-survey.de.
[2] Vgl. Drogenbeauftragte für Sechs-Gramm-Grenze bei Cannabis, www.tagesspiegel.de, 23.8.2021.
[3] Vgl. Portugal sieht liberale Drogenpolitik als Erfolg an, www.deutschlandfunknova.de, 1.7.2021.
[4] Vgl. Anne Herrberg, Gras vom Staat, www.tagesschau.de, 18.10.2020.
[5] Vgl. Blair Gibbs, Tom Reed und Seb Wride, Cannabis Legalisation - Canada’s Experience, Oktober 2021, www.publicfirst.co.uk. – Ein Teil dieses Anstiegs fällt jedoch in die Zeit der Corona-Pandemie, in der auch hierzulande eine Zunahme des regelmäßigen Cannabiskonsums zu beobachten ist: Vgl. Bernd Werse und Gerrit Kamphausen, Cannabiskonsum in der Corona-Pandemie – Erste Auswertungen der zweiten Online-Kurzbefragung, Centre for Drug Research der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt a. M., 2021, www.uni-frankfurt.de.
[6] Hannah Laqueur u.a., The impact of cannabis legalization in Uruguay on adolescent cannabis use, Juni 2020, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov; D. Mark Anderson u.a., Association of Marijuana Legalization With Marijuana Use Among US High School Students, 1993-2019, 7.9.2021, www.jamanetwork.com.
[7] Justus Haucap und Leon Knoke, Fiskalische Auswirkungen einer Cannabislegalisierung in Deutschland: Ein Update, www.hanfverband.de, 16.11.2021.
[8] Polizeigewerkschaften: Kritik an möglicher Cannabis-Legalisierung, www.zdf.de, 12.10.2021.
[9] Vgl. u.a. Rainer Wendt im „nachtmagazin“, 26.11.2021.
[10] Haucap/Knoke, a.a.O.
[11] Wichtigste Beispiele für Risiken jugendlichen Cannabiskonsums sind erstens die mögliche Beeinträchtigung der Hirnentwicklung bei hohem Konsum im frühen Jugendalter, zweitens die mögliche Verstärkung psychischer Probleme, etwa einer Psychoseneigung, sowie drittens die Entwicklung einer Konsumstörung bzw. Abhängigkeit.
[12] Vgl. Gibbs/Reed/Wride, a.a.O.
[13] Vgl. Volker Auwärter, Karsten Tögel-Lins und Bernd Werse, Alter Wein in neuen Schläuchen: Synthetische Cannabinoide auf CBD-Hanf als vermeidbare Gesundheitsgefahr für Cannabis-Konsumierende, in: Akzept e.V., 8. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2021, S. 178-180. www.alternativer-drogenbericht.de.
[14] Vgl. auch das Papier des Schildower Kreises, das 2019 auf dem Antiprohibitionistischen Kongress vorgestellt wurde. Weitere Informationen auf www.schildower-kreis.de/tagung.
[15] CBD und THC sind chemische Verbindungen, die von Cannabispflanzen produziert werden und die man als Cannabinoide bezeichnet. Vor allem der THC-Gehalt bestimmt den Wirkungsgrad der Droge.