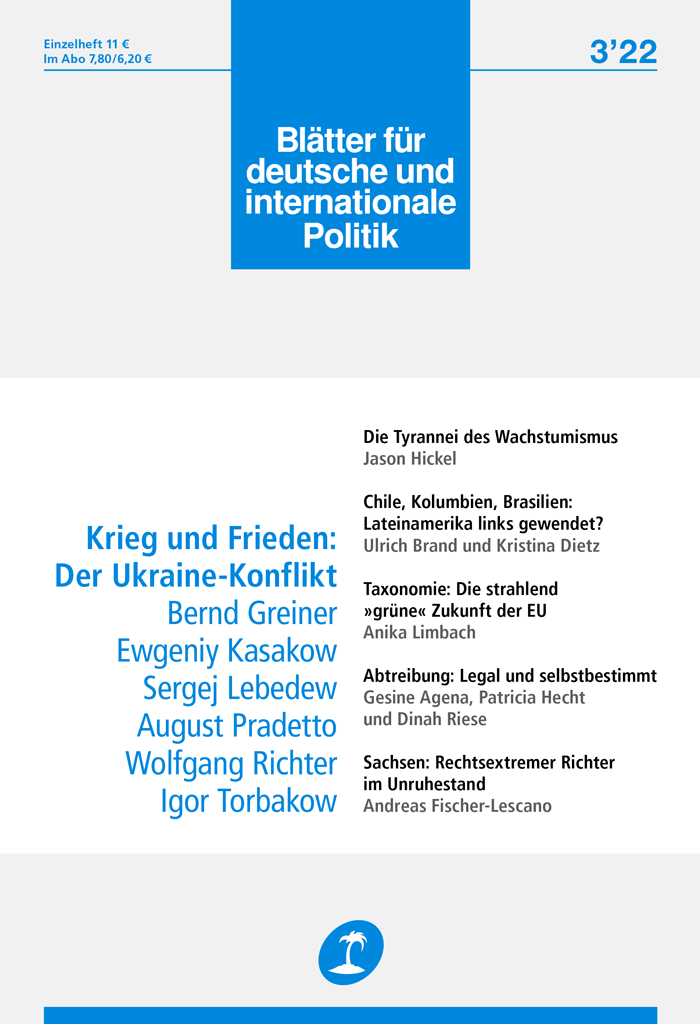Wie die EU die Energiewende sabotiert

Bild: Protest gegen die »grüne« EU-Taxonomie für Atomenergie und Erdgas am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt am Main, 11.1.2022 (IMAGO / Tim Wagner)
Nun ist die Entscheidung also gefallen. Die EU-Kommission hat Atomkraft und Erdgas am Ende tatsächlich ein grünes Label verpasst – trotz massiver Kritik an ihrem zum Jahreswechsel versendeten Entwurf zur Taxonomie.[1] Die beiden Energieformen wurden in dem „ergänzenden delegierten Rechtsakt“ zwar nur den „Übergangstechnologien“ zugeordnet, jedoch unter Bedingungen, die einen langen, teils jahrzehntelangen Betrieb entsprechender Kraftwerke erlauben. Damit aber wird der Begriff „Übergang“ zur Worthülse.
Zu den Kritiker*innen dieser Entscheidung gehören nicht nur Umweltverbände und Klimaschützer*innen, sondern auch Wirtschafts- und Finanzexpert*innen sowie zahlreiche Wissenschaftler*innen einschließlich der Platform on Sustainable Finance, einem EU-Beratungsgremium, das über zwei Jahre hinweg maßgeblich an der Ausarbeitung der EU-Taxonomie beteiligt war.[2] All diese Expert*innen hatten zweierlei gehofft: Zum einen sollten große Finanzströme in Europa fortan in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten gelenkt werden, zum anderen sollte ein einheitliches grünes Siegel Greenwashing auf dem Finanzmarkt unterbinden. Doch mit der Aufnahme von Atomkraft und Erdgas in das EU-Regelwerk wird dieses Ziel in sein Gegenteil verkehrt. Zwar ist aus der Finanzbranche zu hören, dass sich private Investoren auch in Zukunft davor hüten werden, Geld in die Atomindustrie zu stecken. Gleichzeitig aber spricht sich Jean-Jacques Barbéris, Vorstand der größten europäischen Fondsgesellschaft Amundi, für Investitionen in Atomkraft aus – als Teil eines nachhaltigen Fonds.[3] Was allerdings noch stärker als private Finanzentscheidungen ins Gewicht fällt: Auch bei der Vergabe öffentlicher Gelder und bei EU-Förderprogrammen wird die nun geltende Taxonomie eine wichtige Rolle spielen. So ist das bis zu 750 Mrd. Euro umfassende, zur Hälfte durch grüne Anleihen finanzierte Resilienzprogramm „NextGenerationEU“, das eine nachhaltige Ankurbelung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie fördern soll, ausdrücklich an die Taxonomiekriterien gekoppelt.[4]
Auch wenn die EU es gerne so hätte – Erdgas ist alles andere als nachhaltig. Denn bei Förderung und Transport des fossilen Brennstoffs entstehen schädliche Klimagase. Doch ausgerechnet diese Erdgasemissionen wurden bei der Einstufung ausgespart. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt der Klimagasausstoß, welcher der Herstellung vermeintlich „CO2-armem“ Wasserstoffs vorgelagert ist. Wird Erdgas zu dessen Produktion genutzt, könnte dies nach Ansicht von Karsten Löffler, einem Mitglied der Platform on Sustainable Finance, unter Umständen zu einem höheren Ausstoß von CO2führen als ohne die derzeit von vielen so euphorisch gefeierte Wasserstofftechnologie.[5] Für die Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie ist vor allem die alte und neue Bundesregierung verantwortlich – namentlich Olaf Scholz. Durch ihre Stellungnahme zum Jahreswechselentwurf erreichte sie sogar, dass die Regeln für Gaskraftwerke nochmals aufgeweicht wurden. So muss der Brennstoffwechsel grün gelabelter Gaskraftwerke von fossilem Gas auf Wasserstoff nicht wie zuvor geplant ab 2026, sondern erst ab 2035 vollzogen werden. Über diesen Skandal kann auch die klare Kritik der Regierung an dem grünen Siegel für Atomkraft nicht hinwegtäuschen.
Freibrief für die Atomindustrie
Diese Kritik ist dennoch mehr als gerechtfertigt. Denn die nun geltenden Bestimmungen zur Atomkraft, die maßgeblich Frankreich forciert hat, sind für die Europäische Union noch verheerender als jene für Erdgas. Sie stellen der Industrie geradezu einen Freibrief aus: Betreiber von Atomkraftwerken müssen sich nicht für den Schadensfall versichern. Zudem gelten bis 2045 genehmigte AKW-Neubauten als nachhaltig, genauso wie Nachrüstungen überalterter Reaktoren im Zuge ihrer Laufzeitverlängerung (bis 2040). Und auch die in Europa nach wie vor ungeklärte Frage, wie der radioaktive Müll über Jahrtausende so sicher wie möglich endgelagert werden soll, darf bis 2050 offen bleiben. Dieses großzügige Geschenk an Frankreich kam keineswegs überraschend. Obwohl sich das Europäische Parlament in einem Votum 2018 mehrheitlich gegen die Aufnahme der Atomkraft in die Taxonomie ausgesprochen hatte, erhöhte Präsident Emmanuel Macron dahingehend stetig den Druck. Er schmiedete mit Finnland und osteuropäischen Ländern eine Pro-Atom-Allianz. Zudem setzten seine Unterhändler 2019 bei der EU-Kommission einen zweifelhaften „Kompromiss“ durch: Demnach sollten Gutachter nochmals „überprüfen“, ob Atomkraft mit den Nachhaltigkeitszielen der Taxonomie bzw. dem Grundsatz „Do no significant harm“ („Verursache keinen maßgeblichen Schaden“) vereinbar sei.[6]
Dass die Atomkraft gegen diesen Grundsatz verstößt, liegt auf der Hand – und jedes unabhängige Expertengremium hätte dies bestätigt. Nicht so aber das „Joint Research Centre“ (JRC) der EU, das von EURATOM mitfinanziert wird und der Atomlobby nahesteht. Der im März 2021 veröffentlichte Bericht des Gremiums zugunsten einer nachhaltig gelabelten Atomkraft erhielt vom deutschen Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) denn auch ein vernichtendes Urteil. Der Bericht „betrachtet die Folgen und Risiken der Kernenergienutzung für Mensch und Umwelt sowie für nachfolgende Generationen nur unvollständig oder spart diese in seiner Bewertung aus“, heißt es in der Fachstellungnahme. Außerdem missachte er „Grundsätze wissenschaftlichen Arbeitens“.[7] Die EU-Kommission ignorierte diese und andere kritische Bewertungen und folgte stattdessen dem Votum der atomfreundlichen Expertengruppe.
Gefälligkeitsgutachten im Sinne der Atomlobby
In der Tat liest sich der JRC-Bericht teilweise wie eine Zusammenstellung haltloser Behauptungen der Atomlobby. Dass Atomkraft in Europa angeblich in hohem Maße zum Klimaschutz beitrage, leiten die Autor*innen wortreich von zwei fragwürdigen Aussagen ab: Zum einen produziere diese Technologie im gesamten Lebenszyklus weniger als 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde; zum anderen verbleibe der Atomstromanteil am europäischen Energiemix bis 2050 bei 22 Prozent. Die erste Behauptung ist höchst umstritten, die zweite lässt den längst bestehenden Abwärtstrend außer Acht.[8] Der Bericht unterstellt also einen massiven AKW-Ausbau und versucht diesen mit einem vermeintlich wachsenden Interesse an Mini-Reaktoren, den sogenannten Small Modular Reactors (SMR), zu begründen.
Den Risiken für Mensch und Umwelt widmet sich das Gutachten hingegen nur höchst unzulänglich, obwohl es eine wesentliche Aufgabenstellung war. Es beschränkt sich auf vorhersehbare Ereignisse und lässt Unfälle, die die Sicherheitsbestimmungen überschreiten, außen vor – so als hätte es die Super-GAUs von Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima nicht gegeben. Der Bericht erwähnt diese zwar, führt sie aber nur als Ausnahmen, die man nach entsprechenden Nachrüstungen so gut wie ausschließen könne. Außerdem, so die Gutachter, sei die Gefahr eines Super-GAUs bei den Reaktoren der sogenannten dritten Generation gebannt. Auch das riesige Entsorgungsproblem wird als gelöst angesehen, denn Finnland, Schweden und Frankreich, so die Behauptung, verfügten in den nächsten Jahren über funktionierende Endlager für hochradioaktiven Müll.
Das BASE, das hierzulande den neuen Prozess einer landesweiten Suche nach einem Endlager betreut,[9] widerlegte jedes einzelne dieser Scheinargumente. Seiner Bewertung nach verharmlost der JRC-Bericht das Unfallrisiko erheblich und verschweigt, dass durch Nachrüstungen die Sicherheit überalterter Reaktoren nur teilweise verbessert werden kann. Einer Versprödung des Baumaterials könne man so kaum entgegenwirken. Der Fokus auf neue Reaktortypen und deren angebliche Sicherheit verstelle den Blick darauf, dass alte und immer marodere Meiler den meisten Atomstrom erzeugen, und zwar noch über Jahrzehnte hinweg. Die Gutachter*innen unterschlagen zudem, dass sich Mini-Reaktoren erst im Konzeptstadium befinden, von ihrer Marktreife sehr weit entfernt sind und ebenfalls nicht laufen werden, ohne Atommüll zu produzieren. Der strahlende Müll jedoch belaste praktisch alle nachfolgenden Generationen. Nach 70 Jahren Atomkraftnutzung gebe es weltweit immer noch kein Endlager. Und selbst wenn es eines gäbe, fehlten doch Erfahrungswerte, um dessen Risiken sicher einschätzen zu können. Außerdem ließen sich die Gegebenheiten für ein Endlager in einem Land nicht auf ein anderes übertragen. Mittel- und leichtradioaktiven Müll lasse das JRC unberücksichtigt, genauso wie die Gefahren der Proliferation und alle negativen Auswirkungen des Uranabbaus.
Festzuhalten bleibt, dass die von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durchgeboxte Ergänzung zur Taxonomie vor allem Frankreich nützt, oder genauer gesagt: Emmanuel Macron und der französischen Atomindustrie. Das gilt besonders für die Möglichkeit, Laufzeitverlängerungen als nachhaltig einzustufen. Denn die 56 französischen Reaktoren liefern mehr als zwei Drittel des landesweiten Stroms. 19 von ihnen haben die besonders kritische Grenze von vierzig Betriebsjahren bereits jetzt überschritten, weitere folgen bald.[10] Damit sie von der französischen Atomaufsicht (ASN) eine Genehmigungsverlängerung erhalten können, müssen sie umfangreich nachgerüstet werden. Das kostet nach Angaben des französischen Rechnungshofes allein für den Zeitraum 2014 bis 2030 100 Mrd. Euro. Kein Wunder also, dass der hochverschuldete, überwiegend staatliche Energiekonzern EDF alles daran setzt, an billige Kredite zu gelangen. Allerdings wird Geld allein die massiven Probleme von EDF nicht lösen können. Wegen des Fachkräftemangels können die Altmeiler nur nacheinander, nicht zeitgleich generalüberholt werden. Viele von ihnen werden also ohne die notwendige Nachrüstung jahrelang am Netz bleiben, was die ASN offensichtlich durchgehen lässt.
Indessen wird die französische Reaktorflotte immer störanfälliger. Das betrifft nicht nur die ältesten Meiler. Vor kurzem mussten einige jüngere, baugleiche Reaktoren wegen entdeckter Risse im Notkühlsystem außer Betrieb genommen werden. Inzwischen besteht der Verdacht auf ernstzunehmende Korrosionsschäden. Ende vergangenen Jahres standen bis zu 17 Reaktoren gleichzeitig still, weshalb Frankreich riesige Mengen Strom – bis zu 13 Gigawatt – importieren musste. Ein großer Teil davon kam aus Deutschland. Auch im vergangenen Januar floss mehr Strom von hier ins Nachbarland als umgekehrt. Über Jahrzehnte hinweg hat sich Frankreich in eine energiewirtschaftliche Sackgasse hineinmanövriert. Nun scheint die Erkenntnis, dass die Lösung in einem massiven Zubau erneuerbarer Energien liegt, langsam durchzudringen. Nach einer Umfrage des Instituts für Strahlenschutz und Reaktorsicherheit ist Atomkraft in der Bevölkerung inzwischen die zweitunbeliebteste Energieform. Die oft schlecht geredete Windkraft steht im Ranking dagegen an zweiter Stelle, gleich hinter der beliebtesten Energieform, der Solarenergie. Doch anstatt diese Stimmung in der Bevölkerung aufzugreifen und umzusteuern, kündigte Macron im Dezember 2020 medienwirksam an, in Zukunft sechs große Atommeiler zu bauen und die Entwicklung von Mini-Reaktoren voranzutreiben.[11] Das aber ist völlig unrealistisch. Denn zum einen gibt es bislang keine funktionierenden Prototypen. Zum anderen ist die eine Milliarde Euro, die Macron dafür aufwenden will, eine lächerlich kleine Summe im Vergleich zu den Kosten, die mit solchen Projekten verbunden wären. Und dennoch ist es sehr viel Geld, zieht man in Betracht, dass es an anderer Stelle, nämlich für die Beschleunigung der Energiewende, fehlt. Durch das neue EU-Nachhaltigkeitssiegel könnten nun noch wesentlich größere Summen fehlgeleitet werden.
Für eine Energiewende ohne bürokratische Hürden
Dass die Mini-Reaktoren so viel Aufmerksamkeit und Zustimmung erfahren, lässt sich nur mit dahinterliegenden Motiven erklären, die oft – wie in Frankreich – militärischer Natur sind.[12] Bislang vorliegende Konzeptstudien beruhen auf gänzlich unterschiedlichen Reaktortypen – auch auf solchen, die sich inzwischen als unzulänglich herausstellten, wie etwa die sogenannten Schnellen Brüter oder Hochtemperaturreaktoren. Zum einen soll eine Art Baukastensystem für eine hohe Kosten- und Zeitersparnis bei der Herstellung dieser Reaktoren sorgen, zum anderen versprechen passive, von der Stromzufuhr unabhängige Sicherheitssysteme eine hohe „Unfalltoleranz“. Doch nichts davon ist auch nur annähernd belegt.[13] Im Gegenteil: Der SMR-Prototyp in Argentinien, seit 2014 in Bau, wird als solcher nicht ans Netz gehen, da sich seine Funktionsweise als zu komplex erwies. Die angesetzte Planungs- und Entwicklungszeit wurde zudem um ein Vielfaches überschritten, genauso wie die Kosten, die über denen von herkömmlichen Reaktoren liegen. Ähnlich verhält es sich mit den beiden 2020 fertiggestellten Mini-Reaktoren auf dem russischen Atomschiff „Lomonossow“. Explodierende Kosten, Bauverzögerungen und die schlechte Leistung der Meiler offenbarten, dass die Idee, sie in großer Stückzahl herzustellen, nicht umsetzbar ist.
Wie aber ist – angesichts dieses Festhaltens an einer „Zombie“-Technologie – eine schnelle Energiewende in Ländern wie Frankreich überhaupt noch möglich?[14] Trotz des enormen Potentials der erneuerbaren Energien wurden ihnen in Frankreich seit jeher Steine in den Weg gelegt. Nachdem Wind- und Solarkraft im Jahr 2018 sogar einen Kapazitätsrückbau verzeichneten,[15] nimmt die Anzahl erneuerbarer Anlagen zwar wieder zu – allerdings nur sehr langsam: im Schnitt 1,2 Gigawatt bei Wind- und 0,8 Gigawatt bei Solarkraft. Würde dieses Ausbautempo beibehalten, verfügten die erneuerbaren Energien in Frankreich auch in 100 Jahren nicht über einen Anteil von hundert Prozent am Strommarkt . Im Jahr 2020 lag dieser daher auch nur bei 23,3 Prozent.[16] Zum Vergleich: In Deutschland betrug er im gleichen Jahr 44,9 Prozent.
Rein ökonomisch betrachtet, stünde in Frankreich einer stark beschleunigten Energiewende nichts im Wege, denn inzwischen ist Strom aus Wind- und Solarkraft erheblich billiger als Atomstrom. Der dringend benötigte Netzausbau vor allem auf regionaler Ebene ist zwar kostspielig, doch fällt er zusammen mit dem Ausbau der Erneuerbaren immer noch preisgünstiger aus als die Nachrüstung alter Atommeiler, ganz zu schweigen vom AKW-Neubau.[17] Auch Batteriespeicher haben in den vergangenen Jahren einen beispiellosen Preisverfall erlebt, so dass sie in Kombination mit Freiflächensolaranlagen längst konkurrenzfähig sind.[18] Doch wer in Frankreich eine erneuerbare Anlage errichten will, muss eine Vielzahl bürokratischer und institutioneller Hürden überwinden.[19] Diese zu beseitigen wäre eine vordringliche politische Aufgabe, die allerdings bislang daran scheitert, dass die Übermacht des zentralistisch organisierten Staatskonzerns EDF – der nach wie vor auf die Atomkraft setzt – politisch nicht in Frage gestellt wird.
Frankreich ist innerhalb der EU nicht das einzige Land, das weiterhin auf Atomkraft setzt. Auch Finnland, Schweden, die Niederlande und Belgien besitzen uralte Reaktoren, die bereits vierzig Jahre und länger laufen. Ohne fortwährende Subventionen wären diese Zeitbomben schon längst abgeschaltet worden. Die nun von der EU beschlossene Taxonomie wird deren Laufzeiten ebenfalls verlängern – genauso wie die der zwei bundesdeutschen Uranfabriken in Lingen und Gronau, die einen großen Teil dieser Uraltmeiler mit Brennstoff versorgen. Atomkraftgegner*innen fordern schon seit Jahren deren Schließung. Wenn die Bundesregierung es tatsächlich ernst meint mit ihrem „Nein“ zum nachhaltigen EU-Siegel für Atomkraft, sollte sie dieser Forderung schnellstmöglich nachkommen und sich angesichts der unverändert hohen Gefahren, die durch einen nicht auszuschließenden GAU wie auch durch die weltweit nach wie vor ungeklärte „Endlager“-Frage von der Atomkraft ausgehen, vehement für eine Abkehr von dieser einsetzen – und für eine ausreichende Finanzierung tatsächlich nachhaltiger Energien.
[1] European Commission, EU taxonomy: Commission presents Complementary Climate Delegated Act to accelerate decarbonization, www.ec.europa.eu, 2.2.2022.
[2] European Commission, Platform on Sustainable Finance’s response to the consultations on the taxonomy draft complementary Delegated Act, www.ec.europa.eu, 24.1.2022.
[3] Dennis Kremer, „Ja, Atomkraft ist nachhaltig“, www.faz.net, 27.1.2022.
[4] Europäische Kommission, Fragen und Antworten: Erste Ausgabe grüner Anleihen im Rahmen von NextGenerationEU, www.ec.europa.eu, 12.10.2021.
[5] Vgl. Öko-Siegel für Atomkraft und Gas? Was schlägt die Kommission vor, und wie geht es weiter?, wwww.youtube.de, 3.2.2022.
[6] Werner Mussler, Taxonomie-Kompromiss. Atomkraft soll nur fast als grün gelten, www.faz.net, 17.12.2019.
[7] European Commission, JRC report: Technical assessment of nuclear energy with respect to the ‘do no significant harm’ criteria of Regulation (EU) 2020/852 (‘Taxonomy Regulation’), www.ec.europa.eu, 29.3.2021. Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, BASE-Fachstellungnahme: Kernenergie ist nicht „grün“, www.base.bund.de, 10.11.2021.
[8] Vgl. Jo Harper und Gero Rueter, Faktencheck: Ist Atomenergie klimafreundlich?, www.dw.com, 11.11.2021; Hannah Ritchie und Max Roser, Electricity Mix, www.ourworldindata.org.
[9] Vgl. Wolfgang Ehmke, „Not in my Backyard“: Wohin mit dem Atommüll, in: „Blätter“, 3/2021, S. 113-120; Rebecca Harms, Atommüll: Keine Endlagerung ohne Bürgerbeteiligung, in: „Blätter“, 1/2022, S. 13-16.
[10] Liste der Nuklearanlagen in Frankreich, www.wikipedia.de.
[11] Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Déplacement du Président Emmanuel Macron sur le site industriel de Framatome, www.elysee.fr, 8.12.2020.
[12] Vgl. dazu Angelika Claußen, Mit „grünen“ AKWs zu neuen Atomwaffen, in: „Blätter“, 2/2022, S. 97-99.
[13] Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Sicherheitstechnische Analyse und Risikobewertung einer Anwendung von Small Modular Reactors (SMR), www.base.bund.de.
[14] Vgl. Bernhard Pötter, Der Zombie der Klimadebatte: Falsche Verheißung Atomkraft, in: „Blätter“, 8/2021, S. 13-16.
[15] Installed Capacity per Production Type, https://transparency.entsoe.eu.
[16] Ritchie/Roser, a.a.O.
[17] So die Aussage von Sven Rösner, dem Geschäftsführer des deutsch-französischen Büros für die Energiewende, www.dfbee.eu.
[18] Lazard’s levelized cost of energy Analysis – Version 15.0. www.lazard.com, Oktober 2021.
[19] Erneuerbare in Frankreich. Viel zu wenig Dynamik bei der Energiewende, www.energiezukunft.eu, 20.1.2021.