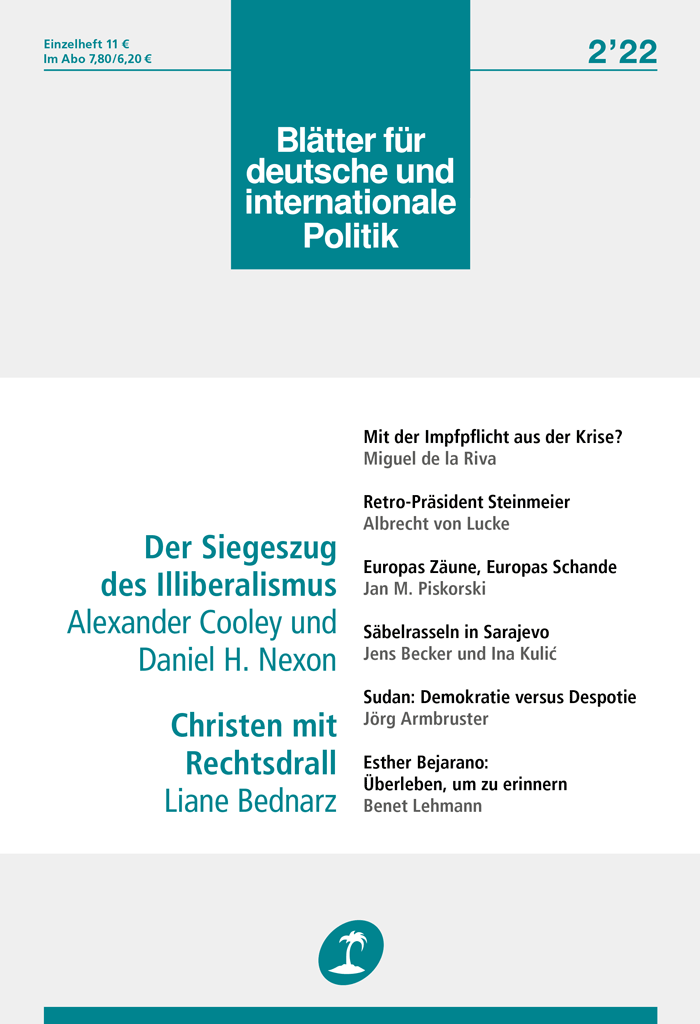Bild: Ein atomgetriebenes U-Boot der Rubis-Klasse der französischen Marine, 1.9.2021 (IMAGO / ZUMA Wire)
In der Europäischen Union ist ein Streit um die Atomkraft entbrannt: Ende des vergangenen Jahres kündigte die EU-Kommission an, künftig Investitionen in Atomenergie und Gas als nachhaltig einzustufen. Es geht dabei einerseits um Milliarden-Fördertöpfe, mit denen der ökologische Umbau gefördert werden soll. Vor allem aber könnten damit Investitionen sowohl in Gas als auch in Atom als nachhaltige Geldanlagen auf den Finanzmärkten beworben werden.
Die deutsche Bundesregierung reagierte mit massiver Kritik, Wirtschaftsminister Robert Habeck sprach von „Greenwashing“. Österreich und Luxemburg haben bereits eine Klage gegen die Einordnung der Atomenergie als klimafreundlich angekündigt. Doch die Befürworter sind klar in der Mehrheit: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron macht sich dafür stark, der Atomenergie ein „grünes Label“ zu verschaffen. Sein Land hat zum Jahreswechsel die EU-Ratspräsidentschaft übernommen und weiß in dieser Frage viele, insbesondere osteuropäische Mitgliedstaaten hinter sich.
In den vergangenen Jahren hat sich Macron immer deutlicher als Verfechter der Atomkraft positioniert. Frankreichs eigenständige Entwicklung der Atomtechnologie für Nuklearwaffen wie Energieerzeugung ist eine wichtige Quelle nationalen Stolzes – und noch immer bezieht das Land mehr als zwei Drittel seines Stromes aus Atomkraftwerken.
Seit den 1990er Jahren ist jedoch auch westlich des Rheins der Atomtrend rückläufig, eine Folge der Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986. Weltweit befindet sich die Atomenergie im Niedergang, wie die jährlichen Berichte des internationalen Experten für Energie- und Atompolitik Mycle Schneider zeigen.[1] Dennoch wirbt Frankreich unermüdlich für fortwährende Investitionen in diese „Zombie“-Technologie.[2]
Welche Interessen tatsächlich hinter dem französischen Eintreten für Atomenergie stehen, zeigt ein Zitat aus der Rede von Emmanuel Macron bei seinem Besuch in der Atomschmiede Le Creusot im Jahr 2020: „Ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie – und ohne die militärische Nutzung gibt es auch keine zivile Atomenergie.“[3]
Im Klartext heißt das: Ohne gut ausgebildete Ingenieur*innen und Techniker*innen und eine Atomwirtschaft, die auf dem neuesten technischen Stand ist, kann Frankreich sein Atomwaffenarsenal weder weiter ausbauen noch modernisieren. Das gilt übrigens für alle neun Atomwaffenstaaten.
Derzeit rüsten alle diese Atomwaffenstaaten auf. Russland und die USA beschaffen neue Trägersysteme, die ihre Atombomben sehr viel schneller und präziser ins Ziel bringen, sodass dem Gegner keine Abwehrmöglichkeiten bleiben – beispielsweise sogenannte Hyperschallraketen.[4]
Damit hat ein neues atomares Wettrüsten begonnen. Der US-Thinktank Atlantic Council beschreibt die Notwendigkeit der zivilen Nutzung der Atomenergie für die nationale Sicherheitspolitik denn auch ganz offen: „Die zivile US-amerikanische Atomindustrie bildet ein strategisches Anlagegut von lebenswichtiger Bedeutung für die nationale Sicherheit der USA.“[5] Ähnliche Formulierungen finden sich auch in den Reden der jeweiligen Präsidenten der Atomwaffenstaaten.
Atom-U-Boote für den Weltmachtstatus
Auch Frankreich will an dieser Entwicklung teilhaben, die in anderen Atomwaffenstaaten schon längst begonnen hat. Macron hat angekündigt, eine Milliarde Euro in die Forschung und den Bau von Small Modular Reactors (SMR) zu investieren. Hinter dem Kürzel SMR verbergen sich kleine Atomreaktoren, die vor allem als Antrieb von U-Booten und damit der militärischen Nutzung an entlegenen Kriegsschauplätzen dienen sollen.[6] Und die französische Marine will mit neuen Jagd-Unterseebooten die Weltmacht-Ambitionen des Landes untermauern.[7] Macron war daher sehr verärgert, als Australien jüngst den Auftrag für französische Diesel-U-Boote kündigte und stattdessen Atom-Technologie von den USA und Großbritannien kaufte.
Die örtlich flexiblen, U-Boot-basierten atomaren Waffensysteme besitzen für alle Atomwaffenstaaten größte strategische Bedeutung. Sie haben die Fähigkeit, bis zu drei Monate ohne Auftauchen unter Wasser zu bleiben, und können mit hoher Geschwindigkeit unerkannt weite Distanzen zurücklegen und an nahezu beliebigen Orten rund um den Globus auftauchen. Bis zu 20 Atomraketen mit jeweils einem Dutzend individuell lenkbaren Atomsprengköpfen können von dort abgefeuert werden. All das spielt in der Atomwaffendoktrin der fünf „offiziellen“ Atomwaffenstaaten USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China eine zentrale Rolle. Gleichzeitig untermauert der Besitz dieser Technologie den Weltmachtstatus. Frankreich wird darauf ebenso wenig verzichten wollen wie die übrigen Atomwaffenstaaten.
Da passt es ins Bild, dass das erste Treffen der EU-Verteidigungsminister*innen unter französischer Ratspräsidentschaft am 12. und 13. Januar in der bretonischen Hafenstadt Brest stattfand – ausgerechnet dort also, wo die seegestützten französischen Atomwaffen stationiert sind: eine Demonstration der Vormachtstellung Frankreichs.
Bereits bei seiner Rede 2020 in Le Creusot bekräftigte der französische Präsident die militärischen Ambitionen seines Landes: „Die Atomenergie wird der Eckpfeiler unserer strategischen Autonomie bleiben. Es geht um alle Teile der Abschreckung, um den Antrieb unserer Atom-U-Boote, U-Boote für den Abschuss ballistischer Raketen. Und um den Antrieb unserer nuklearen Flugzeugträger.“[8]
Kommt das globale Atomwaffenverbot?
Andere europäische Länder positionieren sich währenddessen eindeutig gegen Atomenergie und auch gegen Nuklearwaffen. Mit dem Atomwaffenverbotsvertrag existiert seit dem 22. Januar 2021 der erste multilaterale UN-Vertrag, der diese Massenvernichtungswaffen bannen soll. 59 Staaten sind dem Abkommen bereits beigetreten, darunter als europäische Länder Österreich, Irland und Malta. Deutschland, Norwegen, Schweden, Finnland und die Schweiz werden an der ersten Konferenz im März 2022 in Wien als Beobachter teilnehmen.[9]
Kritiker*innen werten das völkerrechtliche Verbot als reine Symbolpolitik, da mit der Zustimmung der Atomwaffenstaaten nicht zu rechnen ist. Befürworter*innen halten dagegen, dass die ungeheure Zerstörungskraft von Atomwaffen und die inakzeptablen humanitären Auswirkungen eines möglichen, begrenzten Atomkrieges den gesamten Planeten Erde und seine Menschen betreffen würden. Ein Atomkrieg würde mit dem abrupten Absinken der globalen Durchschnittstemperatur drastische Klimafolgen für die gesamte Menschheit nach sich ziehen und hätte extreme Hungersnöte auf Nord- und Südhalbkugel zur Folge. Laut einer Studie der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW) könnten dabei bis zu zwei Milliarden Menschen sterben.[10]
Zudem sind die finanziellen Kosten für den zivil-militärischen Atomkomplex immens. Das Atlantic Council schätzt, dass allein die zivilen Atomanlagen in den USA jährlich mindestens 42,4 Mrd. US-Dollar kosten.[11] Und laut der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) investieren alle Atomwaffenstaaten zusammen über einhundert Mrd. US-Dollar jährlich in ihre Atomwaffenarsenale.[12]
Wirtschaftlich alles andere als wettbewerbsfähig
Wirtschaftlich gesehen ist Atomkraft alles andere als wettbewerbsfähig, und sie ist gesundheitsschädigend. Außerdem kommt sie aufgrund der langen AKW-Bauzeiten von 10 bis 15 Jahren als Lösung für die Bekämpfung des Klimawandels zu spät. Hinzu kommt, dass Investitionen in veraltete Energiezweige den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen. Das zeigt eine großangelegte Studie der Universität Sussex von Energieforscher Benjamin Sovacool und seinem Team.[13]
Letztlich versteckt Frankreich hinter der geplanten Modernisierung seiner Atomkraft für angeblich billigeren Strom die Agenda seines Nuklearwaffenprogramms. Die exorbitanten Kosten seiner zivil-militärischen Atomindustrie bürdet der Staat seit Jahren den französischen Steuerzahler*innen auf: Allein der Bau des Druckwasserreaktors in Flamanville verschlang beispielsweise 19,4 Mrd. Euro.[14]
Vor allem aber gilt: Hält die EU-Kommission daran fest, der Nuklearenergie ein grünes Label zu verpassen, so werden Stromkund*innen und Investor*innen mit dem vermeintlichen Klimaretter Atomkraft insbesondere auch militärische Anwendungen subventionieren.
[1] World Nuclear Industry Status Report, www.worldnuclearreport.org, 28.9.2021.
[2] Vgl. Bernhard Pötter, Der Zombie der Klimadebatte: Falsche Verheißung Atomkraft, in: „Blätter“, 8/2021, S. 13-16.
[3] Emmanuel Macron, Discours du Président de la République au Creusot sur l’avenir du nucleáire, www.elysee.fr, 8.12.2020.
[4] Andreas Apetz, Sputnik-Schock: China testet Hyperschallrakete – USA will Wettrüsten starten, www.fr.de, 28.10.2021.
[5] Atlantic Council Task Force on US Nuclear Energy Leadership, US nuclear energy leadership: Innovation and the strategic global challenge, www.atlanticcouncil.org, 20.5.2019.
[6] Wie Frankreich 2030 aussehen soll, www.tagesschau.de, 12.10.2021.
[7] Jürg Kürsener, Neue Jagd-Unterseeboote unterstreichen Frankreichs Weltmacht-Ambition, www.nzz.ch, 12.7.2019.
[8] Emmanuel Macron, Discours du Président de la République au Creusot sur l’avenir du nucleáire, a.a.O.
[9] Vgl. Xanthe Hall, Ächtet die Bombe!, in: „Blätter“, 8/2015, S. 21-24; Thomas Müller-Färber, Atomwaffen: Geächtet, nicht gebannt, in: „Blätter“, 7/2017, S. 25-28; Eva Senghaas-Knobloch, Nukleare Teilhabe: Die fatale Illusion der Sicherheit, in: „Blätter“, 6/2020, S. 41-44; Hans-Peter Waldrich, Philosophen gegen die Bombe. Wie wir der herrschenden Apokalypse-
blindheit trotzen, in: „Blätter“, 7/2020, S. 106-114.
[10] Ira Helfand, Nuclear Famine: Two billion people at risk?, IPPNW 2013.
[11] Robert F. Ichord, Jr. und Bart Oosterveld, The value of the US nuclear power complex to US national security, www.atlanticcouncil.org, 14.10.2019.
[12] Vgl. Complicit: 2020 global nuclear weapons spending, www.icanw.org, 7.6.2021.
[13] Benjamin K. Sovacool u.a., Differences in carbon emissions reduction between countries pursuing renewable electricity versus nuclear power, in: „Nature Energy“, 5/2020, S. 928-935.
[14] Felix Maise, EPR Flamanville – vom Vorzeige-
produkt zum Albtraum Frankreichs, www.energiestiftung.ch, 3.12.2020.