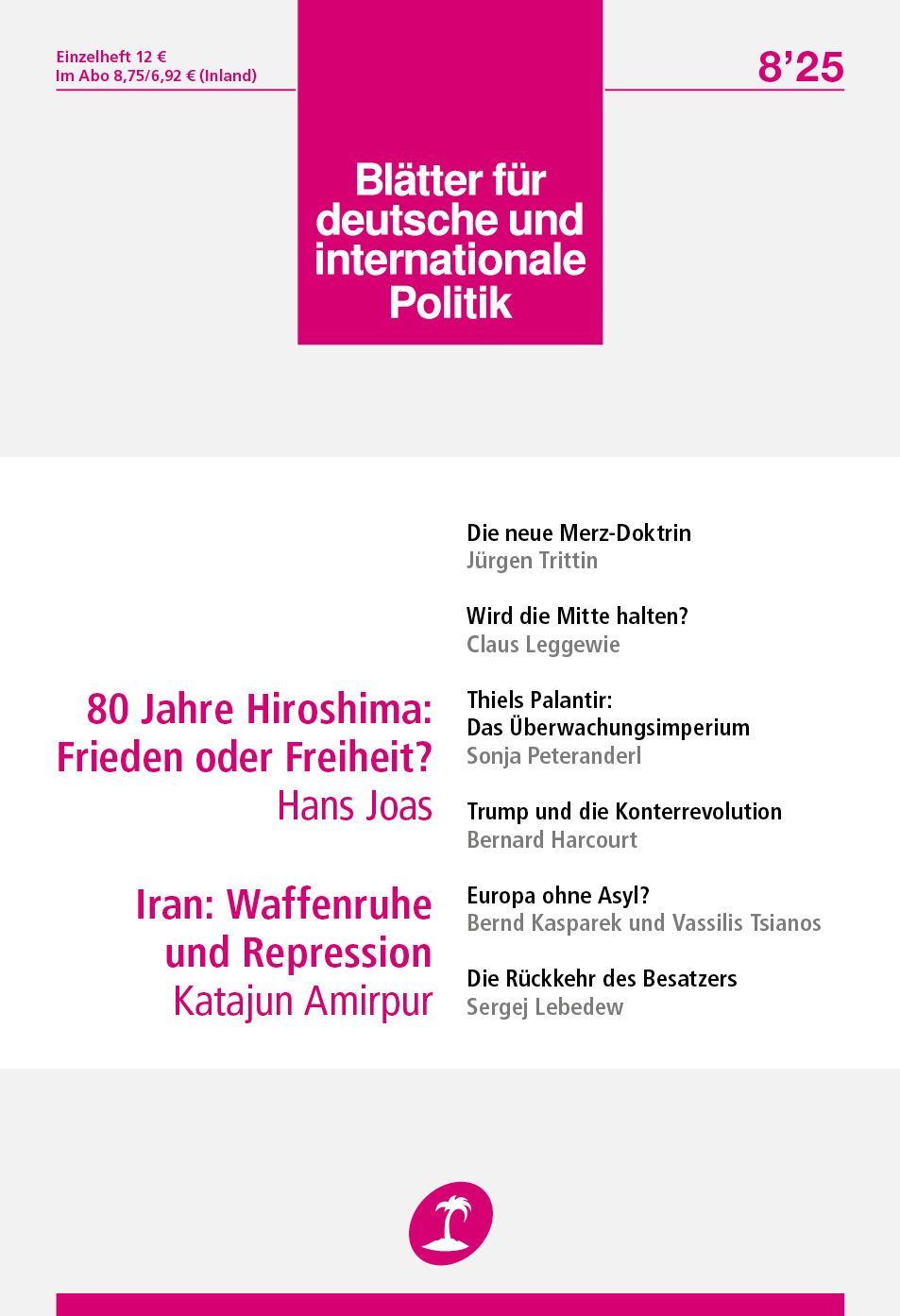Bild: Bundeswehr-Soldaten und -Soldatinnen, 28.6.2025 (IMAGO / NurPhoto)
In der Juli-Ausgabe beschrieb die wissenschaftliche Direktorin am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Ina Kraft, mögliche autoritäre Gefährdungen der Bundeswehr. Im Anschluss daran analysiert »Blätter«-Herausgeber Klaus Naumann anhand neuester Befunde die demokratische Substanz der Truppe und fragt nach ihrer Resilienz gegenüber dem Autoritarismus.
Vor zwanzig Jahren prägte der damalige Bundespräsident Horst Köhler die Formulierung, die deutsche Gesellschaft blicke mit „freundlichem Desinteresse“ auf die Bundeswehr. Damals schienen alle Bedrohungen weit weg. Sicherheitsvorsorge war mit den Auslandseinsätzen externalisiert worden. Spätestens nach Aussetzung der Wehrpflicht 2011, unter Bundeskanzlerin Angela Merkel und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, verschwand die Bundeswehr aus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Nur Mängelberichte und gelegentliche „Vorfälle“ in der rechtsextremistischen Grauzone sorgten für Schlagzeilen. Ansonsten gingen Gesellschaft und Streitkräfte getrennte Wege. Das ist inzwischen anders geworden. Der russische Aggressionskrieg gegen die Ukraine, die Verschlechterung der europäischen Sicherheitslage und die Rückkehr zum Primat der Bündnis- und Landesverteidigung haben die Wahrnehmung der Streitkräfte verändert und sie in die Öffentlichkeit zurückgeholt. Dort herrscht ein gemischtes Bild. Die Sympathiewerte boomen wie lange nicht, aber der Nachwuchs bleibt aus. Die Aufgaben wachsen, aber die Beschaffung lahmt. Die Debatten um Wehrbereitschaft und Wehrpflicht fördern besorgte Nachfragen: Wie sieht es in der Truppe aus, die über kurz oder lang Zugriff auf die jüngeren Jahrgänge erhalten soll?
Eine neue empirische Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr gibt Antworten; nach gehöriger Verzögerung ist sie jetzt endlich zugänglich geworden.[1] Den Anstoß hatten 2020 die Skandale um „extremistische Tendenzen“ im Kommando Spezialkräfte (KSK) gegeben.[2] Die Befunde gehen weit über den damaligen Anlass hinaus. Was hier vorliegt, ist kein Extremismus-Barometer (wie es der Militärische Abschirmdienst regelmäßig erarbeitet), sondern ein ausdifferenziertes Soziogramm der politischen Einstellungen und Haltungen von – militärischen und zivilen – Bundeswehrangehörigen, angereichert durch Vergleichsdaten der Zivilbevölkerung. Der Aussagewert der Studie wird erhöht durch die methodische Anlehnung an die Leipziger Extremismus-Studien und die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung.[3] Dadurch ist eine Vergleichbarkeit gewährleistet. Kurzum, das unbekannte Wesen „Bundeswehrsoldat:in“ oder, wie es im Titel heißt, die „Armee in der Demokratie“ bekommt nun ein Gesicht.
»Befragungen dieser Art haben unvermeidlich mit einem erwünschten Antwortverhalten zu kämpfen.«
Die Bundeswehr könnte mit den Ergebnissen der Befragungen und Gruppendiskussionen zufrieden sein – wenn sie nur den Mut fände, damit hausieren zu gehen und ihre Nutzanwendung zu diskutieren und zu demonstrieren. Die Vorurteile über eine massiv nach rechts hin abdriftende Truppe bewahrheiten sich nicht. Die Studie belegt, dass weniger als ein Prozent der Bundeswehrangehörigen „manifeste“ und „konsistent rechtsextremistische Haltungen“ aufweisen. In der Bevölkerung liegt der Vergleichswert mit 5,4 Prozent um ein Vielfaches höher. Insgesamt wird deutlich, dass im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt unter Bundeswehrangehörigen nicht nur eine geringere Unterstützung (rechts-)extremistischer Positionen anzutreffen ist, sondern das Interesse an Politik auch höher ist und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen und die generelle Demokratiezufriedenheit größer als in den Zivilbevölkerung. Dem Befund kann entgegengehalten werden, darauf macht das Autorenteam selbst aufmerksam, dass Befragungen dieser Art unvermeidlich mit einem erwünschten Antwortverhalten zu kämpfen haben und die Extremistenquote höher liegen dürfte, als die Zahlen erkennen lassen. Das muss man im Auge behalten, und dennoch lässt sich ein repräsentatives und realistisches Bild mit einiger Tiefenschärfe zeichnen. Die Studie demonstriert das am Beispiel der Selbst- und Fremdzuschreibungen im Rahmen der Rechts-links-Einstufung.
Erwartungsgemäß folgen die Befragten einem konformistischen Trend, wenn sie sich überwiegend (55 Prozent) in „der Mitte“ positionieren. Mit diesem Wohlfühlbegriff könnte sich eine oberflächliche Betrachtung zufrieden geben, wenn dem nicht eine zweite Auskunft zur Seite gestellt worden wäre. Und siehe da, die Befragten verorten ihren Kameradenkreis als „weiter rechts“ (über 60 Prozent), als sie sich selbst einschätzen. Ohne sich aus der Deckung zu wagen, signalisieren sie, „dass das Meinungsklima in der Bundeswehr rechts der Mitte, jedoch nicht am rechten Rand, zu verorten ist.“ (S. 66) Die Unterscheidung zwischen „Mitte rechts“ und „rechtem Rand“ ist aus zwei Gründen entscheidend. Zum einen verweist sie auf – fluide – Nahtstellen, sogenannte Brückendiskurse, zwischen rechts außen und antiextremistischen Haltungen. Zum anderen ist mit der Beschreibung des Meinungsklimas indirekt ein berufstypisches Merkmal des Militärs tangiert, das Samuel Huntington einmal als „Militärkonservatismus“ beschrieben hat, in dem sich ein skeptisches Menschenbild, Institutionenvertrauen und ein antivisionärer Pragmatismus zusammenfinden.[4] Beiden Spuren folgt die Studie.
Die Bundeswehr ist keinesfalls „immun“, wie es gern heißt, gegenüber den ideologischen Strömungen in der Gesamtgesellschaft. Diese werden von Bewerbern in die Truppe mitgebracht, im Dienstalltag erfahren oder dort ansozialisiert; sie entstehen aus Gründen politischer Unzufriedenheit oder aufgrund spezieller Ausprägungen des soldatischen Selbstverständnisses. Die Aufnahmebereitschaft für abweichende Haltungen konzentrieren sich auf Bundeswehrangehörige mit geringerem Bildungsniveau, die Altersgruppe der 25- bis 29-Jährigen, niedrige Dienstgrade und die Organisationsbereiche Heer und Streitkräftebasis; eine Beobachtung, die sich mit den allgemeinen Befunden der Extremismusforschung deckt.
»Unübersehbar geht eine positive Sicht auf die Wehrmacht mit einer größeren Zustimmung für rechtsextremistische Positionen einher.«
Wo aber beginnt der Extremismus? Die Befragung konzentriert sich auf die Phänomenbereiche der Neuen Rechten, der Reichsbürger/Verschwörungserzählungen und des Rechtsextremismus. Schwellenwerte zu Letztgenanntem werden greifbar, wenn in den Einstellungsmustern Präferenzen zusammenkommen, die beispielsweise für ein „starkes Nationalgefühl“ und eine „harte und energische Interessenpolitik“ eintreten und sich dies verbindet mit dem Votum für die „Durchsetzung des Stärkeren“, die Einschränkung des parlamentarischen Einflusses, dem Ruf nach einer „starken Elite“, dem allgemeinen Misstrauen gegenüber den Medien, dem Verdacht, die Geschicke würden durch „geheime Organisationen“ gelenkt und dem Eindruck, es herrsche ohnehin – auch in der Bundeswehr – eine Atmosphäre der Sprechverbote. Hinzu kommen Überzeugungen, die im speziellen Erfahrungsraum Bundeswehr entstehen. Auffällig sind einige Befunde: Ambivalente Haltungen sind anzutreffen, wenn es um das Kämpferideal geht oder die Fragen, ob die Streitkräfte der „zivilen Kontrolle“ unterliegen sollen, oder ob die Innere Führung angemessen umgesetzt und gelebt wird. Unübersehbar geht eine positive Sicht auf die Wehrmacht mit einer größeren Zustimmung für rechtsextremistische Positionen einher.
Erst die Häufung zustimmender Voten definiert eine „konsistent“ oder „manifest“ (rechts-)extremistische Haltung. Gleichwohl ist deutlich zu erkennen, dass der Extremwert – ungeachtet der erfreulich geringen Repräsentanz –, eingebettet ist in ein vielstimmiges Ensemble gängiger („rechter“) Überzeugungen, das in vielfältiger Kombination flexibel, dynamisch und plural artikuliert wird.[5] Die Ergebnisse der Studie erlauben, im Gesamtkomplex der Einstellungsmuster eine Reihe aktuell relevanter Brückendiskurse zu identifizieren, die eine Rutschgefahr nach rechts außen signalisieren können.
Zwar verfügen „nur“ 11 Prozent der Soldatinnen und Soldaten (Gesamtbevölkerung: 29 Prozent) über ein „geschlossenes Weltbild“ im Phänomenbereich Neue Rechte, doch bereits 20 Prozent des Militärs (alle: 17 Prozent) vermuten „geheime Organisationen, die großen Einfluss auf die Politik haben“. Und ganze 51 Prozent der Uniformträger (alle: 36 Prozent) verlangen, „endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl“ zu haben. Eine Rutschbahn für politische Radikalisierung bietet das auffallend stark verbreitete Gefühl (79 Prozent), dass „Dinge nicht mehr beim Namen genannt werden“ (Bevölkerung: 65 Prozent) und dass „immer mehr vorgeschrieben wird, was man sagen darf“ (47 Prozent; Bevölkerung: 54 Prozent). Nicht nur die Extremismusprävention, auch der Kommunikationsstil in der Bundeswehr wird sich damit auseinandersetzen müssen. Die Studie empfiehlt: nicht tabuisieren, sondern thematisieren!
Die Meinungstreiber für extremistische Einstellungen sind in Militär und Bevölkerung vergleichbar. Die spannende Frage ist, was macht die Bundeswehr, aufs Ganze gesehen, resistenter gegen einen Trend nach rechts außen?
»Um die Demokratie zu verteidigen, braucht es Vertrauen, und genau das ist belastet.«
Aufschlussreich sind die Gruppendiskussionen, die den Befragungen zusätzliche Aussagekraft verleihen. Die „kollektiv geteilten Sprech-, Denk- und Handlungsweisen“, die hier offenbar werden, erlauben einen guten Einblick in die Ambivalenzen eines soldatischen „Sonderbewusstseins“. Anschaulich fasst sich das in der Bemerkung eines Diskussionsteilnehmers zusammen, das Leben in der auf Dauer gestellten „Extremsituation“ mache den Soldaten gleichsam zu einem professionellen „Demokratieextremisten“. In dieser Formel findet sich eine Reihe von Merkmalen des Berufs- und Selbstbildes wieder. Zunächst auf den „Ernstfall“ bezogen, geht es im Weiteren um ein Entbehrungsethos der Leidens- und Opferbereitschaft, die Abgrenzung von den anderen des zivilen Umfeldes, aber auch um den Eindruck, von der Gesellschaft und Politik „alleingelassen“ zu werden. Politik und politische Äußerungen erscheinen in den Gesprächen als Gefahr; sie erzeugen „politische Verhaltensunsicherheit“, denn sie sind riskant und zugleich relevant. Allzu leicht kann man missverstanden und stigmatisiert werden, aber die existenzielle Rahmung des militärischen Auftrags macht die Bundeswehrangehörigen extrem abhängig von politischen Entscheidungen und Versäumnissen, ohne dass sie darauf Einfluss nehmen könnten. Die Reaktion auf dieses Dilemma, so lassen sich die Äußerungen interpretieren, besteht einerseits in dem zu verzeichnenden hohen Anspruch an Politik und Institutionen, den hohen Erwartungen an Anerkennung und Verständnis – und andererseits in einer vorsichtigen Zurückhaltung nach außen, im Rückzug aufs Formale der Zuständigkeiten und auf den Schutzraum der militärischen Binnenkultur. Die Wechsellagen von Loyalität und Eigensinn, von Regeltreue und Kameradschaft spiegeln sich in den Bewertungen des Meldeverhaltens extremistischer bzw. regelwidriger Vorfälle in der Truppe wider. Statistisch regiert dabei eine Dreiteilung der Optionen: Nach oben melden, nicht melden oder informell beilegen. Beilegen, das kann Klärung bedeuten, aber auch Vertuschung.
Die Praxis der Inneren Führung, das belegt die Studie, stößt unter den Befragten trotz grundsätzlicher Akzeptanz auf eine zwiespältige, unentschiedene Resonanz. Das spricht nicht dafür, dass dieses bemerkenswerte Führungskonzept in seiner ursprünglichen Bedeutung erkannt, gelehrt oder gelebt wird – „als eine Instanz, die die naturgegebenen Spannungen in den zivil-militärischen Beziehungen genauso wie der soldatischen Existenz deutlich machte und alle zur Mitarbeit aufforderte, diese Spannungen zu reduzieren, produktiv aufzulösen, zu versöhnen oder einfach nur auszuhalten“.[6] Damit sind die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr immer wieder konfrontiert. Die Selbstbeschreibung als „Demokratieextremisten“ zeichnet kein Idealbild von Musterdemokraten, sondern sie betont den Anspruch, dass man bereit sein müsse, „die Demokratie zu verteidigen, und nicht […] bei Worten aufhört. Dafür sind wir ja da.“ (S. 134) Dafür braucht es Vertrauen, und genau das ist belastet. Das macht die Potsdamer Studie unübersehbar deutlich.
[1] Markus Steinbrecher, Heiko Biehl und Nina Leonhard, Armee in der Demokratie. Ausmaß, Ursachen und Wirkungen von politischem Extremismus in der Bundeswehr. Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Forschungsbericht, Potsdam 2025. Die Seitenangaben im Folgenden beziehen sich auf diese Studie.
[2] Vgl. Klaus Naumann, KSK oder: Bundeswehr ohne Innere Führung?, in „Blätter“, 9/2020, S. 33-36.
[3] Andreas Zick, Beate Küpper und Nico Mokros (Hg.), Die distanzierte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23, Bonn 2023; Oliver Decker u.a. (Hg.), Autoritäre Dynamiken in unsicheren Zeiten. Neue Herausforderungen – alte Reaktionen? Leipziger Autoritarismus-Studie 2022, Gießen 2022.
[4] Vgl. Klaus Naumann, Militärkonservatismus – auf der schiefen Ebene? Annäherung an ein umstrittenes Einstellungsmuster, in: „Zeitschrift für Innere Führung“, 1/2021, S. 53-59.
[5] Vgl. Michael Freeden, Ideologies and Political Theory. An Conceptual Approach, Oxford 1996.
[6] Uwe Hartmann, Der gute Soldat. Politische Kultur und soldatisches Selbstverständnis heute, Berlin 2018, S. 66.