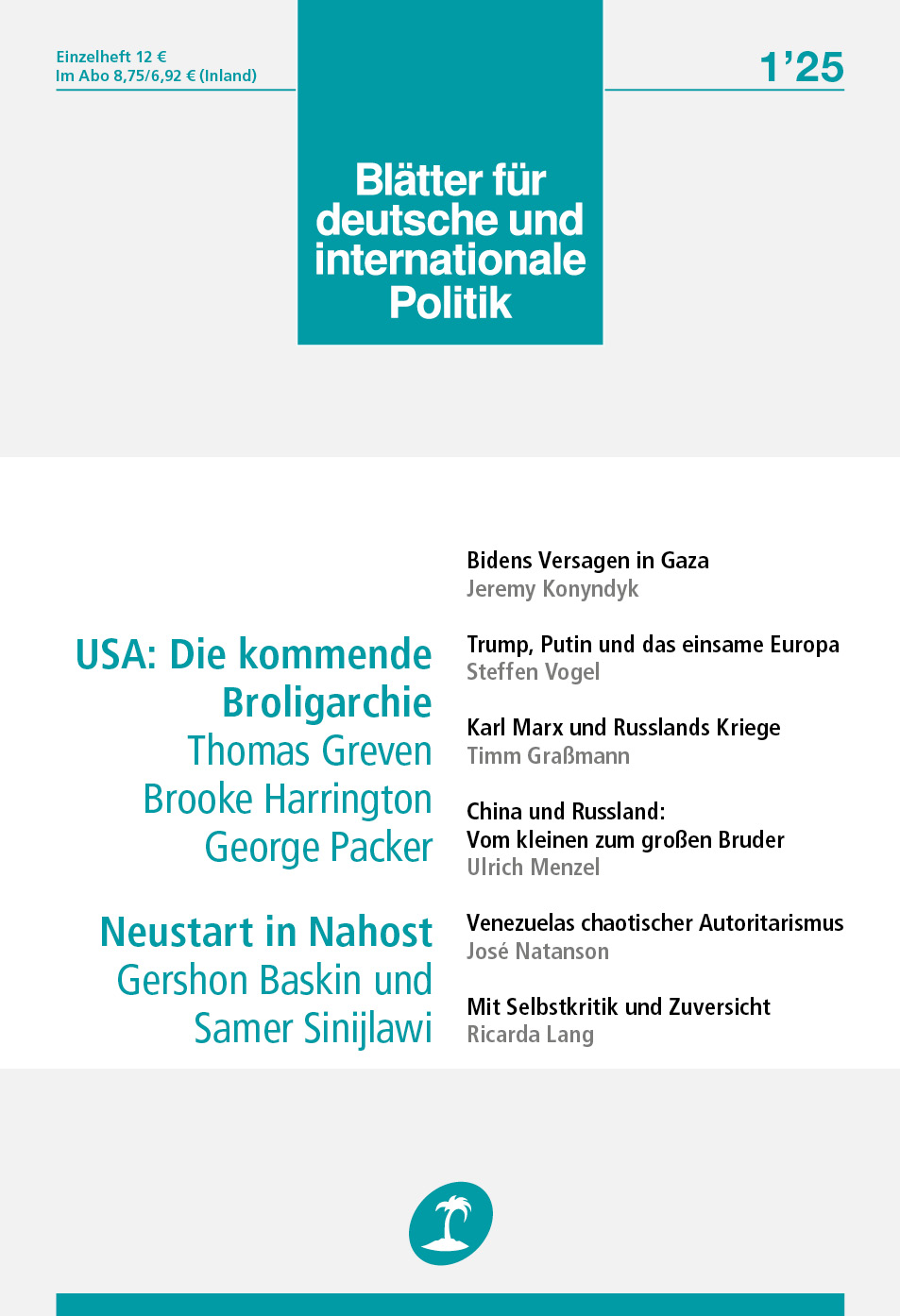Bild: Die Syrer:innen feiern den Sturz des Diktatord Baschar al-Assad in Damaskus, 10.12.2024 (IMAGO / Middle East Images)
Für die Ewigkeit war sie erschaffen, die Herrschaft der Assads. So zumindest lautete das Glaubensbekenntnis ihrer Anhänger: „Assad bis in alle Ewigkeit“. Am Ende dauerte diese Ewigkeit 54 Jahre. 1970 hatte Hafiz al-Assad, der Vater des jetzt gestürzten Präsidenten Bashar al-Assad, die Macht an sich gerissen. Er machte aus der von Instabilität und Militärputschen geplagten jungen Republik Syrien ein sozialistisches Einparteienregime und einen hochkorrupten Polizeistaat – das „Königreich des Schweigens“, wie ein syrischer Dichter es einst beschrieb.
Der erste Versuch, dieses in sich geschlossene und systematisch folternde Regime zu beseitigen, scheiterte Anfang der 1980er Jahre. Ein Aufstand der Muslimbrüder wurde brutal niedergeschlagen und endete 1982 mit der Zerstörung der Stadt Hama und mehreren Zehntausend Toten. Daraufhin legte sich Grabesruhe über das Land. Der zweite Anlauf folgte, nachdem der junge Bashar das Präsidentenamt im Jahr 2000 von seinem Vater geerbt hatte. Intellektuelle und Kritiker des Regimes veranstalteten im Zuge des „Damaszener Frühlings“ private Diskussionszirkel, sie veröffentlichten Erklärungen und forderten politische Reformen. Die Hoffnung auf Veränderungen war damals groß, aber der 34-jährige Machthaber erwies sich als Modernisierer, nicht als Reformer. Er verbot jede kritische politische Aktivität, alle führenden Oppositionellen landeten für Jahre im Gefängnis.
Erst im Zuge der arabischen Aufstände von 2011 überwanden Hunderttausende Syrerinnen und Syrer ihre Angst. Sie demonstrierten für Würde und Freiheit, forderten ein Ende von Korruption und Willkür. Das Regime reagierte mit brutaler Gewalt und Repression, verhaftete Zehntausende, schickte das Militär, bombardierte Wohnviertel und setzte das Nervengas Sarin ein. Die zunächst friedliche Revolution entwickelte sich zu einem blutigen Konflikt und Stellvertreterkrieg mit vier militärischen Interventionsmächten. Russland und die Islamische Republik Iran sicherten Assads Herrschaft, die Türkei besetzte im Norden Teile des Grenzgebietes, die USA führten eine internationale Koalition gegen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) an. Für den Schutz von Zivilisten vor den Luftangriffen Russlands und des Regimes setzte sich jahrelang niemand ein.
Nach einer von Russland und der Türkei ausgehandelten Waffenruhe im März 2020 zerfiel Syrien in vier Einflusszonen. In den bevölkerungsreichen Gebieten im Zentrum, entlang der Küste und im Süden herrschte das Assad-Regime. Den Nordosten, fast ein Drittel des Staatsgebietes, verwaltete die kurdisch dominierte Demokratische Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien (DAANES), militärisch gesichert von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF), den Verbündeten des Westens im Kampf gegen den IS. Die letzte von Assad-Gegnern gehaltene Region in der nordwestlichen Provinz Idlib wurde von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrolliert, jenem Zusammenschluss militant-islamistischer Brigaden, der jetzt bis Damaskus marschierte und die Macht übernahm. Im Norden besetzte Ankara in drei Militäroperationen 2016, 2018 und 2019 Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze, die sie mit Hilfe syrischer Söldnertruppen, der Syrischen Nationalen Armee (SNA) und Oppositionellen der Syrischen Interimsregierung (SIG) als Statthaltern kontrollierte.
Angesichts anderer Krisen verschwand Syrien aus den westlichen Schlagzeilen. Der Konflikt galt als eingefroren, was viele Beobachter von außen als Stabilität missverstanden. In Wirklichkeit ging die Gewalt auf niedriger Flamme vielerorts weiter, und die Syrer versanken in Elend und Perspektivlosigkeit, vergessen von der Welt. 90 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, 16,7 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen – so viele wie noch nie. Dazu ein Regime, das vom Drogenhandel und der Veruntreuung humanitärer Hilfe lebt. Es war eine Frage der Zeit, bis der Frust in offene Konfrontation umschlagen würde.
Allerdings hatte niemand damit gerechnet, dass das Regime am Ende so schnell in sich zusammenbrechen würde – auch nicht die Kämpfer von HTS. Nur zehn Tage nachdem sie am 27. November 2024 eine Offensive im Nordwesten des Landes gestartet hatten, war Damaskus von mehreren Seiten eingekreist. Die Städte Aleppo, Hama und Homs fielen ohne große Gegenwehr an die von HTS angeführten Verbände. Ihr Vormarsch löste eine landesweite Dynamik aus, die nicht mehr zu stoppen war. Im Süden formierten sich Rebellenverbände neu und eroberten die Provinz Daraa, in deren Hauptstadt im Frühjahr 2011 die ersten größeren Proteste stattgefunden hatten. Im Südosten befreiten drusische Milizen die Provinz Sweida, im Osten nahmen die kurdisch geführten SDF einen wichtigen Grenzübergang zum Irak ein, wodurch der Nachschub des syrischen Regimes an Kämpfern und Waffen aus dem Iran gestoppt wurde.
In der Nacht zum 8. Dezember war es dann vorbei, Assad verließ per Flugzeug das Land in Richtung Moskau und HTS-Chef Ahmed Al-Sharaa, besser bekannt unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Golani, zog in Damaskus ein. Seit Beginn der Offensive bemüht sich der 42-Jährige um Verständigung mit allen Gesellschaftsgruppen, fast täglich sendete er versöhnliche Botschaften.
Al-Golani: Islamist im Selenskyj-Look
Dahinter steckt keine kurzfristige Charmeoffensive, sondern langfristiges Kalkül. Der einstige Al-Qaida-Anführer arbeitet seit Jahren an einem Imagewandel, tauschte Turban gegen Anzug und gibt sich gemäßigt, um international als Ansprechpartner anerkannt zu werden. 2013 brach er mit dem IS, 2016 mit Al-Qaida, seit 2017 regiert er mit seiner „Heilsregierung“ Teile der Provinz Idlib. Der Ministerpräsident dieser Heilsregierung, Mohammed al-Bashir, übernahm am 10. Dezember die Amtsgeschäfte in Damaskus. HTS hat also auf lokaler Ebene jahrelange Regierungserfahrung, ihre Herrschaft in Idlib gilt als autoritär, aber effektiv. Kritiker würden verfolgt, verhaftet und misshandelt, sagen Vertreter zivilgesellschaftlicher Gruppen in Idlib, aber die öffentliche Verwaltung funktioniere. Experten der International Crisis Group, einer NGO im Bereich der Konfliktbearbeitung, forderten deshalb schon länger einen pragmatischeren Umgang mit HTS.
Seit der Machtübernahme tourt al-Golani, auf den die USA zu Al-Qaida-Zeiten zehn Millionen US-Dollar Kopfgeld ausgesetzt hatten, im Selenskyj-Look durch das Land – schlichte dunkelgrüne Uniform, kurze Haare, Vollbart. Er spricht von einem „vereinten Syrien“ all seiner Bewohner und versichert den Minderheiten, sie hätten nichts zu befürchten. Den Nachbarländern und ausländischen Unterstützern Assads bietet al-Golani ebenfalls Zusammenarbeit und freundschaftliche Beziehungen an. Er nimmt frühzeitig Kontakt mit entscheidenden Akteuren innerhalb und außerhalb Syriens auf und baut erfolgreich Vertrauen auf. Ausgerechnet HTS, ein Bündnis radikaler Islamisten, einst hervorgegangen aus einem Al-Qaida-Ableger und deshalb von weiten Teilen der Welt als Terrororganisation eingestuft, schickt sich an, die Syrer zu einen. Kann das funktionieren?
Die ersten Anzeichen sind ermutigend. In christlichen Orten und Stadtvierteln bereiten die Christen unbehelligt Weihnachten vor, auch an der Küste, wo sich die einstigen Hochburgen des Regimes befinden, blieb die Lage weitgehend stabil. Vertreter der verschiedenen Religionen und Konfessionen – Sunniten, Christen, Alawiten, Drusen, Ismaeliten – erklärten ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den neuen Machthabern. Doch von Anfang an mischte sich in die Freude und Begeisterung über den Sturz Assads auch Skepsis und Sorge. Können sich die verschiedenen bewaffneten Gruppen auf eine neue Ordnung einigen oder verstricken sie sich in interne Machtkämpfe? Wird der syrische Staat zerfallen und als „failed state“ enden wie Libyen? Und wie radikal wird die neue Ordnung aussehen, droht unter HTS gar eine syrische Version der Taliban?
Stabilisierung oder Staatszerfall?
Diese drei Gefahren – interne Machtkämpfe, Staatszerfall und religiöser Extremismus – gilt es abzuwenden. Was bräuchte es dafür? Zunächst einen Schulterschluss von Arabern und Kurden. Kontraproduktiv wirken die Kämpfe nördlich von Aleppo, bei denen die von der Türkei finanzierten SNA-Söldner gegen die kurdischen Truppen der SDF vorgehen und Zehntausende Menschen – überwiegend Kurden, aber auch Christen und Jesiden – Richtung Osten über den Euphrat vertrieben haben.
Der türkische Präsident Erdog˘an sollte aufhören, Syriens Exilopposition gegen das kurdisch geführte Autonomieprojekt aufzubringen. Seine Interessen – die Rückkehr syrischer Geflüchteter aus der Türkei und eine Schwächung kurdischer Autonomie – könnten sich mit dem Ende Assads und einem inklusiven Neustart ohnehin erfüllen. Viele der mehr als vier Millionen Syrer in der Türkei werden freiwillig in ein befreites Syrien zurückkehren, wenn die Lage sicher erscheint. Und sollte die Demokratische Autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien (DAANES) in einem föderalen Syrien aufgehen, würde sie bei den Kurden in der Türkei auch kaum eigene Autonomiebestrebungen auslösen. Die Türkei hat deshalb keinen Grund mehr, Gebiete in Syrien zu besetzen und von kriminellen Söldnerbanden beschützen zu lassen. Sie könnte sich stattdessen für einen Wiederaufbau und eine Stabilisierung ganz Syriens einsetzen, damit an ihrer Südgrenze ein florierender Wirtschaftspartner entsteht und kein gescheiterter Staat.
Im Gegensatz zu den Islamisten der SNA bemüht sich HTS seit längerem um Verständigung mit den Kurden. Ihre beiden Anführer, HTS-Chef al-Golani und SDF-Kommandeur Mazlum Abdi, stehen in Kontakt und arbeiten an pragmatischen Lösungen vor Ort. So konnten etwa die kurdischen Bewohner Aleppos nach Verhandlungen überzeugt werden, zu bleiben. Sollte sich aus dieser ersten Koordination eine tragfähige Kooperation zwischen den beiden mächtigsten bewaffneten Akteuren – islamistischer HTS und kurdisch geführter SDF – entwickeln, würde das entscheidend zur Stabilisierung des Landes beitragen.
Das zweite Risiko, ein Staatszerfall, lässt sich nicht ganz ausschließen. Das Regime hatte sämtliche staatlichen Institutionen seit Jahrzehnten vereinnahmt. Justiz, Verwaltung, Militär und Polizei wurden mafiaähnlich geführt und dienten dem Machterhalt Assads, nicht den Menschen – viele Syrerinnen und Syrer haben dadurch ein gestörtes Verhältnis zum Staat. Das Vertrauen in staatliche Stellen aufzubauen, ist in Syrien deshalb mindestens genauso wichtig wie der Aufbau bzw. die Reform öffentlicher Institutionen. Immerhin arbeiten alle Beteiligten von Anfang an daran, öffentliche Gebäude zu schützen, staatliche Institutionen funktionsfähig zu halten und die Verwaltung geordnet an eine Übergangsregierung zu übergeben. Jede Form von Chaos würde der IS nutzen, um das entstehende Machtvakuum zu füllen – die Terrororganisation ist keineswegs verschwunden, sondern seit Monaten dabei, im Osten des Landes wieder zu erstarken.
Fest steht: Nach 61 Jahren Einparteienregime und 54 Jahren Assad-Diktatur wird es mit der Errichtung der Demokratie nicht so schnell gehen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, und ausländische Regierungen fordern zeitnah demokratische Wahlen, um eine Übergangsregierung zu legitimieren. Aber dafür braucht es entsprechende Voraussetzungen, die erst geschaffen werden müssen: Meinungs- und Versammlungsfreiheit, eine unabhängige Presse und Justiz, Parteienvielfalt und gesellschaftliche Teilhabe. Die Diaspora könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Sechs Millionen Exil-Syrer haben in den vergangenen 13 Jahren wichtige Erfahrungen gesammelt. Viele haben gesehen, wie Rechtsstaatlichkeit funktioniert und demokratische Prozesse ablaufen.
Vor allem bei der Aufarbeitung von Verbrechen und beim Thema Übergangsjustiz könnten syrische Nichtregierungsorganisationen im Ausland einen wichtigen Beitrag leisten, da sie in den vergangenen Jahren entsprechende Expertise im Bereich Dokumentation, Beweissammlung, Forensik und juristische Aufarbeitung gesammelt haben. Deutschland sollte dies unterstützen, denn nur wenn die Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, wird sich ein Gefühl von Gerechtigkeit einstellen, das für die gesellschaftliche Aussöhnung und eine Befriedung des Landes grundlegend ist.
Wird Syrien zum Gottesstaat?
Bleibt drittens die Frage, wie radikal-islamistisch eine neue Regierung unter HTS-Einfluss sein wird. Ein Taliban-Szenario wie in Afghanistan erscheint eher unrealistisch – al-Golani weiß, dass die syrische Gesellschaft dafür zu weltoffen, tolerant und gebildet ist. Deshalb positioniert er sich auffällig klar im Sinne eines Zusammenlebens der verschiedenen Religions- und Konfessionsgruppen. Es gibt keine Kleidervorschriften für Frauen, dafür Absprachen und Zusammenarbeit mit Christen und Alawiten und eine föderale Ordnung im Sinne der Kurden.
Illusionen sollte man sich dennoch nicht machen – unter HTS wird Syrien sicher religiöser, konservativer und restriktiver werden. Am Ende wird es auch darauf ankommen, wie die Extremisten in den eigenen Reihen reagieren. Sie könnten sich angesichts von so viel Versöhnungsrhetorik um den erhofften Gottesstaat betrogen fühlen, von al-Golani abwenden und rebellieren. Hat er die Autorität, diesen Unmut zu kontrollieren und zu seinen Ankündigungen zu stehen? Oder wird er am Ende Zugeständnisse an die Hardcore-Islamisten innerhalb von HTS und anderen Islamistenverbänden machen müssen? Schwer vorherzusagen.
Unabhängig davon, wie es weitergeht, haben die Syrerinnen und Syrer Historisches geleistet: Sie haben eine der brutalsten Diktaturen unserer Zeit zu Fall gebracht – aus eigener Kraft, nach unermesslichem Leid, unter widrigsten Umständen und im Stich gelassen von der internationalen Gemeinschaft. In dieser Stunde Null haben sie jede Unterstützung verdient, die die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in Syrien in den Mittelpunkt stellt.